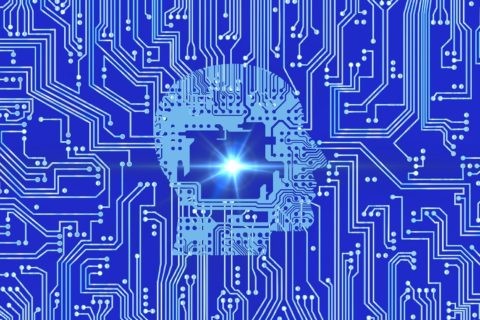Zum 30. Juli 2011 ist die Änderung des Baugesetzbuches durch das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ in Kraft getreten, mit dem zugunsten des Klimaschutzes neue Regelungen eingeführt werden, durch die der Handlungsspielraum der Gemeinden erweitert werden soll:

Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügte Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz bei der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung verstärkt berücksichtigt werden.
Der neue § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB bietet nun den Gemeinden die Möglichkeit, die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen dem Klimawandel entgegenwirkenden Maßnahmen im Flächennutzungsplan darzustellen. Dies betrifft insbesondere Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Flächennutzungsplan die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen darzustellen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen. Als eine solche Maßnahme kommt beispielsweise ein System von Kaltluftschneisen in Betracht.
In § 9 Abs. 1 BauGB wurde der Festsetzungskatalog für Bebauungspläne konkretisiert. So können jetzt etwa Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Koppelung nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB festgesetzt werden. Nach der neuen Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. b BauGB können bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen jetzt auch technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen festgesetzt werden.
Auch die Gestaltungsmöglichkeiten des städtebaulichen Vertrages in § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BauGB wurden im Hinblick auf die Nutzung erneuerbarer Energien erweitert, nunmehr kann auch die Errichtung und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Koppelung Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages sein. In einer neuen Nummer 5 werden darüber hinaus die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden konkretisiert.
Für Biomasseanlagen erhöht § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB den bisherigen Grenzwert von 0,5 Megawatt installierter elektrischer Leistung auf 2,0 Megawatt Feuerungswärmeleistung und das Äquivalent von 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr.
Mit der neuen Regelung des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB wird die Installation von Solaranlagen in, an oder auf zulässigerweise genutzten Gebäuden im Außenbereich erleichtert. Ab sofort sind Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (Solarthermieanlagen und Photovoltaikanlagen) im Außenbereich privilegiert zulässig, sofern die Anlage dem Gebäude baulich untergeordnet ist.
Im Rahmen des Besonderen Städtebaurechts wird durch die Neuregelung des § 148 BauGB die Maßnahmengruppe „Anlagen zur Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ in den Katalog der für eine Gebietsaufwertung / -anpassung relevanten Baumaßnahmen aufgenommen.
Auch das Themenfeld „Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung“ wird in § 171a BauGB neu in den Katalog städtebaulicher Funktionsverluste aufgenommen, deren Vorliegen Voraussetzung und deren Beseitigung Ziel von Stadtumbaumaßnahmen ist. D.h. quartiersbezogene Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes und der Klimaanpassung können Ziele von Stadtumbaugebieten sein.
Mit der neuen Bestimmung des § 248 BauGB soll in Fällen nachträglicher Wärmedämmung die geringfügige Überschreitung des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche ermöglicht werden, ebenso auch bei der Errichtung von Solaranlagen in, an und auf Dachflächen und Außenwandflächen.
Und schließlich werden mit dem neu in der Baugesetzbuch eingeführten § 249 BauGB Regelungen zur Absicherung des Repowerings von Windkraftanlagen getroffen. Mit diesen Regelungen für den Fall der Ersetzung alter Anlagen durch neue, in der Regel leistungsfähigere Windenergieanlagen sollen Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf die Neuausweisung von Gebieten für das Repowering beseitigt werden.