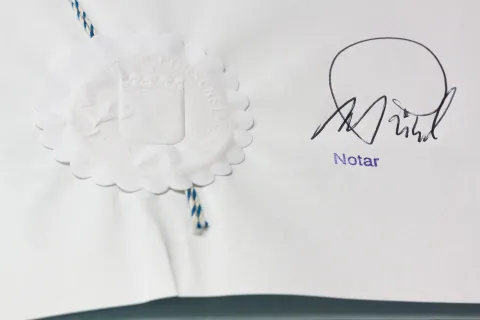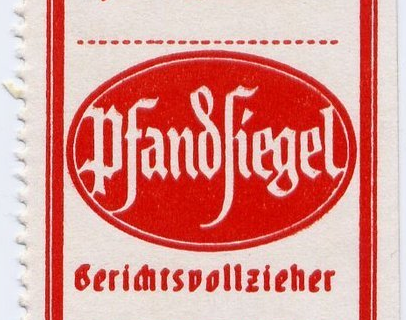In das durch Art. 12 Abs. 1 GG garantierte einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit darf nur auf gesetzlicher Grundlage und unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eingegriffen werden1. Hier findet das Vertretungsverbot seine rechtliche Grundlage in § 114 Abs. 1 Nr. 4 BRAO wegen schuldhafter Verletzung von Pflichten aus §§ 43, 43a BRAO.

Die Anwendung dieser Normen durch die Anwaltsgerichte2 begegnet dabei im vorliegenden Fall auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit keinen verfassungsrechtlichen Bedenken:
Soweit die Rechtsanwältin vorträgt, dass die Beschränkung des Vertretungsverbots auf das Familienrecht auf sachfremden Erwägungen beruhe, vermögen ihre Ausführungen nicht zu entkräften, dass wesentliche festgestellte Berufspflichtverletzungen, auf die insbesondere der das Vertretungsverbot verhängende Anwaltsgerichtshof seine Entscheidung gründet (unterlassene Weiterleitung von Kindesunterhalt; Preisgabe sensibler persönlicher, in der familiären Situation der Mandanten liegender Daten im Internet; herabwürdigende Äußerungen der Rechtsanwältin betreffend eine Richterin in Bezug auf deren Protokollierung in einem familienrechtlichen Verfahren) im Familienrecht wurzeln.
Dass weitere Pflichtverletzungen sich auf andere Rechtsgebiete oder gar den rechtsgebietsunabhängigen Auftritt der Rechtsanwältin beziehen, ändert an der Vertretbarkeit der vom Anwaltsgerichtshof vorgenommenen, schwerpunktorientierten Wertung nichts.
Soweit die Rechtsanwältin weiter vorträgt, dass die Beschränkung auf das Familienrecht wegen ihres Tätigkeitsschwerpunkts auch als Fachanwältin dieses Rechtsgebiets letztlich wie ein Berufsverbot wirke, welches vom Anwaltsgerichtshof selbst für unverhältnismäßig erachtet worden sei, geht sie nicht genügend auf dessen Entscheidungsgründe ein. Der Anwaltsgerichtshof begründet die Verhältnismäßigkeit des Vertretungsverbots eingehend und unter besonderer Beachtung der beruflichen und persönlichen Situation der Rechtsanwältin und der wirtschaftlichen Folgen für diese. Die Wertung, dass sich das Vertretungsverbot für die Rechtsanwältin zwar als eine äußerst spürbare Maßnahme darstelle, aufgrund ihrer bereits gegenwärtig ausgeübten anwaltlichen Tätigkeit in anderen Rechtsgebieten, die durch Umorganisation noch ausgeweitet werden könne, aber nicht die Wirkung eines faktischen Berufsverbots auf Zeit habe, wird von der Rechtsanwältin nicht entkräftet. Daher ist die Annahme des Anwaltsgerichtshofs, dass die Rechtsanwältin in der Lage sei, ihren Beruf auch auf der Grundlage nicht familienrechtlicher Mandate weiter auszuüben, von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 26. April 2023 – 1 BvR 733/23
- stRspr; vgl. nur BVerfGE 36, 212 <219 ff.> 45, 354 <358 f.> 93, 362 <369> 135, 90 <111 Rn. 57> 141, 82 <98 Rn. 47> 145, 20 <67 Rn. 121>[↩]
- BGH, Beschluss vom 29.11.2022 – AnwSt(R) 4/22, BayAnwGH, Urteil vom 01.02.2022 – BayAGH II-2 – 9/21; AnwG München, Urteil vom 08.06.2021 – 3 AnwG 55/16, 41 EV 536/14[↩]