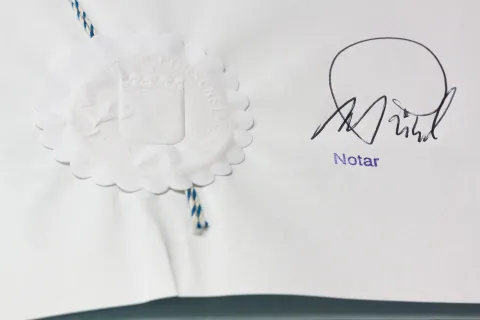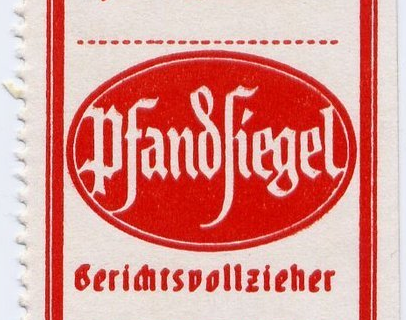Wird einer Partei entgegen § 317 Abs. 1 Satz 1, § 169 Abs. 2 Satz 1 ZPO statt einer beglaubigten Abschrift lediglich eine einfache Abschrift des Urteils zugestellt, wird der darin liegende Zustellungsmangel geheilt, wenn keine Zweifel an der Authentizität und Amtlichkeit der Abschrift bestehen. Das ist jedenfalls bei einer Übermittlung der Urteilsabschrift an das besondere elektronische Anwaltspostfach des Rechtsanwaltes der Partei anzunehmen.

Im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte das Landgericht Itzehoe einer Klage per Versäumnisurteil stattgegeben. Der Kläger nimmt die Beklagte auf Herausgabe eines Pkw, hilfsweise auf Zahlung in Anspruch. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht hat er beantragt, die Beklagte durch Versäumnisurteil zu verurteilen. Nachdem das Landgericht die mündliche Verhandlung geschlossen und eine Entscheidung am Ende des Sitzungstages angekündigt hatte, hat es die Sache am selben Tag wieder aufgerufen. In dem mit vollem Rubrum versehenen Protokoll heißt es: „Im Namen des Volkes ergeht das folgende Versäumnisurteil:“; daran schließt sich ein Urteilstenor an, mit dem der Klage stattgegeben worden ist. Dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten ist vom Gericht ein als „Abschrift des Protokolls vom 04.05.2020“ bezeichnetes Dokument an das besondere elektronische Anwaltspostfach übermittelt worden; am 11.05.2020 hat er das dazugehörige elektronische Empfangsbekenntnis zurückgesandt. Am 9.06.2020 hat der Prozessbevollmächtige der Beklagten gegenüber dem Landgericht erklärt, seines Erachtens sei allein durch die Übersendung des Protokolls der mündlichen Verhandlung keine wirksame Zustellung des Versäumnisurteils erfolgt. Daraufhin ist ihm am 10.06.2020 eine beglaubigte Abschrift des Protokolls zugestellt worden.
Den am 18.06.2020 eingegangenen Einspruch gegen das Versäumnisurteil hat das Landgericht wegen Versäumung der Einspruchsfrist als unzulässig verworfen1. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat die hiergegen gerichtete Berufung zurückgewiesen2. Und der Bundesgerichtshof hat nun auch die vom Oberlandesgericht zugelassene- Revision zurückgewiesen; zutreffend gehe das OLG Schleswig davon aus, dass das Versäumnisurteil, gegen das sich der Einspruch der Beklagten richtet, wirksam geworden ist:
Ein Urteil wird allerdings erst durch seine förmliche Verlautbarung mit allen prozessualen und materiellrechtlichen Wirkungen existent. Vorher liegt nur ein – allenfalls den Rechtsschein eines Urteils erzeugender – Entscheidungsentwurf vor, der nicht Gegenstand einer die Einspruchsfrist des § 339 Abs. 1 ZPO in Lauf setzenden wirksamen Zustellung sein kann3.
Das Versäumnisurteil ist entgegen der Ansicht der Revision jedoch wirksam verkündet worden.
Die Verkündung eines Urteils erfolgt grundsätzlich gemäß § 311 Abs. 2 Satz 1 ZPO durch Verlesen der Urteilsformel. Ist bei der Verkündung von den Parteien niemand erschienen, kann die Verlesung nach § 311 Abs. 2 Satz 2 ZPO durch Bezugnahme auf die schriftliche Urteilsformel ersetzt werden. Eine (weitere) Erleichterung besteht gemäß § 311 Abs. 2 Satz 3 ZPO bei der Verkündung von Versäumnis, Anerkenntnis- und Verzichtsurteilen sowie von Urteilen, die die Folgen der Zurücknahme der Klage aussprechen. Diese Urteile können verkündet werden, auch wenn die Urteilsformel noch nicht schriftlich abgefasst ist. Die Verkündung erfordert dann lediglich die mündliche Mitteilung der Urteilsformel4; bei Stattgabe der Klage in den Fällen des § 313b ZPO genügt die Bezugnahme auf den Klageantrag (§ 313b Abs. 2 Satz 4 ZPO).
Durch das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht ist die Beachtung der Förmlichkeiten bei der Verkündung des Versäumnisurteils gemäß § 311 Abs. 2 Satz 3 ZPO nachgewiesen (§ 165 Satz 1 ZPO). Danach ist die Urteilsformel im Anschluss an den erneuten Aufruf der Sache zur Aufzeichnung auf den Tonträger diktiert worden. Die Verkündung des Versäumnisurteils ist damit, was das OLG Schleswig zu Recht seiner Entscheidung zugrunde legt, durch mündliche Mitteilung der Urteilsformel erfolgt und gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 7 ZPO in dem Protokoll festgestellt.
Der Wirksamkeit des Versäumnisurteils steht auch nicht entgegen, dass zum Zeitpunkt der Verkündung die mündliche Verhandlung bereits geschlossen war und es gemäß § 310 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 ZPO eines gesonderten Termins zur Verkündung eines nach § 310 Abs. 2 ZPO vollständig abgefassten Urteils bedurft hätte5. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stehen Verkündungsmängel dem wirksamen Erlass eines Urteils nur entgegen, wenn gegen elementare, zum Wesen der Verlautbarung gehörende Formerfordernisse verstoßen wurde, so dass von einer Verlautbarung im Rechtssinne nicht mehr gesprochen werden kann. Sind deren Mindestanforderungen hingegen gewahrt, hindern auch Verstöße gegen zwingende Formerfordernisse das Entstehen eines wirksamen Urteils nicht. Zu den Mindestanforderungen gehört, dass die Verlautbarung von dem Gericht beabsichtigt war oder von den Parteien derart verstanden werden durfte und die Parteien von Erlass und Inhalt der Entscheidung förmlich unterrichtet wurden6.
Diese Mindestanforderungen sind hier eingehalten. Mit dem Wesen der Verlautbarung nicht unvereinbar ist nämlich sowohl ein Verstoß bei der ordnungsgemäßen Bekanntgabe des Verkündungstermins an die Parteien7 als auch die Verletzung der Vorschrift des § 310 Abs. 2 ZPO8.
Rechtsfehlerfrei geht das OLG Schleswig weiter davon aus, dass die Sitzungsniederschrift zugleich das vollständige gemäß § 317 Abs. 1 Satz 1 ZPO zuzustellende Urteil darstellt. Das ist bei einem Versäumnisurteil, bei dem es gemäß § 313b Abs. 1 Satz 1 ZPO nicht des Tatbestandes und der Entscheidungsgründe bedarf, der Fall, wenn das Protokoll – wie hier – neben der gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 6 ZPO festzustellenden Entscheidung des Gerichts die nach § 313 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ZPO erforderlichen Angaben enthält und von allen mitwirkenden Richtern unterschrieben ist9.
Zu Recht nimmt das OLG Schleswig ferner an, dass die Einspruchsfrist des § 339 Abs. 1 ZPO am 11.05.2020 begonnen hat.
Nach den getroffenen Feststellungen ist das Versäumnisurteil dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten allerdings unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen.
Ein Mangel der Zustellung ergibt sich allerdings nicht daraus, dass in dem (elektronischen) Empfangsbekenntnis lediglich das Protokoll genannt und das darin enthaltene Versäumnisurteil nicht gesondert aufgeführt worden ist. Es ist nämlich nicht erforderlich, dass das Empfangsbekenntnis den Inhalt des Dokuments aufschlüsselt; die Zustellung ist die Bekanntgabe eines bestimmten Dokuments (§ 166 BGB)10. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das zuzustellende Schriftstück in dem Empfangsbekenntnis (lediglich) so ausreichend zu bezeichnen, dass seine Identität außer Zweifel steht11. Diesen Anforderungen genügt das Empfangsbekenntnis vom 11.05.2020. Denn zweifelsfrei ergibt sich hieraus die Übermittlung des Protokolls vom 04.05.2020, in dem das Versäumnisurteil enthalten ist.
Ein Zustellungsmangel folgt aber daraus, dass dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten entgegen § 317 Abs. 1 Satz 1, § 169 Abs. 2 Satz 1 ZPO lediglich eine einfache Abschrift des Urteils zugestellt worden ist.
Seit dem Inkrafttreten der Neufassung des § 317 Abs. 1 Satz 1 ZPO durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.201312 am 1.07.2014 werden Urteile den Parteien von Amts wegen grundsätzlich in Abschrift zugestellt. Die Zustellung einer Ausfertigung des Urteils nach § 317 Abs. 2 Satz 1 ZPO ist keine Voraussetzung (mehr) für den Beginn der Frist13.
Zutreffend geht das OLG Schleswig davon aus, dass die gemäß § 317 Abs. 1 Satz 1 ZPO zuzustellende Abschrift des Urteils nach § 169 Abs. 2 Satz 1 ZPO von der Geschäftsstelle des Gerichts zu beglaubigen ist. Seit dem Inkrafttreten des Zustellungsreformgesetzes14 am 1.07.2002 ist im Gesetz zwar eine der Vorschrift des § 170 Abs. 1 ZPO aF entsprechende Regelung nicht mehr enthalten, nach der, wenn keine Ausfertigung zugestellt werden sollte, eine beglaubigte Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks zu übergeben war. Der Gesetzgeber geht aber trotz der Streichung des § 170 Abs. 1 ZPO aF weiterhin davon aus, dass Schriftstücke entweder in Urschrift, Ausfertigung oder beglaubigter Abschrift zuzustellen sind15. Entsprechend dem Rechtszustand vor dem Inkrafttreten des Zustellungsreformgesetzes ist die Beglaubigung einer zuzustellenden Abschrift gemäß § 169 Abs. 2 Satz 1 ZPO stets dann ausreichend, aber auch erforderlich, wenn das Gesetz keine andere Regelung enthält16.
Soll die Zustellung – wie hier – als elektronische Abschrift nach § 169 Abs. 4 Satz 1 ZPO bewirkt werden, erfolgt die Beglaubigung gemäß § 169 Abs. 4 Satz 2 ZPO mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Nach den Feststellungen des OLG Schleswigs ist davon auszugehen, dass das dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten übermittelte Schriftstück nicht mit einer solchen Signatur versehen war.
Weiter nimmt das OLG Schleswig zu Recht an, dass der Zustellungsmangel gemäß § 189 ZPO geheilt worden ist. Nach dieser Vorschrift gilt ein Dokument, dessen formgerechte Zustellung sich nicht nachweisen lässt oder das unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen ist, in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem das Dokument der Person, an die die Zustellung dem Gesetz gemäß gerichtet war oder gerichtet werden konnte, tatsächlich zugegangen ist. Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.
Nach den Feststellungen des OLG Schleswigs ist dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten als richtigem Zustellungsadressaten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 ZPO das in dem Protokoll enthaltene Versäumnisurteil tatsächlich zugegangen. Es mangelt auch nicht an dem bei einer Zustellung nach § 174 ZPO erforderlichen Willen, das angebotene Schriftstück als zugestellt entgegenzunehmen17; die Feststellung dieses Willens ist notwendig, weil der Mangel des Empfangswillens bei einer Zustellung gegen Empfangsbekenntnis nicht durch den bloßen Nachweis des tatsächlichen Zugangs im Sinne von § 189 ZPO geheilt werden kann18. Der Empfangswille des Prozessbevollmächtigten der Beklagten steht aufgrund der Übermittlung des elektronischen Empfangsbekenntnisses nach § 174 Abs. 4 Satz 1 ZPO aF (§ 175 Abs. 4 ZPO nF) an das Gericht am 11.05.2020 außer Frage. Dass der Prozessbevollmächtigte der Beklagten nicht erkannt hat, dass es sich bei dem Protokoll zugleich um das Versäumnisurteil handelt, steht dem auf das konkrete Schriftstück bezogenen Annahmewillen nicht entgegen. Das Landgericht hat die Zustellung schließlich auch mit dem für eine Heilung erforderlichen Zustellungswillen bewirken wollen19.
Rechtsfehlerfrei ist schließlich die Annahme, dass § 189 ZPO auch eine von der Geschäftsstelle entgegen § 317 Abs. 1 Satz 1, § 169 Abs. 2 Satz 1 ZPO veranlasste Zustellung einer einfachen statt einer beglaubigten Abschrift eines Urteils erfasst. Dies ist allerdings umstritten.
Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Mangel der unterbliebenen Zustellung einer beglaubigten Abschrift einer Klageschrift durch die von der Geschäftsstelle des Gerichts veranlasste Übermittlung einer einfachen Abschrift dieses Schriftstücks gemäß § 189 ZPO geheilt20. Gleiches gilt, wenn statt einer beglaubigten Abschrift die einfache Abschrift einer Nachweisurkunde im Sinne des § 750 Abs. 2 ZPO zugestellt wird21. Geklärt ist damit, dass die Vorschrift des § 189 ZPO neben Mängeln des Zustellungsvorgangs grundsätzlich auch solche des Zustellungsgegenstandes erfasst. Ob dies auch dann gilt, wenn statt einer beglaubigten lediglich eine einfache Abschrift eines Urteils zugestellt wird, hat der Bundesgerichtshof jedoch offengelassen22.
Überwiegend wird angenommen, dass der in der Übersendung einer einfachen statt einer beglaubigten Abschrift liegende Zustellungsmangel nach § 189 ZPO geheilt werden kann; dabei wird die Zustellung der Abschrift eines Urteils gemäß § 317 Abs. 1 Satz 1 ZPO allerdings nicht gesondert in den Blick genommen23. Nur vereinzelt wird eine Heilungsmöglichkeit bei der Zustellung einer einfachen Urteilsabschrift überhaupt erörtert und unter Verweis auf den Zustellungszweck entweder abgelehnt24 oder angenommen25 beziehungsweise davon abhängig gemacht, dass die Authentizität und Amtlichkeit des Urteils zweifelsfrei sind26.
Richtigerweise wird auch dann, wenn einer Partei entgegen § 317 Abs. 1 Satz 1, § 169 Abs. 2 Satz 1 ZPO statt einer beglaubigten Abschrift lediglich eine einfache Abschrift des Urteils zugestellt wird, der darin liegende Zustellungsmangel nach § 189 ZPO geheilt, wenn keine Zweifel an der Authentizität und Amtlichkeit der Abschrift bestehen. Das ist jedenfalls bei einer Übermittlung der Urteilsabschrift an das besondere elektronische Anwaltspostfach des Rechtsanwaltes der Partei anzunehmen; denn diese ist als sicherer Übermittlungsweg ausgestaltet (vgl. § 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO).
Die Vorschrift des § 189 ZPO ist grundsätzlich weit auszulegen27. Dies beruht auf der Überlegung, förmliche Zustellungsvorschriften nicht zum Selbstzweck erstarren zu lassen, sondern die Zustellung auch dann als bewirkt anzusehen, wenn der Zustellungszweck anderweitig, nämlich durch tatsächlichen Zugang erreicht worden ist. Zweck der Zustellung ist es, dem Adressaten angemessene Gelegenheit zu verschaffen, von einem Schriftstück Kenntnis zu nehmen und den Zeitpunkt der Bekanntgabe zu dokumentieren28. Ist die Gelegenheit zur Kenntnisnahme – wie hier – gewährleistet und steht der tatsächliche Zugang fest, bedarf es besonderer Gründe, die Zustellungswirkung entgegen dem Wortlaut der Regelung in § 189 ZPO nicht eintreten zu lassen29.
Besondere, einer Heilung gemäß § 189 ZPO entgegenstehende Gründe bestehen in der hier zu beurteilenden Konstellation nicht.
Nach dem Gesetzeswortlaut und dem aus den Gesetzesmaterialien ersichtlichen Willen des Gesetzgebers soll die Rechtsfolge des § 189 ZPO bei jeder fehlerhaften Zustellung eintreten können. Ziel der mit dem Zustellungsreformgesetz14 geschaffenen Neuregelung war es, den Anwendungsbereich der Vorschrift – im Unterschied zu der bis dahin geltenden Fassung des § 187 Satz 2 ZPO aF – auszuweiten und auch solche Zustellungen zu erfassen, durch die der Beginn einer Notfrist in Gang gesetzt wird30. Die Heilungsmöglichkeit besteht damit grundsätzlich auch bei der fehlerhaften Zustellung von Urteilen, ohne dass nach der Art des Zustellungsmangels unterschieden wird.
Der Gesetzgeber hat durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs des § 189 ZPO der Rechtssicherheit gegenüber dem Interesse an der Einhaltung der formellen Anforderungen der Zustellung den Vorrang eingeräumt; der Mangel der Zustellung soll nicht zulasten der anderen Partei gehen, wenn der tatsächliche Zugang feststeht31. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei feststehender Kenntnis des Urteils Klarheit über den Ablauf der Notfrist und die formelle Rechtskraft herrscht und sich der Streit der Parteien nicht zu dieser Frage fortsetzt. Diesem Gesichtspunkt kommt bei der Zustellung eines Versäumnisurteils besondere Bedeutung zu. Denn § 339 ZPO enthält keine den Vorschriften der §§ 517, 548 ZPO vergleichbare Regelung, dass die Einspruchsfrist spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung des Urteils beginnt; auch eine analoge Anwendung der entsprechenden Berufungs- und Revisionsregelungen scheidet aus32. Würde eine Heilung nach § 189 ZPO bei Zustellung lediglich einer einfachen Abschrift des Versäumnisurteils grundsätzlich verneint, könnte der Rechtsstreit, wenn der Zustellungsmangel erst spät festgestellt wird, daher noch nach Jahren fortgesetzt werden müssen.
Schließlich steht der Gesichtspunkt der Authentizität und Amtlichkeit des zuzustellenden Schriftstücks einer Heilung nicht entgegen.
Allerdings hat der Bundesgerichtshof erwogen, eine Heilung dann nicht zuzulassen, wenn durch die Zustellung einer Ausfertigung von vornherein jegliche Zweifel an der Authentizität und Amtlichkeit des zugestellten Schriftstücks ausgeschlossen sein sollen33. Dies beruhte auf der vormals besonderen Bedeutung der Urteilsausfertigung insbesondere für den Beginn von Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelfristen. Die gemäß § 317 Abs. 1 Satz 1 ZPO aF erforderliche Zustellung einer Ausfertigung des Urteils konnte nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht durch die Zustellung einer beglaubigten Abschrift des Urteils ersetzt werden. Es kam entscheidend auf die äußere Form und den Inhalt der zur Zustellung verwendeten Ausfertigung an; bei Abweichungen zwischen Urschrift und Ausfertigung war allein die Ausfertigung maßgeblich, weil nur sie nach außen in Erscheinung trat und die Beschwerdepartei ihre Rechte nur anhand der Ausfertigung wahrnehmen konnte und musste34.
Mit der Änderung des § 317 Abs. 1 Satz 1 ZPO durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.201312 hat der Gesetzgeber dagegen die Zustellung einer beglaubigten Abschrift des Urteils als gesetzliche Regelform eingeführt. Eine Ausfertigung des Urteils ist nur noch in den Fällen des § 775 Nr. 1 und 2 ZPO sowie dann erforderlich, wenn aus dem Urteil die Zwangsvollstreckung betrieben werden soll35. Dabei wurde bewusst in Kauf genommen, dass der Abschrift nicht die gleiche Bedeutung wie der Ausfertigung des Urteils zukommt36 und diese das Urteil nicht nach außen im Rechtsverkehr vertritt (vgl. § 47 BeurkG). Dafür, dass der Gesetzgeber einerseits die Anforderungen an die Form des zuzustellenden Urteils herabsetzen, andererseits aber bei fehlender Beglaubigung nach § 169 Abs. 2 Satz 1 ZPO einen nicht heilbaren Zustellungsmangel annehmen wollte, bestehen keine Anhaltspunkte.
Voraussetzung einer Heilung nach § 189 ZPO ist allerdings, dass keine Zweifel an der Authentizität und Amtlichkeit des zuzustellenden Schriftstücks bestehen. Der Zustellungszweck wird nämlich nur dann erreicht, wenn dem Adressaten zuverlässig Kenntnis über den Inhalt des Dokuments und dessen Herkunft vermittelt wird. Dies erfordert es, dass die gerichtliche Entscheidung zweifelsfrei – schon durch ihre äußere Form – als solche zu identifizieren ist37. Deshalb genügt auch die bloße Unterrichtung über den Inhalt des zuzustellenden Dokuments nicht, um eine Heilung herbeizuführen38; weder die bloße mündliche Überlieferung noch eine handschriftliche oder maschinenschriftliche Abschrift des Dokuments führen zur Heilung des Zustellungsmangels39.
Hieran gemessen nimmt das OLG Schleswig zutreffend an, dass für den Prozessbevollmächtigten der Beklagten jedenfalls deshalb keine Zweifel an der Authentizität und Amtlichkeit des Versäumnisurteils bestehen konnten, weil die einfache Abschrift von dem Gericht auf einem sicheren Übermittlungsweg an das besondere elektronische Anwaltspostfach nach § 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO übermittelt worden ist.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 11. Februar 2022 – V ZR 15/21
- LG Itzehoe, Urteil vom 13.07.2020 – 10 O 184/20[↩]
- OLG Schleswig, Urteil vom 18.12.2020 – 3 U 88/20[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 14.06.1954 – GSZ 3/54, BGHZ 14, 39, 44; BGH, Urteil vom 12.03.2004 – V ZR 37/03, NJW 2004, 2019, 2020; Beschluss vom 21.06.2012 – V ZB 56/12, NJW-RR 2012, 1359 Rn. 14[↩]
- HK-ZPO/Saenger, 9. Aufl., § 311 Rn. 5; Musielak/Voit/Musielak, ZPO, 18. Aufl., § 311 Rn. 3; Stein/Jonas/Althammer, ZPO, 23. Aufl., § 311 Rn. 8[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 06.02.2004 – V ZR 249/03, BGHZ 158, 37, 39 f.; Beschluss vom 21.06.2012 – V ZB 56/12, NJW-RR 2012, 1359 Rn. 12 f.[↩]
- BGH, Urteil vom 12.03.2004 – V ZR 37/03, NJW 2004, 2019, 2020 mwN[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 14.06.1954 – GSZ 3/54, BGHZ 14, 39, 46[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 12.02.2015 – IX ZR 156/14, NJW-RR 2015, 508 Rn. 6; Beschluss vom 02.03.1988 – IVa ZB 2/88, NJW 1988, 2046[↩]
- vgl. OLG Dresden, NJOZ 2021, 1052 Rn. 4; Zöller/Herget, ZPO, 34. Aufl., § 339 Rn. 1[↩]
- vgl. OLG Dresden, NJOZ 2021, 1052 Rn. 7; Zöller/Schultzky, ZPO, 34. Aufl., § 175 Rn. 9[↩]
- BGH, Beschluss vom 12.03.1969 – IV ZB 3/69, NJW 1969, 1297; Urteil vom 18.05.1994 – IV ZR 8/94, VersR 1994, 1495; Beschluss vom 31.05.2000 – XII ZB 211/99, VersR 2001, 606[↩]
- BGBl. I S. 3786[↩][↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 15.02.2018 – V ZR 76/17, NJOZ 2018, 1145 Rn. 4 zu § 544 ZPO[↩]
- BGBl. I 2001, S. 1206[↩][↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 22.12.2015 – VI ZR 79/15, BGHZ 208, 255 Rn. 12; BT-Drs. 14/4554 S. 16[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 22.12.2015 – VI ZR 79/15, aaO Rn. 10[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.09.2011 – XII ZR 168/09, BGHZ 191, 59 Rn. 16 mwN[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 13.01.2015 – VIII ZB 55/14, NJW-RR 2015, 953 Rn. 12 sowie Urteil vom 22.11.1988 – VI ZR 226/87, NJW 1989, 1154 zu § 187 ZPO aF[↩]
- vgl. dazu BGH, Urteil vom 29.03.2017 – VIII ZR 11/16, BGHZ 214, 294 Rn. 35 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 22.12.2015 – VI ZR 79/15, BGHZ 208, 255 Rn. 17 ff.; Urteil vom 13.09.2017 – IV ZR 26/16, NJW 2017, 3721 Rn. 17; Urteil vom 21.02.2019 – III ZR 115/18, NJW 2019, 1374 Rn. 13[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 13.10.2016 – V ZB 174/15, NJW 2017, 411 Rn. 21 ff.; insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 212, 264[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 15.02.2018 – V ZR 76/17, NJOZ 2018, 1145 Rn. 10; ebenso BGH, Beschluss vom 19.06.2019 – IV ZR 224/18, BeckRS 2019, 13264 Rn.20[↩]
- vgl. BeckOK ZPO/Dörndorfer [1.12.2021], § 189 Rn. 6; HK-ZPO/Siebert, 9. Aufl., § 189 Rn. 6; Musielak/Voit/Wittschier, ZPO, 18. Aufl., § 189 Rn. 2; Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 42. Aufl., § 169 Rn. 9 und § 189 Rn. 6; im Ergebnis ebenso: MünchKomm-ZPO/Häublein, 6. Aufl., § 189 Rn. 12; aA weiterhin: Stein/Jonas/Roth, ZPO, 23. Aufl., § 189 Rn. 16; Wieczorek/Schütze/Rohe, ZPO, 4. Aufl., § 189 Rn. 14; Zöller/Schultzky, ZPO, 34. Aufl., § 189 Rn. 9; Böttcher, NJW 2016, 1520; Rohe, WuB 2016, 715, 716[↩]
- vgl. OLG Karlsruhe, NJOZ 2015, 1024 Rn. 45[↩]
- vgl. OLG Braunschweig, BeckRS 2020, 35781 Rn.19; zustimmend: Müller, RDi 2021, 154, 155; so wohl auch: Dötsch, MDR 2016, 694, 695[↩]
- vgl. Anders/Gehle/Hunke, ZPO, 80. Aufl., § 317 Rn. 4c[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 20.04.2018 – V ZR 202/16, NJW-RR 2018, 970 Rn. 26; BGH, Urteil vom 29.03.2017 – VIII ZR 11/16, BGHZ 214, 294 Rn. 38; Urteil vom 12.03.2015 – III ZR 207/14, BGHZ 204, 268 Rn. 17; Urteil vom 27.01.2011 – VII ZR 186/09, BGHZ 188, 128 Rn. 47[↩]
- BGH, Urteil vom 27.01.2011 – VII ZR 186/09, aaO[↩]
- BGH, Urteil vom 22.12.2015 – VI ZR 79/15, BGHZ 208, 255 Rn. 21 f.; Urteil vom 27.01.2011 – VII ZR 186/09, aaO[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 11.07.2005 – NotZ 12/05, NJW 2005, 3216, 3217; BT-Drs. 14/4554 S. 25[↩]
- BT-Drs. 14/4554 S. 25[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 07.07.1959 – VIII ZR 111/58, BGHZ 30, 299, 300; Urteil vom 21.06.1976 – III ZR 22/75, NJW 1976, 1940[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 22.12.2015 – VI ZR 79/15, BGHZ 208, 255 Rn. 22[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 09.06.2010 – XII ZB 132/09, BGHZ 186, 22 Rn. 15[↩]
- BT-Drs. 17/12634 S. 30[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 29.09.1959 – VIII ZB 5/59, NJW 1959, 2117, 2118[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 15.03.2007 – 5 StR 536/06, BGHSt 51, 257 Rn. 14[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 20.04.2018 – V ZR 202/16, NJW-RR 2018, 970 Rn. 30; BGH, Beschluss vom 04.05.2011 – XII ZB 632/10, NJW-RR 2011, 1011 Rn. 11; Urteil vom 15.03.2007 – 5 StR 536/06, aaO[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 12.03.2020 – I ZB 64/19, GRUR 2020, 776 Rn. 25; Beschluss vom 07.10.2020 – XII ZB 167/20, NJW-RR 2021, 193 Rn. 12[↩]
Bildnachweis:
- Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht („Roter Elephant“): Sven Hagge | GFDL GNU Free Documentation License 1.2