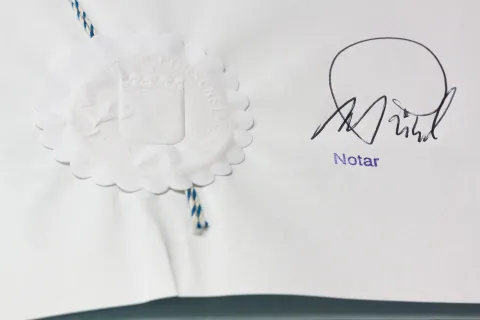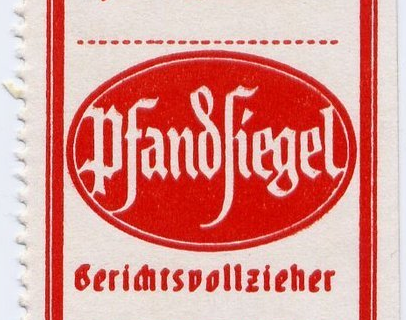Nach §§ 7, 17 Abs. 1 Satz 1 KostO i.V.m. § 141 KostO verjährten Ansprüche auf Zahlung von Notarkosten (Gebühren und Auslagen) in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem das gebührenpflichtige Geschäft beendet war bzw. die Auslagen entstanden sind.

Die Beurkundung des Grundstückskaufvertrages sowie eine damit in Zusammenhang stehende Vertretungsbescheinigung sind mit der Unterschrift des Notars unter die Niederschrift beendet1.
Soweit die Kostenrechnung nicht den gesetzlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Kostenanforderung durch den Notar in § 154 Abs. 2 KostO entspricht, bewirken weder die zwischenzeitliche Zusendung der Kostenrechnung an die Kostenschuldner noch eine von dem Notar gewährte Stundung der Zahlung noch eine Zahlungsaufforderung des Notars einen Neubeginn der Verjährung nach § 17 Abs. 3 Satz 2 KostO2.
Die Vorschrift verlangte u.a. die Bezeichnung der Kostenvorschriften, auf denen die Berechnung beruht (Zitiergebot). Dazu gehören die Bestimmungen, nach denen der Notar den Geschäftswert ermittelt hat; dies gilt selbst dann, wenn der in der Kostenrechnung angesetzte Wert aus der notariellen Urkunde ersichtlich oder nachvollziehbar berechnet ist3. Dem Zitiergebot genügt eine Kostenrechnung nicht, wenn die für die Bemessung des Geschäftswerts maßgebliche Vorschrift des § 20 Abs. 1 KostO in ihr nicht genannt ist.
Der Einwand des Notars, im Zeitpunkt der Erstellung der Kostenrechnung sei es nach der Rechtsprechung des für seinen Amtsbezirk zuständigen Kammergerichts nicht erforderlich gewesen, die für die Bemessung des Geschäftswerts maßgebliche Vorschrift des § 20 Abs. 1 KostO in der Kostenrechnung zu zitieren, führt zu keiner anderen Beurteilung. In der obergerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur wurde nämlich auch die gegenteilige Ansicht vertreten4; eine höchstrichterliche Klärung stand noch aus. Der Notar konnte daher nicht darauf vertrauen, dass eine dem § 154 Abs. 2 KostO entsprechende Kostenrechnung die Angabe der Bestimmung zur Bemessung des Geschäftswerts (§ 20 Abs. 1 KostO) nicht erforderte.
Dass der Notar die Kostenrechnung zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt und zur Begründung des angesetzten Geschäftswerts die Vorschrift des § 20 Abs. 1 KostO zitiert hat, ist unerheblich, wenn in diesem Zeitpunkt der Kostenanspruch bereits verjährt war.
Ähnliches gilt auch für einen Neubeginn der Verjährung gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 2 BGB aufgrund eines Vollstreckungsauftrags des Notars:
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu dem inzwischen außer Kraft getretenen § 17 Abs. 3 Satz 2 KostO trat ein Neubeginn der Verjährung durch die Aufforderung zur Zahlung der Notarkosten oder durch eine von dem Notar dem Kostenschuldner mitgeteilte Stundung nur ein, wenn eine der Vorschrift des § 154 Abs. 2 KostO genügende Kostenrechnung vorlag5. Entsprechendes muss – für das alte Recht – im Rahmen von § 212 BGB gelten. Denn es stellte einen Wertungswiderspruch dar, es dem Notar einerseits zu verwehren, mittels einer Zahlungsaufforderung oder Stundung aufgrund einer den Anforderungen des § 154 Abs. 2 KostO nicht entsprechenden Kostenrechnung den Neubeginn der Verjährung herbeizuführen, ihm jedoch andererseits die Möglichkeit einzuräumen, einen solchen Neubeginn durch die Beantragung und anschließende Durchführung einer Vollstreckungshandlung aufgrund einer solchen Kostenrechnung – versehen mit einer von ihm erteilten Vollstreckungsklausel – zu erreichen6.
Zwar kann auch die vollstreckbare Ausfertigung einer der Vorschrift des § 154 Abs. 2 KostO nicht genügenden Kostenberechnung zur Einziehung des Kostenbetrags im Wege der Zwangsvollstreckung führen, weil im Vollstreckungsverfahren lediglich die formellen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung nach § 155 KostO i.V.m. § 724 Abs. 1, § 750 Abs. 1 ZPO (Titel, Klausel, Zustellung) geprüft werden. Auch tritt der Neubeginn der Verjährung gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 2 BGB unabhängig davon ein, ob die Vollstreckungsmaßnahme zulässig ist7.
Der erneute Beginn der Verjährung gilt aber entsprechend § 212 Abs. 2 BGB als nicht eingetreten, wenn in einem Verfahren nach § 156 Abs. 1 KostO festgestellt wird, dass die der Vollstreckung zugrundeliegende Kostenberechnung den Anforderungen des § 154 Abs. 2 KostO nicht genügt. In materieller Hinsicht folgt dies daraus, dass eine solche Kostenberechnung als Grundlage für die Einforderung der Kosten ausscheidet8. Verfahrensrechtlich kommt zum Tragen, dass der Kostenschuldner Einwände gegen die formelle und materielle Rechtmäßigkeit der vollstreckbaren Ausfertigung der Kostenrechnung nicht im Wege der Klauselerinnerung (§ 732 ZPO), der Klauselgegenklage (§ 768 ZPO), der Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO oder der Titelklage analog § 767 ZPO, sondern ausschließlich in dem Verfahren nach § 156 KostO geltend machen kann9. Sein Einwand, eine Vollstreckungshandlung habe die Wirkungen des § 212 Abs. 1 Nr. 2 BGB nicht herbeigeführt, weil sie mangels wirksamen Titels unwirksam war, muss daher in diesem Verfahren geprüft werden. Eine entsprechende Feststellung wirkt dann wie die Aufhebung einer Vollstreckungshandlung wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne von § 212 Abs. 2 BGB.
Da vorliegend die Kostenrechnungen dem Zitiergebot des § 154 Abs. 2 KostO nicht entsprachen und daher keinen wirksamen Vollstreckungstitel darstellten, haben der auf ihrer Grundlage erteilte Vollstreckungsauftrag und die daraus erwachsenen Vollstreckungshandlungen nicht zu einem Neubeginn der Verjährung geführt.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 13. Mai 2015 – V ZB 196/13
- vgl. Lappe in Korintenberg/Lappe/Bengel/Reimann, Kostenordnung, 18. Aufl., § 7 Rn. 5; Assenmacher/Mathias, KostO, 16. Aufl., Stichwort „Fälligkeit“ Nr. 1.2; BeckOK-KostR/Toussaint, Edition 6, § 7 KostO Rn.07.1[↩]
- BGH, Beschluss vom 25.10.2005 – V ZB 121/05, BGHZ 164, 355, 359 f.[↩]
- BGH, Beschluss vom 23.10.2008 – V ZB 89/08, NJW-RR 2009, 228 Rn. 25[↩]
- OLG Düsseldorf, JurBüro 2005, 151, 152; Heinze, NotBZ 2007, 119, 121; Klein, RNotZ 2006, 628 f.; Klein/Schmidt, RNotZ 2006, 340, 341; Lappe, NJW 1995, 1191, 1199[↩]
- BGH, Beschluss vom 25.10.2005 – V ZB 121/05, BGHZ 164, 355, 360; siehe aber zum neuen Recht § 19 Abs. 5 GNotKG[↩]
- im Ergebnis ebenso OLG Hamm, OLGR 2003, 190, 191; OLG Düsseldorf, OLGR 2001, 146, 150; Bengel/Tiedtke in Korintenberg/Lappe/Bengel/Reimann, Kostenordnung, 18. Aufl., § 154a Rn. 14; Rohs/Wedewer, Kostenordnung, Stand Juni 2013, § 155 Rn. 2 und § 156 Rn. 13; Tiedtke, ZNotP 2004, 166, 167; Tiedtke/Heitzer/Strauß, Streifzug durch die Kostenordnung, 9. Aufl., Rn. 744; siehe auch BT-Drs. 17/11471 (neu) S. 158[↩]
- BGH, Urteil vom 29.04.1993 – III ZR 115/91, BGHZ 122, 287, 295; Erman/Schmidt-Räntsch, BGB, 14. Aufl., § 212 Rn. 16[↩]
- BGH, Beschluss vom 25.10.2005 – V ZB 121/05, BGHZ 164, 355, 359[↩]
- OLG Düsseldorf, OLGR 2002, 415 f.; OLG Oldenburg, NJW-RR 1998, 72[↩]