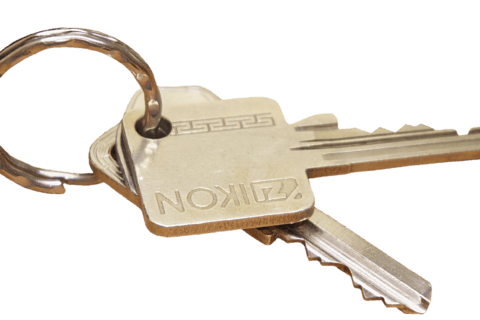Das Bundesverfassungsgericht hat einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen die Preisgestaltung durch ein kommunales Freizeitbad richtete. Der aus Österreich stammende Beschwerdeführer hatte mit seiner Verfassungsbeschwerde vornehmlich eine Benachteiligung gerügt, da er als Besucher des Freizeitbads den regulären Eintrittspreis zu entrichten hatte, während die Einwohner der umliegenden Betreibergemeinden einen verringerten Eintrittspreis bezahlten.

Der Ausgangssachverhalt[↑]
Der Beschwerdeführer ist österreichischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Österreich. Bei einem Besuch eines von mehreren Gemeinden und einem Landkreis betriebenen Freizeitbades im Bertechsgadener Land musste er den regulären Eintrittspreis entrichten, während den Einwohnern dieser Gemeinden ein Nachlass auf den regulären Eintrittspreis von etwa einem Drittel gewährt wurde. Der Beschwerdeführer erhob Klage zum Amtsgericht und forderte wegen unzulässiger Benachteiligung die Rückzahlung des Differenzbetrags und die Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet sei, dem Kläger den Eintritt künftig zu dem ermäßigten Entgelt zu gewähren. Das Amtsgericht Laufen wies die Klage ab1; die gegen das Urteil eingelegte Berufung war vor dem Oberlandesgericht München ebenfalls erfolglos2.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts[↑]
Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) und eine Verletzung seines Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) durch Unterlassung einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union.
Das Bundesverfassungsgericht nahm die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an, stellte eine Verletzung des österreichischen Schwimmbadbesuchers in seinen verfassungsmäßigen Rechten aus Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 GG fest, hob die zivilgerichtlichen Urteile auf und verwies die Sache zurück an das Amtsgericht Laufen:
Gleichbehandlungsgebot[↑]
Die Urteile des Amtsgerichts Laufen und des Oberlandesgerichts München verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG.
Die fachgerichtliche Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts kann grundsätzlich nur daraufhin geprüft werden, ob sie willkürlich ist oder auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts beruht oder mit anderen verfassungsrechtlichen Vorschriften unvereinbar ist3. Mit Blick auf das in Art. 3 Abs. 1 GG niedergelegte Willkürverbot prüft das Bundesverfassungsgericht, ob die Anwendung der einschlägigen einfachrechtlichen Bestimmungen und das dazu eingeschlagene Verfahren durch das Fachgericht vertretbar sind oder ob sich der Schluss aufdrängt, dass seine Entscheidung auf sachfremden und damit willkürlichen Erwägungen beruht4. Fehlerhafte Rechtsanwendung allein macht eine Gerichtsentscheidung nicht willkürlich. Schlechterdings unhaltbar ist eine fachgerichtliche Entscheidung vielmehr erst dann, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt, der Inhalt einer Norm in krasser Weise missverstanden oder sonst in nicht mehr nachvollziehbarer Weise angewendet wird5.
Die Annahme der Fachgerichte, die Grundrechte des Beschwerdeführers seien vorliegend nicht anwendbar oder jedenfalls nicht verletzt, lässt sich unter keinem Blickwinkel nachvollziehen. Die Beklagte ist gegenüber dem Beschwerdeführer unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Verstößt die Beklagte durch den Vertragsschluss gegen Grundrechte, ist der Vertrag daher – gegebenenfalls teilweise – nichtig. Nach den bisherigen Feststellungen der Fachgerichte verletzt die differenzierende Preisgestaltung den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG.
In privatrechtlichen Organisationsformen geführte Unternehmen, die vollständig im Eigentum des Staates stehen (öffentliche Unternehmen)F, sind unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Für eine bloß mittelbare Berücksichtigung der Grundrechte im Verhältnis öffentlicher Unternehmen zu Grundrechtsberechtigten im Privatrechtsverkehr ist daher kein Raum.
Abs. 3 GG ordnet die umfassende Grundrechtsbindung aller staatlichen Gewalt an. Die Grundrechte gelten nicht nur für bestimmte Bereiche, Funktionen oder Handlungsformen staatlicher Aufgabenwahrnehmung, sondern binden die staatliche Gewalt umfassend und insgesamt6. Der Staat und andere Träger öffentlicher Gewalt können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zwar auch am Privatrechtsverkehr teilnehmen. Sie handeln dabei jedoch stets in Wahrnehmung ihres dem Gemeinwohl verpflichteten Auftrags7. Ihre unmittelbare Bindung an die Grundrechte hängt daher weder von der Organisationsform ab, in der sie dem Bürger gegenübertreten, noch von der Handlungsform.
Die Wahl der Organisationsform hat keine Auswirkungen auf die Grundrechtsbindung des Staates oder anderer Träger öffentlicher Gewalt. Das gilt nicht nur dann, wenn sie ihre Aufgaben unmittelbar selbst oder mittelbar durch juristische Personen des öffentlichen Rechts erfüllen, sondern auch dann, wenn sie auf privatrechtliche Organisationsformen zurückgreifen. Das gilt auch für gemischt-wirtschaftliche Unternehmen des Privatrechts, solange sie diese beherrschen8. In diesen Fällen trifft die Grundrechtsbindung nicht nur die dahinterstehende Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern auch unmittelbar die juristische Person des Privatrechts selbst9.
Vor diesem Hintergrund können sich der Staat und andere Träger öffentlicher Gewalt grundsätzlich selbst nicht auf die Grundrechte berufen10. Auch juristische Personen des Privatrechts, die im Alleineigentum des Staates stehen oder von diesem beherrscht werden, sind grundsätzlich nicht grundrechtsberechtigt11.
Die Grundrechtsbindung der öffentlichen Gewalt gilt auch unabhängig von den gewählten Handlungsformen und den Zwecken, zu denen sie tätig wird. Sobald der Staat oder andere Träger öffentlicher Gewalt eine Aufgabe an sich ziehen, sind sie bei deren Wahrnehmung an die Grundrechte gebunden. Dies gilt auch, wenn sie insoweit auf das Zivilrecht zurückgreifen. Eine Flucht aus der Grundrechtsbindung in das Privatrecht mit der Folge, dass der Staat unter Freistellung von Art. 1 Abs. 3 GG als Privatrechtssubjekt zu begreifen wäre, ist ihm verstellt12.
Unerheblich ist auch, ob die für den Staat oder andere Träger öffentlicher Gewalt handelnde Einheit „spezifische“ Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, ob sie erwerbswirtschaftlich oder zur reinen Bedarfsdeckung tätig wird („fiskalisches“ Handeln) und welchen sonstigen Zweck sie verfolgt. Der Vorstellung, die Grundrechtsbindung sei von der Natur des verfolgten Zwecks abhängig13, liegt eine Dichotomie zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht zugrunde, die mit der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung für eine umfassende Grundrechtsbindung aller staatlichen Gewalt (Art. 1 Abs. 3 GG) nicht vereinbar ist. Diese Bindung steht nicht unter einem Nützlichkeits- oder Funktionsvorbehalt12. Sie macht die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand nicht unmöglich, verwehrt ihr jedoch, sich auf die allein dem Einzelnen zustehende Berechtigung zu gewillkürter Freiheit zu berufen14.
Für die in der Zivilrechtsprechung, vereinzelt auch in der Verwaltungsrechtsprechung15 früher verbreitete Auffassung, wonach die in privatrechtlichen Handlungsformen jenseits des sogenannten Verwaltungsprivatrechts „fiskalisch“ tätig werdende öffentliche Hand grundsätzlich keiner Grundrechtsbindung unterliege16, ist daher kein Raum17.
Im Übrigen waren öffentliche Unternehmen auch nach dieser Auffassung zumindest an das in Art. 3 Abs. 1 GG niedergelegte Willkürverbot gebunden, sodass Ungleichbehandlungen auch durch sachgerechte Gründe gerechtfertigt sein mussten18.
Verletzt die in privatrechtlichen Formen agierende öffentliche Hand Grundrechte eines am Rechtsgeschäft beteiligten Grundrechtsträgers, ist das Rechtsgeschäft grundsätzlich nichtig19.
Vor diesem Hintergrund besteht an der unmittelbaren und uneingeschränkten Bindung der Beklagten des Ausgangsverfahrens an die Grundrechte kein Zweifel. Sie ist ein öffentliches Unternehmen, dessen einziger Gesellschafter eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, die sich ihrerseits auf einen Landkreis und fünf Gemeinden stützt.
Die Annahme des Amtsgerichts, die Grundrechte hätten für den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Anspruch allenfalls mittelbare Bedeutung, verkennt daher Bedeutung und Tragweite von Art. 1 Abs. 3 und Art. 3 Abs. 1 GG. Zwar thematisiert das Amtsgericht eine etwaige Ausstrahlungswirkung der Grundrechte über die Generalklauseln des Zivilrechts; es verkennt damit jedoch bereits vom Ansatz her die unmittelbare Grundrechtsbindung der Beklagten. Soweit es darüber hinaus davon ausgeht, dass die Beklagte nicht im Bereich der „Daseinsvorsorge“ tätig werde und deshalb keinem Kontrahierungszwang zu gleichen Preisen unterliege, verkennt es, dass die Grundrechtsbindung nicht davon abhängt, wie die staatliche Betätigung verwaltungsrechtlich einzuordnen ist oder welchen Zwecken sie dient.
Das Oberlandesgericht hingegen zieht die Möglichkeit der unmittelbaren Grundrechtsbindung mit Blick auf den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Zahlungsanspruch überhaupt nicht in Betracht. Das Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG erwähnt es ausschließlich mit Blick auf den Feststellungsanspruch. Das ist schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar.
Es ist auch nicht zu erkennen, dass die Auffassung der Fachgerichte im Ergebnis hinzunehmen sein könnte, weil die in Rede stehende Ungleichbehandlung gerechtfertigt wäre. Rechtfertigende Sachgründe, die das Oberlandesgericht behauptet, aber nicht offenlegt, sind nicht ersichtlich.
Zwar ist es Gemeinden nicht von vornherein verwehrt, ihre Einwohner bevorzugt zu behandeln. Die darin liegende Ungleichbehandlung muss sich jedoch am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG messen lassen und daher durch Sachgründe gerechtfertigt sein.
In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist geklärt, dass der Wohnsitz allein kein eine Bevorzugung legitimierender Grund ist20. Die bloße Nichtzugehörigkeit zu einer Gemeinde berechtigt diese daher nicht, Auswärtige zu benachteiligen. Jedoch ist nicht ausgeschlossen, eine Ungleichbehandlung an Sachgründe zu knüpfen, die mit dem Wohnort untrennbar zusammenhängen. Ein solches legitimes Ziel kann etwa die Versorgung mit wohnortnahen Bildungsangeboten21, die Verursachung eines höheren Aufwands durch Auswärtige22, die Konzentration von Haushaltsmitteln auf die Aufgabenerfüllung gegenüber den Gemeindeeinwohnern23 oder ein Lenkungszweck sein, der vor der Verfassung Bestand hat24. Im kommunalen Bereich bedürfen nichtsteuerliche Abgaben zur Wahrung des Grundsatzes der Belastungsgleichheit, der aus der abgabenrechtlichen Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes folgt und die durch die kommunale Selbstverwaltungsgarantie gewährleistete Finanzhoheit der Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) begrenzt, einer über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden besonderen sachlichen Rechtfertigung25. Als solche sind neben der Kostendeckung auch Zwecke des Vorteilsausgleichs, der Verhaltenslenkung sowie soziale Zwecke anerkannt26.
Verfolgt eine Gemeinde durch die Privilegierung Einheimischer das Ziel, knappe Ressourcen auf den eigenen Aufgabenbereich (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) zu beschränken, Gemeindeangehörigen einen Ausgleich für besondere Belastungen zu gewähren oder Auswärtige für einen erhöhten Aufwand in Anspruch zu nehmen, oder sollen die kulturellen und sozialen Belange der örtlichen Gemeinschaft dadurch gefördert und der kommunale Zusammenhalt dadurch gestärkt werden, dass Einheimischen besondere Vorteile gewährt werden, kann dies mit Art. 3 Abs. 1 GG daher vereinbar sein.
Es ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte vorliegend solche legitimen Ziele, die eine Bevorzugung Einheimischer rechtfertigen könnten, tatsächlich verfolgt.
Das Vermarktungskonzept der Beklagten ist darauf angelegt, auswärtige Besucher anzuziehen. Satzungsmäßige Aufgabe des Alleingesellschafters der Beklagten ist die Förderung des Fremdenverkehrs (§ 3 Abs. 1 der Satzung), wozu insbesondere die Unterhaltung entsprechender Einrichtungen gehört (§ 3 Abs. 2 Buchstabe b der Satzung). Zu diesem Zweck wurde die Beklagte gegründet. Diese hat im vorliegenden Verfahren vorgetragen, sie sei mittels eines umfassenden Dienstleistungsangebots auf Gewinnerzielung und die Förderung des Tourismus ausgerichtet. Mit den erzielten Gewinnen bestreite sie den Pachtzins, die der Zweckverband an den Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich das Bad befindet, zahle.
Mit diesem Modell bezweckt die Beklagte gerade nicht, das kulturelle und soziale Wohl der Einwohner zu fördern, die örtliche Gemeinschaft zu stärken, den Nutzerkreis zu beschränken oder durch Verhaltenssteuerung die Auslastung des Bades zu gewährleisten. Das Bad ist im Gegenteil auf Überregionalität angelegt und soll, wie die Beklagte im vorliegenden Verfahren dargelegt hat, Auswärtige ansprechen und gerade nicht kommunale Aufgaben im engeren Sinne erfüllen. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Einwohner der die Beklagte tragenden Gebietskörperschaften einen Ausgleich für finanzielle oder andere Belastungen erhalten sollen, zumal der größte Teil der Einwohner des Landkreises – Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden, die nicht selbst Mitglieder des Zweckverbands sind – nicht zum privilegierten Nutzerkreis gehört. Daher ist weder ersichtlich, dass die Privilegierung einem solchen Ausgleich dient, noch wurde festgestellt, dass das Bad mit Haushaltsmitteln errichtet oder betrieben wurde. Vorbehaltlich weiterer Feststellungen, die die Fachgerichte zu treffen haben werden, liegen die Preisdifferenzierung rechtfertigende Gründe nicht vor.
Das Urteil des Oberlandesgerichts verletzt Art. 3 Abs. 1 GG in dessen Ausprägung als Willkürverbot ferner dadurch, dass es Art. 49 EGV (Art. 56 AEUV) mit Blick auf das darin enthaltene Diskriminierungsverbot nicht als Verbotsgesetz im Sinne des § 134 BGB ansieht. Diese Annahme lässt sich unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt begründen.
Zwar entspricht der Ausgangspunkt des Oberlandesgerichts, Verstöße gegen Verbotsnormen, die sich nur an einen von mehreren Vertragsteilen richten, führten in der Regel nicht zur Nichtigkeit des Geschäfts, der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs27. Nicht mehr nachvollziehbar ist indes die darauf aufbauende Erwägung des Oberlandesgerichts, ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot könne nicht zur Nichtigkeit des Geschäfts führen, weil sich dieses Verbot nur an den Diskriminierenden richte, nicht aber an den Diskriminierten. Diese Handhabung verkehrt nicht nur Sinn und Zweck des § 134 BGB in ihr Gegenteil, sondern ist auch mit Art. 49 EGV (Art. 56 AEUV) nicht zu vereinbaren, da sie den mit diesen Bestimmungen bezweckten Schutz des Betroffenen dadurch konterkariert, dass sie die Ungleichbehandlung und damit die den freien Dienstleistungsverkehr beschränkende Wirkung des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz perpetuiert.
Gälte die dargestellte Regel auch dann, wenn das Verbot, das sich nur an die eine Vertragspartei richtet, gerade dem Schutz der anderen Vertragspartei dient, führte die Annahme der Wirksamkeit des Geschäfts dazu, dass der Schutzzweck der Verbotsnorm in sein Gegenteil verkehrt würde, wenn nur die – gegebenenfalls teilweise – Nichtigkeit des Geschäfts den bezweckten Schutz verwirklichen kann. Zur Vermeidung dieser Konsequenz entspricht es ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass auch Verstöße gegen nur einseitige Verbote als Ausnahme von der eingangs dargestellten Regel dann zur Nichtigkeit des Geschäfts führen, wenn es mit dem Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes unvereinbar wäre, die durch das Rechtsgeschäft getroffene rechtliche Regelung hinzunehmen und bestehen zu lassen28. Auch in der Literatur entspricht es einhelliger Auffassung, dass der Verstoß gegen ein Verbotsgesetz dann zur Nichtigkeit des Geschäfts führt, wenn diese Rechtsfolge ein Gebot der Auslegung der Verbotsnorm ist29. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind daher auch Vorschriften des unionalen Primärrechts, die sich nur an eine Partei des Rechtsgeschäfts richten, zu dessen Nichtigkeit führende Verbotsgesetze, wenn deren Zweck nicht anders erreicht werden kann30.
Dass das Oberlandesgericht eine Anwendbarkeit von Art. 49 EGV (Art. 56 AEUV) insoweit verneint, ist vor diesem Hintergrund schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar.
Die nach den dargestellten Grundsätzen erforderliche Auslegung dieser Bestimmung ergibt, im Gegenteil, dass die Wirksamkeit des zwischen dem Beschwerdeführer und der Beklagten geschlossenen Vertrags insoweit mit der Garantie aus Art. 49 EGV (Art. 56 AEUV) unvereinbar ist, als der Beschwerdeführer im Vergleich zu Einheimischen, die in den Genuss des Preisnachlasses kommen, schlechter behandelt wird. Art. 49 EGV (Art. 56 AEUV) dient der Erleichterung der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung. Erbringer und Empfänger von Dienstleistungen sollen nicht dadurch von der Leistung der Dienste und ihrer Entgegennahme abgehalten werden, dass für sie aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit ungünstigere Konditionen gelten als bei rein nationalen Sachverhalten. Die Bestimmung gewährt insoweit ein unmittelbar anwendbares subjektives Recht. Bliebe die Wirksamkeit des Geschäfts im in Rede stehenden Umfang vom Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot unberührt, dauerte die Wirkung der Diskriminierung fort, sodass das Verbot insoweit wirkungslos wäre.
Die Annahme des Oberlandesgerichts, das Unionsrecht sehe im vorliegenden Zusammenhang keine Sanktion vor, ist auch deshalb nicht nachvollziehbar, weil es ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union entspricht, dass der Gleichheitssatz, solange keine Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gleichbehandlung erlassen worden sind, nur dadurch gewahrt werden kann, dass die Vergünstigungen, die die Mitglieder der begünstigten Gruppe erhalten, auf die Mitglieder der benachteiligten Gruppe erstreckt werden31.
Ein eigenständiger Verstoß gegen das Willkürverbot liegt schließlich in der Annahme des Oberlandesgerichts, es sei „keine Frage der Auslegung des EG-Vertrages, sondern …. die Frage der Anwendung auf den vorliegenden konkreten Einzelfall, die allein Aufgabe des innerstaatlichen Gerichts ist“, ob der Beschwerdeführer einen unionsrechtlichen Anspruch auf eine diskriminierungsfreie Preisgestaltung durch die Beklagte habe. Diese Erwägung ist nicht nur in sich widersprüchlich, sie ist auch nicht geeignet, den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Anspruch abzuweisen.
Vorlagepflicht an den EuGH[↑]
Schließlich verletzt das Urteil des Oberlandesgerichts den Beschwerdeführer auch in seinem Recht aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG.
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG32. Unter den Voraussetzungen des Art. 267 Abs. 3 AEUV sind die nationalen Gerichte daher von Amts wegen gehalten, den Gerichtshof anzurufen. Kommt ein deutsches Gericht seiner Pflicht zur Anrufung des Gerichtshofs im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens daher nicht nach, kann dem Rechtsschutzsuchenden des Ausgangsrechtsstreits der gesetzliche Richter entzogen sein33.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union34 muss ein nationales letztinstanzliches Gericht seiner Vorlagepflicht nachkommen, wenn sich in einem bei ihm schwebenden Verfahren eine Frage des Unionsrechts stellt, es sei denn, das Gericht hat festgestellt, dass die gestellte Frage nicht entscheidungserheblich ist, dass die betreffende unionsrechtliche Bestimmung bereits Gegenstand einer Auslegung durch den Gerichtshof war oder dass die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt35.
Ein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG setzt aber voraus, dass die Auslegung und Anwendung der Zuständigkeitsregel des Art. 267 Abs. 3 AEUV bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist36.
Die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV wird unter anderem in den Fällen offensichtlich unhaltbar gehandhabt, in denen ein letztinstanzliches Hauptsachegericht eine Vorlage trotz der – seiner Auffassung nach bestehenden – Entscheidungserheblichkeit einer unionsrechtlichen Frage überhaupt nicht in Erwägung zieht, obwohl es selbst Zweifel hinsichtlich der richtigen Beantwortung der Frage hegt und das Unionsrecht somit eigenständig fortbildet37.
Dies gilt erst recht, wenn sich das Gericht hinsichtlich des (materiellen) Unionsrechts nicht hinreichend kundig macht. Es verkennt dann regelmäßig die Bedingungen für die Vorlagepflicht38. Gleiches gilt, wenn es offenkundig einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht auswertet. Um eine Kontrolle am Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG zu ermöglichen, hat es die Gründe für seine Entscheidung über die Vorlagepflicht anzugeben39.
Danach hat das Oberlandesgericht vorliegend seine Vorlagepflicht offensichtlich unhaltbar gehandhabt, weil es sich hinsichtlich des materiellen Unionsrechts nicht hinreichend kundig gemacht hat.
Dies gilt zunächst für den Umgang des Oberlandesgerichts mit der Frage, ob die Beklagte als öffentliches Unternehmen unmittelbar an die Grundfreiheiten gebunden ist. Angesichts der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Bindungswirkung des Diskriminierungsverbots und der Grundfreiheiten für vom Staat beherrschte Unternehmen40 und mit Blick auf Art. 106 AEUV (Art. 86 EGV; vgl. Wernicke, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Bd. 2, Art. 106 AEUV Rn. 8, Jan.2016) liegt die Annahme einer unmittelbaren Bindung der Beklagten an die in Rede stehenden Vorgaben des Unionsrechts nahe.
Dies gilt ferner für die Frage, ob die Preisgestaltung der Beklagten gegen Art. 56 AEUV (Art. 49 EGV) verstoße. Zu Entgeltsystemen für die Nutzung kultureller Einrichtungen, die Gemeindeeinwohner bevorzugen, hat der Gerichtshof der Europäischen Union festgestellt, dass wirtschaftliche Ziele die darin liegende Beschränkung der Grundfreiheiten nicht rechtfertigen könnten und dass auch steuerrechtliche Gründe nur dann anzuerkennen seien, wenn ein spezifischer Zusammenhang zwischen der Besteuerung und den Tarifvorteilen bestehe41.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 19. Juli 2016 – 2 BvR 470/08
- AG Laufen, Urteil vom 06.02.2007 – 2 C 0116/06[↩]
- OLG München, Urteil vom 16.01.2008 – 3 U 1990/07[↩]
- vgl. BVerfGE 1, 418, 420; 18, 441, 450; 94, 315, 328; 111, 307, 328; 128, 193, 209; stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 80, 48, 51; 108, 129, 137, 142 f.; 109, 13, 33; 109, 38, 59; BVerfGK 2, 82, 85; 2, 165, 173; 6, 334, 342; BVerfG, Beschluss vom 19.11.2015 – 2 BvR 2088/15 22[↩]
- vgl. BVerfGE 89, 1, 13 f.; 96, 189, 203; BVerfG, Beschluss vom 19.11.2015 – 2 BvR 2088/15 22[↩]
- BVerfGE 128, 226, 244[↩]
- vgl. BVerfGE 128, 226, 244 f.[↩]
- vgl. BVerfGE 128, 226, 246 f.[↩]
- vgl. BVerfGE 128, 226, 245[↩]
- vgl. BVerfGE 21, 362, 370; 61, 82, 100 ff.; 68, 193, 205 ff.; 75, 192, 200[↩]
- vgl. BVerfGE 56, 54, 79 f.; 128, 226, 245 ff.; BVerfG, Beschluss vom 16.05.1989 – 1 BvR 705/88 2 ff.; Beschluss vom 18.05.2009 – 1 BvR 1731/05 16 f.[↩]
- BVerfGE 128, 226, 245[↩][↩]
- vgl. Dürig/Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, 73. Ergänzungslieferung 2014, Art. 3 Abs. 1 GG Rn. 475 ff.[↩]
- vgl. BVerfGE 128, 226, 247 ff.[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 10.10.2012 – 7 C 8/10 31 ff.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 02.12 2003 – XI ZR 397/02 12; vgl. auch BGHZ 36, 91, 93 f.; BGH, Urteil vom 24.10.2003 – V ZR 424/02 18 ff.; Urteil vom 14.12 1976 – VI ZR 251/73 33 f.[↩]
- vgl. nun BGH, Urteil vom 26.06.2015 – V ZR 227/14 9[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 02.12 2003 – XI ZR 397/02 9, 12 f.[↩]
- vgl. BGHZ 65, 284, 287; 154, 146, 149; BGH, Urteil vom 02.12 2003 – XI ZR 397/02 9; siehe auch BGH, Urteil vom 18.09.2009 – V ZR 2/09 8 f.; BGH, Urteil vom 06.11.2009 – V ZR 63/09 15; Armbrüster, in: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl.2015, § 134 Rn. 33; Sack/Seibl, in: Staudinger, BGB, Buch 1, Neubearbeitung 2011, § 134 Rn. 37; Arnold, in: Erman, BGB, 14. Aufl.2014, § 134 Rn. 10; Looschelders, in: Heidel/Hüßtege/Mansel/Noack, BGB, 2. Aufl.2011, § 134 Rn. 33[↩]
- vgl. BVerfGE 33, 303, 355; 65, 325, 355; 134, 1, 21 Rn. 60[↩]
- vgl. BVerfGE 33, 303, 355 f.[↩]
- vgl. BVerfGE 65, 325, 355 f.; 134, 1, 22 f. Rn. 64[↩]
- vgl. BVerfGE 112, 74, 87 f.[↩]
- vgl. BVerfGE 134, 1, 23 Rn. 65[↩]
- vgl. BVerfGE 137, 1, 20 Rn. 49 m.w.N.[↩]
- BVerfGE 133, 1, 20 Rn. 49 m.w.N.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 13.10.2009 – KZR 34/06 12; Urteil vom 30.04.1992 – III ZR 151/91 15[↩]
- BGHZ 37, 258, 262; 46, 24, 26; 53, 152, 157; 65, 368, 370; 71, 358, 360 f.; 78, 263, 265; 115, 123, 125; 118, 142, 145; 132, 229, 231 f.; 146, 250, 257 f.; 159, 334, 341 f.; BGH, Urteil vom 12.05.2011 – III ZR 107/10 12; siehe auch BGH, Urteil vom 25.07.2002 – III ZR 113/02 7[↩]
- siehe Armbrüster, a.a.O., § 134 Rn. 49; Arnold, a.a.O., § 134 Rn. 13; Ellenberger, in: Palandt, BGB, 75. Aufl.2016, § 134 Rn. 6; Hefermehl, in: Soergel, BGB, 13. Aufl.1999, § 134 Rn. 14; Looschelders, a.a.O., § 134 Rn. 56 f.; Sack/Seibl, a.a.O., § 134 Rn. 57 ff.[↩]
- zu Art. 88 Abs. 3 EGV, Art. 108 Abs. 3 AEUV vgl. BGH, Urteil vom 04.04.2003 – V ZR 314/02 12[↩]
- EuGH, Urteil vom 04.12 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging, 71/85, Slg. 1986, S. 3870, 3876; Urteil vom 21.06.2007, Jonkman, – C-231/06 bis 233/06, Slg. 2007, S. I-5172, I-5185, m.w.N.[↩]
- vgl. BVerfGE 73, 339, 366; 135, 155, 230 Rn. 177; stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 73, 339, 369; 135, 155, 230 f. Rn. 177; stRspr[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.1982, Rs. – C-283/81, C.I.L.F.I.T., Slg. 1982, S. 3415, 3430 f.[↩]
- vgl. auch BVerfGE 82, 159, 193; 135, 155, 231 Rn. 178; stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 126, 286, 315 f.; 135, 155, 232 Rn. 180; stRspr[↩]
- grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht; vgl. BVerfGE 82, 159, 195 f.; 126, 286, 316 f.; 128, 157, 187 f.; 129, 78, 106 f.; 135, 155, 232 Rn. 181[↩]
- vgl. BVerfGK 8, 401, 405; 11, 189, 199; 13, 303, 308; 17, 108, 111; BVerfG, Beschluss vom 10.12 2014 – 2 BvR 1549/07 21[↩]
- BVerfG, Beschluss vom 10.12 2014, a.a.O., Rn. 21[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 30.04.1974, Sacchi, 155/73, Slg. 1974, S. 411, 430; Urteil vom 06.07.1982, Transparenzrichtlinie, 188/80 bis 190/80, Slg. 1982, S. 2545, 2575, 2579; Urteil vom 18.06.1991, ERT, – C-260/89, Slg. 1991, S. I-2951, I-2957, I-2959 f.; Angonese, a.a.O., Rn. 30 ff.[↩]
- EuGH, Dogenpalast, a.a.O., Rn. 22 ff.[↩]