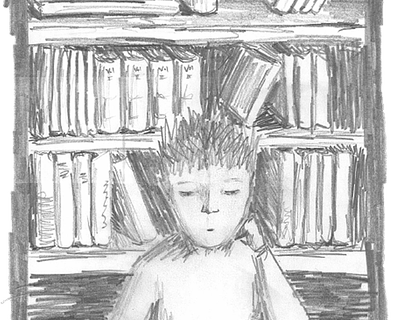Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts sind Sache der Fachgerichte; das Bundesverfassungsgericht beanstandet nur die Verletzung von Verfassungsrecht. Die Schwelle eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korrigieren hat, ist erst erreicht, wenn die Auslegung oder Anwendung des Rechts durch die Fachgerichte Fehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung des Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbereichs, beruhen und auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten Rechtsfall von einigem Gewicht sind1.

Auf der Grundlage des vorliegend anzuwendenden § 86b Abs. 2 Satz 2 SGG haben die Gerichte im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zu prüfen, ob dem Antragsteller ein Abwarten bis zur Hauptsacheentscheidung zuzumuten ist, oder ob eine vorläufige Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile im Einzelfall notwendig ist. Dabei ist zu berücksichtigen, ob der Antragsteller die Zeit bis zur Entscheidung in der Hauptsache mit eigenen Mitteln – oder mit zumutbarer Hilfe Dritter – überbrücken kann2.
Vor diesem Hintergrund greift die Argumentation des Beschwerdeführers, er selbst verfüge als Minderjähriger über keinerlei Vermögen, zu kurz. Es ist weder hinreichend substantiiert vorgetragen noch ist ersichtlich, inwieweit die Berücksichtigung auch des Vermögens der nach § 1601 BGB unterhaltspflichtigen Eltern durch die Sozialgerichte im Rahmen des Eilverfahrens verfassungsrechtlich zu beanstanden wäre und die Eltern die Kosten in Höhe von 243, 88 Euro nicht vorzuleisten in der Lage wären.
Der Beschwerdeführer wird daher durch die sozialgerichtliche Entscheidung nicht in seinen Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip sowie Art. 2 Abs. 2 GG verletzt.
Der Beschwerdeführer ist vorliegend auch nicht in seinem Grundrecht aus Art.19 Abs. 4 GG verletzt.
Bereits der Vorwurf des Beschwerdeführers, der Prüfungsmaßstab des Landessozialgerichts sei nicht erkennbar, trifft nicht zu, da das Gericht im Rahmen der Prüfung des Anordnungsanspruchs ausdrücklich auf eine im einstweiligen Rechtsschutz grundsätzlich gebotene summarische Prüfung abgestellt hat. Im Übrigen verkennt der Beschwerdeführer auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art.19 Abs. 4 GG an die Prüfung eines Anspruchs im Eilverfahren.
Abs. 4 GG stellt besondere Anforderungen an die Ausgestaltung des Eilverfahrens, wenn ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare Beeinträchtigungen entstehen können, die durch das Hauptsacheverfahren nicht mehr beseitigt werden können3. Dann sind die Gerichte verpflichtet, die Sach- und Rechtslage nicht nur summarisch zu prüfen, sondern abschließend, wenn sie sich an den Erfolgsaussichten der Hauptsache orientieren wollen4. Ist die abschließende Prüfung nicht möglich, ist eine Folgenabwägung durchzuführen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass in den Fällen, in denen ohne die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes weniger schwere Beeinträchtigungen zu erwarten sind, die summarische Prüfung eines Anordnungsanspruchs, also des Erfolgs in der Hauptsache, verfassungsrechtlich zulässig ist.
Sozialgericht und Landessozialgericht sind im Ergebnis nicht davon ausgegangen, dass ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare Beeinträchtigungen für den Beschwerdeführer drohen würden; das Landessozialgericht hat folgerichtig eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache bezüglich eines Hilfsmittelanspruchs vorgenommen. Das Sozialgericht hatte – weil es bereits den Anordnungsgrund verneint hatte – ebenso folgerichtig auf die Prüfung eines Anordnungsanspruchs verzichtet.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 27. Juli 2016 – 1 BvR 1241/16
- vgl. BVerfGE 89, 1, 9 f.; 99, 145, 160[↩]
- vgl. LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 17.04.2015 – L 4 AS 137/15 B ER; Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschluss vom 28.03.2011 – L 5 KR 20/11 B ER[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 12.05.2005 – 1 BvR 569/05[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 29.11.2007 – 1 BvR 2496/07; juris[↩]