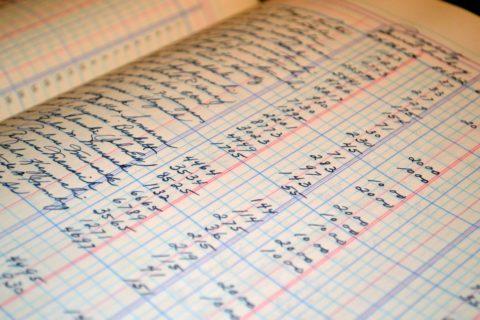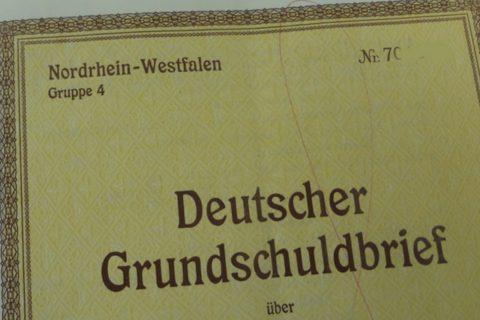Baukostenzuschüsse aufgrund von Art. 52 PflegeVG mindern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Derartige Baukostenzuschüsse für das Altenpflegeheim sind damit – anders als Baukostenzuschüsse im Rahmen des Dritten Förderweges – nicht als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung behandelt, sondern mindern lediglich Herstellungskosten – und damit die Grundlage für die zukünftigen AfA-Abschreibungen – für das Altenpflegeheim.

Zuschüsse sind als Leistungen eines Dritten Einnahmen i.S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, wenn sie das Überlassen des Gebrauchs oder der Nutzung des Grundstücks entgelten sollen. Sie können z.B. bei einer Mietpreisbindung oder einem Belegungsrecht rechtlich und wirtschaftlich mit der Gebrauchs- oder Nutzungsüberlassung unmittelbar zusammenhängen1.
Rechtsgrundlage für die Zuschüsse ist Art. 52 Abs. 1 PflegeVG. Danach werden Finanzhilfen zur zügigen und nachhaltigen Verbesserung der Qualität der ambulanten, teilstationären und stationären Versorgung der Bevölkerung in den neuen Bundesländern und zur Anpassung an das Versorgungsniveau im übrigen Bundesgebiet gewährt. Sie dürfen nur dazu verwendet werden, die für den Betrieb von Pflegeeinrichtungen notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instand zu halten oder instand zu setzen sowie die Erstausstattung mit den betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern zu finanzieren.
Wenn der Gesetzgeber auf diese Weise die Investitionsmaßnahmen legal definiert, so zeigt sich schon aufgrund des Wortlauts der Vorschrift („Herstellen oder Anschaffen abschreibungsfähiger Anlagegüter“) und des in ihr zum Ausdruck kommenden Zwecks (zügige und nachhaltige Verbesserung der Pflegeeinrichtungen), dass die Zuschüsse nicht –jedenfalls nicht vorrangig– gewährt wurden, um der Klägerin als Empfängerin im Sinne einer Gegenleistung die laufenden finanziellen Nachteile auszugleichen, die ihr aufgrund eingeschränkter Verwendungsmöglichkeiten entstehen. Vielmehr sollte ndamit –was auch die Höhe der Finanzierungshilfen bis zu den gesamten Investitionskosten (also z.B. den gesamten Herstellungskosten) indiziert– die notwendige erstmalige flächendeckende Errichtung in den neuen Bundesländern sichergestellt werden. Dass mit dieser Objektförderung zugleich bewirkt werden soll, die finanziellen Belastungen der Pflegebedürftigen zu senken und damit das Risiko der Pflegebedürftigkeit sozial abzusichern, ändert daran nichts.
Ein Belegungsrecht als Gegenleistung für die Finanzierungshilfen ergibt sich weder aus dem Bewilligungsbescheid noch aus den ihn flankierenden landesrechtlichen Regelungen. Wenn die Klägerin in 5.3. der Nebenbestimmungen zum Bewilligungsbescheid in Übereinstimmung mit der Landesrichtlinie IVP verpflichtet wird, alte, kranke und behinderte Menschen mit einem besonderen Pflege- und Betreuungsbedarf auf Anforderung des zuständigen örtlichen Trägers der Sozialhilfe unverzüglich aufzunehmen, so mag man darin lediglich eine Sicherung der Zweckbestimmung für das Altenpflegeheim sehen können und kein Belegungsrecht. Diese Auslegung der Nebenbestimmung gründet auf die Dauer der Zweckbindung für 30 Jahre, auf die in Art. 52 Abs. 1 PflegeVG zum Ausdruck kommende Intention, in die Altenpflege-Infrastruktur zu investieren sowie auf den mit der Nebenbestimmung gleichlautenden, in der Landesrichtlinie IVP formulierten Förderzweck.
Indessen kann dahinstehen, ob die Nebenbestimmung 5.3. ein Belegungsrecht überhaupt begründet. Jedenfalls steht dieses Recht in keiner synallagmatischen Beziehung zu den der Klägerin gewährten Finanzierungshilfen. Denn ein derartiges Belegungsrecht, wie es sich nunmehr aus §§ 9, 10 LPflegeG ausdrücklich ergibt, verwirklicht im sozialrechtlichen Kontext lediglich den in Art. 52 Abs. 1 PflegeVG zum Ausdruck kommenden Gesetzeszweck einer Objektförderung.
Die öffentliche Förderung der Investitionen ermöglicht einerseits die Errichtung von Pflegeeinrichtungen, womit die Länder ihrer Infrastrukturverantwortung aus § 9 SGB XI nachkommen. Zum anderen bezweckt sie, sozusagen als Reflex, die Pflegesätze von den Investitionskosten zu entlasten (vgl. § 82 Abs. 3 Satz 2 SGB XI), so dass die Pflegebedürftigen nur für Unterkunft und Verpflegung selbst aufkommen müssen. Dies führt dazu, dass auch Pflegebedürftige mit einem geringen (aber über der Sozialhilfebedürftigkeit liegenden) Einkommen eher in der Lage sind, die Pflegesätze aus dem eigenen Einkommen zu bestreiten. Diese Intention verfolgt namentlich das Pflege-Versicherungsgesetz, dessen Art. 52 Finanzhilfen für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet anordnet und als dessen Art. 1 das Sozialgesetzbuch –Elftes Buch– (Soziale Pflegeversicherung) verkündet wurde. Ziel des Gesetzes ist die soziale Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit2, und diesem Zweck dient auch das Belegungsrecht des Staates, mit dem gewährleistet wird, dass die geförderten Pflegeplätze vorrangig sozial schwachen Landesbürgern zugute kommen und mit dem der Sozialhilfeträger entlastet werden soll (Verminderung von Sozialhilfeleistungen), der ansonsten den (höheren) Pflegesatz zahlen müsste3.
Zuvörderst sollen die in Art. 52 PflegeVG geregelten Finanzhilfen des Bundes als zeitlich auf die Jahre 1995 bis 2002 beschränkte Anschubfinanzierung für Investitionsvorhaben im Beitrittsgebiet aber dafür sorgen, die dortigen Pflegeeinrichtungen an das Versorgungsniveau im übrigen Bundesgebiet anzupassen4. Deshalb dienen die Finanzhilfen vorrangig dazu, entsprechende Altenpflegeeinrichtungen zu errichten. Sie schaffen die finanzielle Grundlage dafür, die für den Betrieb von Pflegeeinrichtungen notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibbaren Anlagen herzustellen oder anzuschaffen, und zwar auch insoweit, als sie nicht die vom Belegungsrecht Begünstigten betreffen.
Dementsprechend ist auch die in § 82 Abs. 3 SGB XI enthaltene Regelung, wonach nur die nicht durch öffentliche Förderung abgedeckten Investitionskosten auf die Heimbewohner umgelegt und von ihnen im Rahmen der mit ihnen bestehenden Rechtsverhältnisse beansprucht werden können (vgl. dazu eingehend Bundessozialgericht, Urteil vom 6. September 2007 B 3 P 3/07 R, BSGE 99, 57), keine Mietpreisbindung, sondern eine Folge der öffentlichen Förderung und vermeidet eine doppelte Begünstigung des Berechtigten, die einträte, wenn er die von der öffentlichen Hand finanzierten Herstellungskosten zusätzlich auf die Pflegevergütung umlegen könnte. Diese Regelung soll letztlich bewirken, dass über geringere Pflegesätze ein größerer Anteil von Pflegebedürftigen (die regelmäßig nicht Nutznießer des Belegungsrechts sind) die Aufwendungen aus den Alterseinkünften finanzieren kann, ohne Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen zu müssen5.
Die als Baukostenzuschüsse empfangenen Finanzierungshilfen mindern die Herstellungskosten der Gebäude i.S. von § 255 Abs. 2 HGB. Weil die Mittel vornehmlich gewährt wurden, um Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet erst zu schaffen, sind sie auf die Nutzungsdauer der damit errichteten Gebäude zu verteilen, deren Zweckbindung auf dreißig Jahre angelegt ist.
Damit tritt der Bundesfinanzhof, wie er selbst ausdrücklich feststellt, nicht in Widerspruch zu seiner Rechtsprechung zum Dritten Förderweg. Wenn er dort empfangene Mittel als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung behandelt, so deshalb, weil das Gesetz mit der Förderung von Mietwohnraum bedürftige Haushalte unterstützt, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können6. Demgegenüber geht der Gesetzeszweck des Art. 52 PflegeVG darüber hinaus. Zwar will auch das Pflege-Versicherungsgesetz und mit ihm das SGB XI sozial und finanziell schwache Menschen z.B. mit dem Belegungsrecht begünstigen. Die Förderung ist jedoch –vor allem im Beitrittsgebiet– eingebettet in eine Strukturförderung, die auf die erstmalige Errichtung von Pflegeeinrichtungen auf „Westniveau“ gerichtet ist und die auch Pflegeplätze für diejenigen schafft, die sich am Markt ohne weiteres einen Pflegeplatz beschaffen können. Überdies sind die Begünstigten dieser Art von Förderung eigentlich weniger die pflegebedürftigen Menschen selbst als vielmehr die Träger der Sozialhilfe, da durch die Finanzierungshilfen Sozialhilfekosten vermindert und/oder vermieden werden.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 14. Juli 2009 – IX R 7/08
- ständige Rechtsprechung, vgl. BFH, Urteile vom 14.10.2003 – IX R 60/02, BFHE 203, 382, BStBl II 2004, 14, und vom 26.03.1991 – IX R 104/86, BFHE 164, 263, BStBl II 1992, 999[↩]
- vgl. BT-Drs. 12/5262, S. 1 f. und BT-Drs. 12/5617, S. 1 f.[↩]
- vgl. zum Zweck des Belegungsrechts eingehend BVerfG, Beschluss vom 17.10.2007 – 2 BvR 1095/05, DVBl 2007, 1555, m.w.N.[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 19.08.2008 – 3 B 11.08, DöV 2008, 1001[↩]
- zum Zweck der Vermeidung von Sozialhilfeabhängigkeit: BVerfG, DVBl 2007, 1555, m.w.N.[↩]
- so BFHE 203, 382, BStBl II 2004, 14[↩]