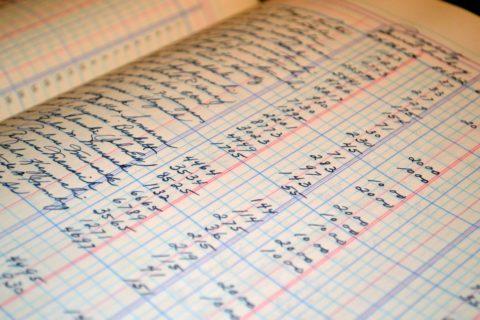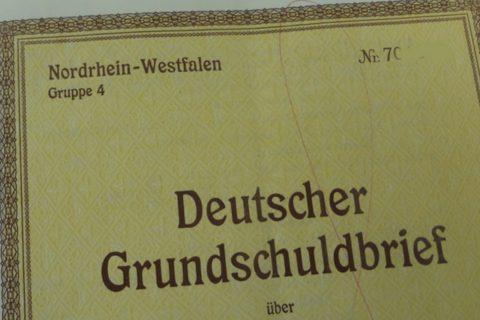Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Gewinnfeststellungsbescheid eine Vielzahl selbständiger und damit auch selbständig anfechtbarer Feststellungen enthalten, die eigenständig in Bestandskraft erwachsen und deshalb für die in dem nämlichen Bescheid getroffenen und rechtlich nachgelagerten Feststellungen Bindungswirkung entfalten können.

Solche selbständigen Regelungen (Feststellungen) sind insbesondere
- die Qualifikation der Einkünfte,
- das Bestehen einer Mitunternehmerschaft,
- die Höhe des laufenden Gewinns sowie
- dessen Verteilung auf die Mitunternehmer und
- die Höhe eines Sondergewinns bzw. einer Sondervergütung.
Selbständig anfechtbar ist auch die Feststellung eines Veräußerungs- oder Aufgabegewinns jedenfalls des einzelnen Mitunternehmers (z.B. aus der Veräußerung seines Mitunternehmeranteils).
Davon zu unterscheiden ist -als weitere selbständige Feststellung- die Qualifikation des Aufgabe- oder Veräußerungsgewinns (sowohl der Gesamthand als auch des einzelnen Mitunternehmers) als Bestandteil der außerordentlichen Einkünfte i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG.
Keine selbständige Feststellung ist hingegen der sich aus den einzelnen Feststellungen ergebende Gesamtgewinn. Insoweit handelt es sich lediglich um eine Rechengröße, die nicht selbständig anfechtbar ist1.
Eine Klage gegen einen Gewinnfeststellungsbescheid kann deshalb verschiedene Zielsetzungen haben. Welche Besteuerungsgrundlagen der Kläger mit seiner Klage angreift und damit zum Streitgegenstand des finanzgerichtlichen Verfahrens gemacht hat, ist durch Auslegung der Klageschrift oder der darin ausdrücklich in Bezug genommenen Schriftstücke zu ermitteln2. In der Auslegung prozessualer Willenserklärungen, die im erstinstanzlichen Klageverfahren abgegeben worden sind, ist das Revisionsgericht frei; es ist insoweit nicht gemäß § 118 Abs. 2 FGO an die Auslegung durch die Vorinstanz gebunden3. Prozesserklärungen sind wie sonstige Willenserklärungen auslegungsfähig. Ziel der Auslegung ist es, den wirklichen Willen des Erklärenden zu erforschen (§ 133 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). Dabei sind alle dem Finanzgericht und dem Finanzamt bekannten und vernünftigerweise erkennbaren Umstände tatsächlicher und rechtlicher Art zu berücksichtigen4. Die Auslegung einer Prozesserklärung darf nicht zur Annahme eines Erklärungsinhalts führen, für den sich in der (verkörperten) Erklärung selbst keine Anhaltspunkte mehr finden lassen. Auf die Wortwahl und die Bezeichnung kommt es jedoch nicht entscheidend an, sondern auf den gesamten Inhalt der Willenserklärung4.
Wird danach nur eine der in einem Gewinnfeststellungsbescheid enthaltenen selbständigen Feststellungen mit der Klage angefochten, kann während der Rechtshängigkeit dieser Klage der Streitgegenstand im Wege einer Klageänderung i.S. des § 67 FGO nur dann auf eine weitere selbständige Feststellung erstreckt werden, wenn diese Klageänderung innerhalb der einmonatigen Klagefrist erfolgt5. Die Selbständigkeit und damit die Möglichkeit der Teilanfechtung einer gesondert festgestellten Besteuerungsgrundlage hat der BFH ausnahmsweise nur dann verneint, wenn die Änderung der angefochtenen Besteuerungsgrundlage zwangsläufig, im Sinne einer untrennbaren Verknüpfung, Auswirkungen auf eine andere Besteuerungsgrundlage hat6.
Ausgehend von diesen Grundsätzen hatte das Finanzgericht Münster im hier entschiedenen Fall die Klage wegen der Höhe des laufenden Gewinns aus Gewerbebetrieb zu Unrecht als unzulässig abgewiesen7.
Zwar hat das Finanzgericht eingangs der Entscheidungsgründe ausgeführt, die zulässige Klage sei unbegründet. Aus den Gründen im Weiteren ergibt sich aber, dass es die Klage wegen der Höhe des festgestellten laufenden Gewinns aus Gewerbebetrieb und wegen der Feststellung eines Aufgabe-/Veräußerungsverlusts gemäß § 16 EStG durch Prozessurteil abgewiesen hat. So hat es unter 2.c der Entscheidungsgründe ausgeführt, dass dem diesbezüglichen Klageantrag schon aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht gefolgt werden könne, da zu dem Zeitpunkt, in dem die Klägerin erstmals die Änderung dieser selbständigen Besteuerungsgrundlagen beantragt habe, die Klagefrist bereits abgelaufen gewesen sei.
Die Klägerin hat mit ihrer fristgerecht erhobenen Klage, anders als das Finanzgericht meint, den Gewinnfeststellungsbescheid nicht nur insoweit angefochten, als dort die Qualifikation der Einkünfte als solche aus Gewerbebetrieb festgestellt worden ist. Dem Finanzgericht ist allerdings zuzugeben, dass es der Klägerin in erster Linie um die Umqualifizierung der festgestellten laufenden Einkünfte in solche aus Vermietung und Verpachtung ging. Allerdings sind die Ausführungen in der Klageschrift nicht darauf beschränkt. Diesen ist vielmehr zu entnehmen, dass die Klägerin -als Minus- daneben auch die Höhe des festgestellten laufenden Gewinns angefochten hat. Dies lässt sich zum einen den umfangreichen Ausführungen zum Vorliegen eines Sanierungsgewinns entnehmen. Denn die Klägerin ist in diesem Zusammenhang, wenn auch rechtsirrig, (zunächst) davon ausgegangen, dass die Anerkennung eines Sanierungsgewinns zu einer Herabsetzung des laufenden Gewinns führt. Diese Rechtsauffassung hatte die Klägerin bereits im Einspruchsverfahren vertreten und sie spiegelte sich auch in der beim Beklagten und Beschwerdegegner (Finanzamt) eingereichten Feststellungserklärung wider. Zum anderen hatte die Klägerin in dem Klageschriftsatz ausgeführt, dass eine gewinnerhöhende Ausbuchung der Verbindlichkeit gegenüber der Volksbank im Streitjahr 2007 nicht „zu vollziehen“ sei. Auch hiermit hat die Klägerin hinreichend deutlich gemacht, dass in jedem Fall auch die Höhe des laufenden Gewinns angefochten werden sollte. Wenn die Klägerin, was das Finanzgericht zutreffend ausführt, an ihrer Begründung hinsichtlich des Vorliegens eines Sanierungsgewinns bzw. dessen Auswirkung auf die Feststellung der Höhe des laufenden Gewinns nicht mehr festhält, führt dies nicht, anders als das Finanzgericht wohl meint, zu einem Wegfall dieses Streitgegenstands. Dies kann schon deshalb nicht angenommen werden, weil die Klägerin, wie sich dem protokollierten Klageantrag entnehmen lässt, ausdrücklich an ihrem Klagebegehren, die Feststellung des laufenden Gewinns abzuändern, festgehalten hat. Die Klägerin hat insoweit lediglich die Begründung ausgetauscht, indem sie nunmehr, offensichtlich auch auf Grund der Rechtsausführungen des Finanzgericht in der mündlichen Verhandlung, davon ausgeht, dass der bisher von ihr als Sanierungsgewinn bezeichnete Gewinn tatsächlich als Aufgabegewinn gemäß § 16 EStG zu qualifizieren sei und auf Grund der in dem Schriftsatz vom 30.03.2016 im Einzelnen dargelegten Haftungs- und Bürgschaftsinanspruchnahme und auf Grund von Zinszahlungen insgesamt sogar ein Aufgabeverlust festzustellen sei.
Der Verfahrensfehler hat zur Folge, dass die Vorentscheidung, soweit über den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2007 wegen der Feststellung der Höhe des laufenden Gewinns entschieden ist, ohne sachliche Nachprüfung aufzuheben und der Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen ist (§ 116 Abs. 6 FGO). Die im Ermessen des Bundesfinanzhofs stehende Zurückverweisung ist bereits deshalb geboten, weil es an entsprechenden Feststellungen des Finanzgerichts zu der Höhe des Gewinns fehlt.
Zutreffend hat das Finanzgericht allerdings die Klage auf Feststellung eines Veräußerungs- bzw. Aufgabeverlusts als unzulässig abgewiesen. Dabei kann dahinstehen, ob im Streitfall ein Veräußerungs-/Aufgabetatbestand zu bejahen ist, und ob deshalb die beantragte Herabsetzung des laufenden Gewinns um die darin erfassten Sanierungsgewinne, wie das Finanzgericht und dem folgend wohl auch die Klägerin meint, zwangsläufig zu einem Aufgabegewinn in gleicher Höhe führt. Denn im Streitfall begehrte die Klägerin die Feststellung eines Veräußerungsverlusts mit der Begründung, dass bei der Ermittlung der Höhe des Aufgabegewinns Aufwendungen aus der Haftungs- und der Bürgschaftsinanspruchnahme sowie Zinszahlungen zusätzlich zu berücksichtigen seien. Die Änderung der Höhe des laufenden Gewinns hatte im Streitfall daher keine zwangsläufigen Auswirkungen im Sinne einer untrennbaren Verknüpfung mit der erst nach Ablauf der Klagefrist erstmals begehrten Feststellung eines Veräußerungsverlusts8.
Bundesfinanzhof, Beschluss vom 19. September 2017 – IV B 85/16
- vgl. zuletzt BFH, Urteil vom 16.03.2017 – IV R 31/14, BFHE 257, 292, Rz 18[↩]
- BFH, Urteil vom 09.02.2011 – IV R 15/08, BFHE 233, 290, BStBl II 2011, 764, Rz 15[↩]
- BFH, Urteile vom 23.02.2012 – IV R 32/09; und vom 20.11.2014 – IV R 47/11, BFHE 248, 144, BStBl II 2015, 532[↩]
- BFH, Urteil in BFHE 248, 144, BStBl II 2015, 532[↩][↩]
- BFH, Urteil in BFHE 233, 290, BStBl II 2011, 764[↩]
- BFH, Urteile vom 08.06.2000 – IV R 65/99, BFHE 192, 207, BStBl II 2001, 89; und vom 23.02.2012 – IV R 32/09, Rz 31[↩]
- FG Münster, Urteil vom 21.09.2016 – 11 K 1320/13 F[↩]
- vgl. dazu BFH, Urteil in BFHE 192, 207, BStBl II 2001, 89[↩]