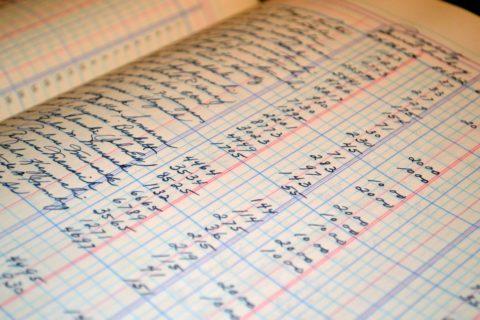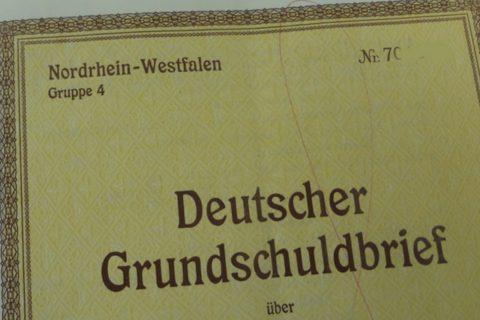Der personenbezogene Höchstbetrag in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG i.d.F. des JStG 2010 begrenzt den Abzug von Aufwendungen eines Steuerpflichtigen auch bei der Nutzung von mehreren häuslichen Arbeitszimmern in verschiedenen Haushalten typisierend auf 1.250 €.

Gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG, der für alle offenen Fälle ab dem Veranlagungszeitraum 2007 gilt (§ 52 Abs. 12 Satz 9 EStG), kann ein Steuerpflichtiger Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht als Betriebsausgaben abziehen. Dies gilt nicht, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG). In diesem Fall wird die Höhe der abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 € begrenzt; die Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG).
Ein „anderer Arbeitsplatz“ im Sinne der Abzugsbeschränkung ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Er steht dann „für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit […] zur Verfügung“, wenn ihn der Steuerpflichtige in dem konkret erforderlichen Umfang und in der konkret erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzen kann1, so dass der Steuerpflichtige nicht auf das häusliche Arbeitszimmer angewiesen ist2.
Ein solcher „anderer Arbeitsplatz“ muss -soll er den Ausschluss des Betriebsausgabenabzugs begründen, weil der Steuerpflichtige nicht auf das häusliche Arbeitszimmer angewiesen ist- außerhalb der häuslichen Sphäre des Steuerpflichtigen zur Verfügung stehen3. Ein zur Erledigung büromäßiger Arbeiten genutztes weiteres häusliches Arbeitszimmer ist daher kein „anderer Arbeitsplatz“ i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG.
Der Betriebsausgabenabzug ist nicht auf den Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer beschränkt, denn das Wort „ein“ ist nicht als Zahlwort, sondern als unbestimmter Artikel zu verstehen4.
Allerdings ist der Betriebsausgabenabzug durch den gesetzlichen Höchstbetrag begrenzt, auch wenn er mehrere häusliche Arbeitszimmer nutzt. Der nicht einkünfte, wohl aber personenbezogene Höchstbetrag in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG5 beschränkt den Abzug der Betriebsausgaben für den Steuerpflichtigen in typisierender Weise und damit unabhängig von der Zahl der tatsächlich genutzten häuslichen Arbeitszimmer auf 1.250 €.
Der Gesetzgeber hat mit der im Streitjahr geltenden Regelung für die Fälle, in denen dem Steuerpflichtigen für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, im Wesentlichen die bis zur Änderung durch das Steueränderungsgesetz 2007 geltende Rechtslage wiederhergestellt6, nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden hatte, dass ein Ausschluss des Betriebsausgabenabzugs für diese Fallgruppe das Gebot hinreichend realitätsgerechter Typisierung verfehle. Betroffen seien insoweit Fälle, in denen die Erforderlichkeit eines häuslichen Arbeitszimmers durch objektive Merkmale bestimmt sei. Zwar sei die Erforderlichkeit keine allgemeine Voraussetzung für die Qualifikation von Erwerbsaufwendungen, und zwar auch dann nicht, wenn solche Aufwendungen die Lebensführung des Steuerpflichtigen berührten. Die erkennbar gegebene Erforderlichkeit fungiere in diesem Fall aber als legitimes Hilfsmittel einer typisierenden Abgrenzung von Erwerbs- und Privatsphäre7.
Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht den insoweit bestehenden erheblichen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach betont, da eine effektive Kontrolle der tatsächlichen Nutzung häuslicher Arbeitszimmer wegen des engen Zusammenhangs zur Sphäre der privaten Lebensführung und des Schutzes durch Art. 13 des Grundgesetzes wesentlich eingeschränkt oder gar unmöglich sei. Individuell gestaltete Besonderheiten dürften daher mit der Festsetzung einer typisierenden Höchstgrenze unberücksichtigt bleiben. Angesichts der möglichen vielfältigen Faktoren, von denen die Entscheidungen der Steuerpflichtigen über Lage, Größe und Qualität ihrer Wohnung einschließlich eines Arbeitszimmers abhängen, sei insbesondere der Ansatz einer grob pauschalierenden Höchstgrenze, wie sie in der Vorgängerbestimmung enthalten gewesen sei, verfassungsrechtlich unbedenklich. Dem Gesetzgeber bleibe es auch unbenommen, bei der Bestimmung des Höchstbetrages die objektiv gegebene, staatlich jedoch nicht beobachtbare Möglichkeit privater Mitbenutzung des häuslichen Arbeitszimmers pauschal zu berücksichtigen8.
Mit der Wiedereinführung des personenbezogenen, typisierenden Höchstbetrages9 hat der Gesetzgeber demnach zum Ausdruck gebracht, dass dem Steuerpflichtigen -auch wenn das Fehlen eines anderen Arbeitsplatzes für die Erforderlichkeit eines häuslichen Arbeitszimmers spricht- ein Betriebsausgabenabzug nur bis zur Höhe des gesetzlichen Höchstbetrages zusteht, ohne dass es auf die individuell gestalteten Besonderheiten (insbesondere auch zur Lage, Größe und Qualität der Wohnung einschließlich des häuslichen Arbeitszimmers) ankommt.
Damit wird der dem Steuerpflichtigen entstandene Aufwand auch unabhängig von der Anzahl der von ihm genutzten Arbeitszimmer bis zum Höchstbetrag von 1.250 € typisierend abgegolten. Er kann seine Aufwendungen daher nur bis zum gesetzlichen Höchstbetrag abziehen, auch wenn er in einem Veranlagungszeitraum zwei Arbeitszimmer im gleichen Haushalt oder (z.B. durch einen Umzug veranlasst) zeitlich gestaffelt zwei Arbeitszimmer in zwei verschiedenen Haushalten nutzt10. Aber auch dann, wenn der Steuerpflichtige -wie im Streitfall- im gleichen Veranlagungszeitraum (parallel) mehrere Arbeitszimmer in verschiedenen Haushalten nutzt, begrenzt der gesetzliche Höchstbetrag den Betriebsausgabenabzug11.
Hierfür spricht auch die Systematik des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG.
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG schließt dem Wortlaut nach den Betriebsausgabenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung aus und schreibt damit ein generelles Betriebsausgabenabzugsverbot für häusliche Arbeitszimmer fest12. Ein Steuerpflichtiger kann entsprechende Aufwendungen demnach grundsätzlich weder für ein noch für mehrere häusliche Arbeitszimmer abziehen. Als Ausnahme hierzu ermöglicht § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Sätze 2 und 3 EStG einen der Höhe nach begrenzten Abzug von Aufwendungen für jene Fälle, in denen dem Steuerpflichtigen für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Danach begründet das Fehlen eines anderen Arbeitsplatzes zwar die Erforderlichkeit eines häuslichen Arbeitszimmers und damit (ausnahmsweise) einen typisierten, der Höhe nach begrenzten Betriebsausgabenabzug; eine Vervielfachung des Höchstbetrages bei Nutzung mehrerer häuslicher Arbeitszimmer lässt sich hieraus indes nicht herleiten.
Ob der Abzug der Aufwendungen auch deshalb auf den Höchstbetrag begrenzt ist, weil die Rechtsprechung bisher13 -ausgehend von der Objektbezogenheit des Höchstbetrages- funktionsgleich genutzte häusliche Arbeitszimmer in einem Haushalt des Steuerpflichtigen bzw. mehrere funktionsgleich genutzte häusliche Arbeitszimmer, die während eines Veranlagungszeitraums nacheinander in den verschiedenen Häusern bzw. Wohnungen des Steuerpflichtigen genutzt werden, als funktionale Einheit und damit für die Anwendung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG als ein Objekt angesehen hat und diese Rechtsprechung auf den Streitfall übertragbar ist, kann somit dahinstehen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 9. Mai 2017 – VIII R 15/15
- vgl. z.B. BFH, Urteile vom 05.10.2011 – VI R 91/10, BFHE 235, 372, BStBl II 2012, 127; vom 07.08.2003 – VI R 17/01, BFHE 203, 130, BStBl II 2004, 78, m.w.N.[↩]
- vgl. BFH, Urteil vom 16.09.2015 – IX R 19/14, BFH/NV 2016, 380[↩]
- so i.E. auch Paul in Herrmann/Heuer/Raupach -HHR-, § 4 EStG Rz 1555[↩]
- so BFH, Urteil vom 15.12 2016 – VI R 53/12, BFHE 256, 143 – wenn auch nicht tragend[↩]
- vgl. BFH, Urteile in BFHE 256, 143; und vom 15.12 2016 – VI R 86/13, BFHE 256, 150 zur Frage der Personenbezogenheit des Höchstbetrages; vom 16.07.2014 – X R 49/11, BFH/NV 2015, 177 zur Frage der Einkünftebezogenheit des Höchstbetrages[↩]
- vgl. BT-Drs. 17/3549, S. 15[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 06.07.2010 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss in BVerfGE 126, 268[↩]
- vgl. zur Verfassungsmäßigkeit der Regelung BFH, Urteil vom 22.03.2016 – VIII R 10/12, BFHE 254, 1, BStBl II 2016, 881[↩]
- so i.E. schon BFH, Urteil vom 09.11.2006 – IV R 2/06, BFH/NV 2007, 677; BFH, Urteile vom 20.11.2003 – IV R 30/03, BFHE 204, 176, BStBl II 2004, 775; vom 16.12 2004 – IV R 19/03, BFHE 208, 263, BStBl II 2005, 212; BFH, Beschluss vom 09.05.2005 – VI B 50/04, BFH/NV 2005, 1550; BFH, Urteile vom 23.09.2009 – IV R 21/08, BFHE 227, 31, BStBl II 2010, 337; vom 09.11.2005 – VI R 19/04, BFHE 211, 505, BStBl II 2006, 328 – allerdings ausgehend von objektbezogenem Höchstbetrag[↩]
- so i.E. auch Spilker in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 4 Rz Lb 121; HHR/Paul, § 4 EStG Rz 1565; Schmidt/Heinicke, EStG, 36. Aufl., § 4 Rz 598; wohl auch Blümich/Wied, § 4 EStG Rz 850; unklar Nacke in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 4 Rz 1796[↩]
- vgl. z.B. Bode in Kirchhof, EStG, 16. Aufl., § 4 Rz 215[↩]
- vgl. z.B. BFH, Urteile in BFH/NV 2007, 677; in BFHE 204, 176, BStBl II 2004, 775; in BFHE 208, 263, BStBl II 2005, 212; in BFHE 227, 31, BStBl II 2010, 337; in BFHE 211, 505, BStBl II 2006, 328; BFH, Beschluss in BFH/NV 2005, 1550[↩]