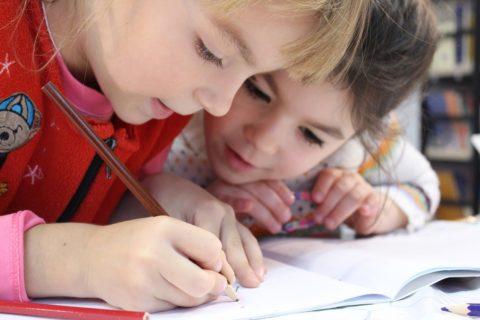Erhält ein Unternehmen ein Sachdarlehen über festverzinsliche Anleihen, die es nach Empfang veräußert und später zwecks Rückgabe zurückerwirbt, so sind weder die beim Rückerwerb dem Veräußerer zu vergütenden Stückzinsen noch die im Zeitraum zwischen der Überlassung der Anleihen und deren Rückgabe an den Darlehensgeber aufgelaufenen Stückzinsen als Entgelte für Schulden hinzuzurechnen. Eine konkludente Abbedingung des § 101 BGB -die Zinsen der überlassenen Anleihen stehen der Verleiherin zu- begründet kein zusätzliches Entgelt für die Gewährung eines Wertpapierdarlehens.

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG 2002) sind gemäß § 8 Nr. 1 Alternative 3 GewStG 2002 die „Hälfte der Entgelte für Schulden“ hinzuzurechnen, die der nicht nur vorübergehenden Verstärkung des Betriebskapitals dienen. Eine solche Hinzurechnung setzt voraus, dass ein Darlehensverhältnis vorliegt, das als sog. Dauerschuld angesehen werden kann1. Zinsen und andere als Entgelte zu behandelnde Aufwendungen des Darlehensnehmers sind auf dieser Grundlage als Entgelte i.S. von § 8 Nr. 1 GewStG 2002 zu qualifizieren.
Im vorliegenden Fall ist das erstinstanzlich tätige Finanzgericht Baden-Württemberg2 zutreffend davon ausgegangen ist, dass es sich bei den von der Sachdarlehensnehmerin aufgrund der erhaltenen Anleihen passivierten Sachdarlehensverbindlichkeiten (§ 607 BGB) um Dauerschulden i.S. von § 8 Nr. 1 Alternative 3 GewStG 2002 handelt, weil sich durch die jeweils kurz vor dem Laufzeitende der einzelnen Wertpapiersachdarlehen zwischen der Sachdarlehensnehmerin und der A Ltd. vereinbarten Folgeverträge eine Laufzeit von insgesamt mehr als einem Jahr ergab. Der wirtschaftliche Zusammenhang der einzelnen Sachdarlehen lässt die Begründung mehrerer einzelner Schuldverhältnisse in den Hintergrund treten und bewirkt eine einheitliche Beurteilung3.
Die von der Sachdarlehensnehmerin beim Erwerb der kurz darauf an die A Ltd. zurückgegebenen Anleihen für die Stückzinsen aufgewendeten Beträge sind nicht hinzuzurechnen, weil sie nicht i.S. von § 8 Nr. 1 GewStG 2002 zu Betriebsausgaben geführt haben; sie sind im Übrigen auch keine „Entgelte für Schulden“.
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb werden nach § 8 GewStG 2002 die dort genannten Beträge wieder hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind. Eine Hinzurechnung von Entgelten für Schulden nach § 8 Nr. 1 GewStG 2002 setzt daher deren Abziehbarkeit als Betriebsausgaben voraus. Der betreffende Aufwand muss bei der einkommensteuerrechtlichen Gewinnermittlung eine Betriebsausgabe nach § 4 Abs. 4 EStG darstellen4. Eine Gewinnabsetzung liegt daher nicht vor, wenn der Aufwand in die Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts eingeht5.
Erwirbt ein Steuerpflichtiger -wie hier die Sachdarlehensnehmerin- Wertpapiere, um seine Verpflichtung zur Rückgabe von als Sachdarlehen erhaltenen Anleihen zu erfüllen, so hat er dem Veräußerer die seit dem letzten Zinszahlungstermin aufgelaufenen Stückzinsen zu vergüten. Die aufgrund des (Rück-)Erwerbs der Anleihen an den Veräußerer -die X-Bank- für die Stückzinsen gezahlten Beträge minderten den Gewinn der Sachdarlehensnehmerin jedoch nicht. Denn die Sachdarlehensnehmerin erhielt dafür -mit der erworbenen Anleihe- eine gleichwertige Zinsforderung, die als sonstiger Vermögensgegenstand zu aktivieren war6; der Vorgang war mithin erfolgsneutral.
Dabei ist unerheblich, ob das Wertpapier und der Stückzins buchhalterisch zutreffend gesondert erfasst oder die Stückzinsen fälschlich als Teil der Anschaffungskosten des Wertpapiers behandelt werden. Für den Betriebsausgabenabzug ist es ebenfalls unerheblich, ob die mit Stückzinsen von der X-Bank erworbene Anleihe tatsächlich über einen Bilanzstichtag gehalten und die erworbenen Stückzinsen buchhalterisch erfolgsneutral behandelt und in der Bilanz aktiviert wurden. Maßgeblich ist insofern, dass die für den Erwerb der Stückzinsen aufgewendeten Beträge den Gewinn der Sachdarlehensnehmerin nicht minderten, sondern aufgrund der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich erfolgsneutral waren. Dies entspricht dem BFH, Urteil in BFHE 269, 342, BFH/NV 2021, 122 und dem BFH, Urteil in BFH/NV 2021, 1367, wonach es für eine Hinzurechnung von Mietzinsen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG 2002 darauf ankommt, ob diese sich unmittelbar als Betriebsausgaben ausgewirkt haben oder aber den handelsrechtlichen Herstellungskostenbegriff erfüllen.
Einer Hinzurechnung der Beträge, die beim Erwerb der kurz darauf an die A Ltd. zurückgegebenen Anleihen für die Stückzinsen anfielen, steht weiter entgegen, dass es sich dabei nicht um Entgelte „für“ Schulden i.S. des § 8 Nr. 1 GewStG 2002 handelte.
Als Entgelte für Schulden sind nach § 8 Nr. 1 GewStG 2002 nur die Gegenleistungen für die Zurverfügungstellung von Fremdkapital hinzuzurechnen7. Leistungen, die nicht die Nutzung des Fremdkapitals abgelten, die also nicht mit der tatsächlichen Nutzung oder der Nutzungsmöglichkeit von Fremdkapital zusammenhängen, sondern für eine andere Leistung oder aus einem anderen Rechtsgrund erbracht werden, sind daher nicht hinzuzurechnen8. Deshalb werden z.B. Bereitstellungszinsen nicht hinzugerechnet, weil durch sie nicht die Inanspruchnahme von Fremdkapital abgegolten wird, sondern die Zurverfügungstellung und das Bereithalten der erst später auszuzahlenden Gelder9.
Die beim Erwerb der Anleihen für die Stückzinsen aufgewendeten Beträge wurden nicht an die Darlehensgeberin für die Kapitalüberlassung gezahlt, sondern an den Veräußerer für die Übertragung der Anleihen. Die Zahlungen beruhten auch nicht auf dem Darlehensverhältnis mit der A Ltd., d.h. der Entgegennahme und Rückgabe der Anleihen, sondern auf dem Entschluss der Sachdarlehensnehmerin, die Anleihen nach ihrem Erhalt zu veräußern, sodass sie vor Fälligkeit des Sachdarlehens gleichartige Anleihen zurückerwerben und dabei die beim Veräußerer aufgelaufenen Stückzinsen vergüten musste. Hätte die Sachdarlehensnehmerin die Anleihen nicht sogleich nach Erhalt veräußert, sondern bis zur Rückgabe selbst gehalten, weil z.B. ihr Kapitalbedarf unerwartet entfiel, oder hätte sie die ihr überlassenen Anleihen zur Besicherung eines von einem Dritten gewährten Gelddarlehens eingesetzt, so wäre es nicht zum Wiedererwerb der Anleihen nebst aufgelaufener Stückzinsen gekommen. Der Sachdarlehensnehmerin wären dann -auch wirtschaftlich betrachtet- für das Sachdarlehen nur Aufwendungen in Höhe der vereinbarten sog. Leihgebühr von 0, 7 % bzw. 0, 48 % entstanden, die sie der A Ltd. schuldete.
Eine Zusammenfassung der Sachdarlehensverträge und der Forwards, durch die die zurückzugebenden Anleihen von der X-Bank erworben wurden, wäre im Übrigen selbst dann ausgeschlossen, wenn beide ohne einander nicht denkbar wären, denn jedes einzelne Schuldverhältnis muss im Hinblick auf § 8 Nr. 1 GewStG 2002 grundsätzlich für sich beurteilt werden10. Einer (ausnahmsweisen) Zusammenfassung von Sachdarlehen und Forwards stand danach entgegen, dass es der Sachdarlehensnehmerin frei stand, wann und von wem sie die Anleihen zurückerwerben wollte.
Die im Zeitraum zwischen der Überlassung der Anleihen an die Sachdarlehensnehmerin und deren Rückgabe an die A Ltd. aufgelaufenen Stückzinsen sind ebenfalls nicht hinzuzurechnen. Sie stehen zwar mit der Überlassung des Sachdarlehens im Zusammenhang, es handelt sich jedoch auch insoweit nicht um „Entgelte für Schulden“ i.S. von § 8 Nr. 1 GewStG 2002.
Die Sachdarlehensnehmerin war nach § 607 Abs. 1 Satz 2 BGB verpflichtet, ein Darlehensentgelt zu zahlen und bei Fälligkeit Anleihen „gleicher Art, Güte und Menge“ zurückzugeben. Das Gesetz unterscheidet mithin zwischen der Rückgabe der Sache einerseits und der Zahlung eines Entgelts andererseits11.
Die Rückerstattungspflicht des Darlehensnehmers entsteht dabei nicht durch die im Abschluss des Darlehensvertrags manifestierte Vereinbarung der Parteien, sondern ohne Weiteres kraft Gesetzes als Folge der Vereinbarung der zeitlich begrenzten Überlassung der vereinbarten vertretbaren Sache durch den Darlehensgeber; sie steht -anders als die Pflicht zur Zahlung des Entgelts- nicht im Synallagma12.
Da die während der Darlehenslaufzeit aufgelaufenen Stückzinsen den Anleihen gewissermaßen innewohnten oder anhafteten und eine Rückgabe der Anleihen ohne die Stückzinsen oder aber nur mit den bis zum Empfang der Anleihen von der A Ltd. aufgelaufenen Stückzinsen ausgeschlossen war, erfüllte die Sachdarlehensnehmerin insoweit lediglich ihre gesetzliche Rückerstattungspflicht und leistete kein Entgelt. Entgelt für die Darlehensgewährung (§ 609 BGB) war danach lediglich die in Nr. 5 des Rahmenvertrags vereinbarte sog. Leihgebühr, da es zu den in Nr. 6 des Rahmenvertrags geregelten Kompensationszahlungen nicht gekommen ist.
Die entgegenstehende Auffassung des Finanzamtes liefe demgegenüber darauf hinaus, dass die Überlassung verzinslicher Anleihen im Wege eines unentgeltlichen Sachdarlehens ausgeschlossen wäre, weil Anleihen nicht von dem aufgelaufenen Zinsanspruch getrennt werden können oder dass ein unentgeltliches Sachdarlehen voraussetzen würde, dass der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer die aufgelaufenen Stückzinsen bei Rückgabe vergütet.
Die während der Darlehenslaufzeit aufgelaufenen Stückzinsen sind auch nicht als Entgelt i.S. von § 8 Nr. 1 GewStG 2002 zu behandeln, weil die Sachdarlehensnehmerin als Eigentümerin von Wertpapieren oder als Forderungsinhaberin der Anleihen nach § 101 BGB ein Recht auf deren Früchte -hier: Zinsen- hatte und auf diese gegenüber der A Ltd. verzichtet hat.
§ 101 BGB regelt das schuldrechtliche Verhältnis sukzessiv Fruchtziehungsberechtigter untereinander13. Die dispositive Vorschrift des § 101 BGB kommt jedoch in der Praxis nur selten zur Anwendung14 und ist bei der Veräußerung von börsennotierten Wertpapieren nicht anwendbar, weil dort der Ausgleich schon im Kurswert berücksichtigt ist15.
Nach dem zwischen der Sachdarlehensnehmerin und der A Ltd. geschlossenen Rahmenvertrag sollen die Zinsen der überlassenen Anleihen weiterhin der Verleiherin zustehen. In dieser konkludenten Abbedingung des § 101 Nr. 2 BGB liegt hinsichtlich des Verzichts auf die Vergütung von Stückzinsen kein zusätzliches Entgelt für die Gewährung des Wertpapierdarlehens.
Denn ein Anspruch aus § 101 Nr. 2 BGB bestand nicht, weil es sich um börsennotierte Anleihen handelte. Die Annahme eines zusätzlichen Entgelts wäre aber selbst dann ausgeschlossen, wenn ein Anspruch der Sachdarlehensnehmerin aus § 101 Nr. 2 BGB hätte entstehen können. Denn eine vertragliche Vereinbarung, die die Anwendung des § 101 Nr. 2 BGB ausschließt, ist der Besteuerung grundsätzlich zugrunde zu legen; die Früchte sind dann nicht anteilig dem Rechtsvorgänger zuzurechnen, weil sie während seiner Inhaberschaft oder Besitzzeit entstanden sind oder erwirtschaftet wurden16.
Dem Finanzamt ist zuzugestehen, dass der Verzicht auf eine zustehende Forderung als Entgelt zu qualifizieren sein kann. Dies setzt indessen regelmäßig voraus, dass ein entsprechender Anspruch bereits besteht. Ein Entgelt ist daher nicht gegeben, wenn nicht ein bestehender Anspruch z.B. erlassen wird, sondern ein -möglicher- Anspruch durch entsprechende Vertragsgestaltung nicht zur Entstehung gelangt. Eine Regelung, durch die von § 101 Nr. 2 Halbsatz 2 BGB abgewichen wird, ist -sofern nicht rechtsmissbräuchlich- steuerlich hinzunehmen17.
Für das vorstehende Ergebnis ist unerheblich, wie der der Sachdarlehensnehmerin entstandene Aufwand für die dem Veräußerer der Anleihen vergüteten Stückzinsen oder die Sachdarlehensverbindlichkeit bilanziell dargestellt wurde. Die von der Sachdarlehensnehmerin vorgenommene Zuschreibung auf dem Wertpapierdarlehenskonto führt nicht dazu, dass dieser Betrag -was für die Hinzurechnung erforderlich wäre- als der A Ltd. zugeflossenes Entgelt für deren Sachdarlehen zu behandeln wäre. Bilanzielle Bewertungs- bzw. Wertberichtigungsmaßnahmen im Schuldnervermögen sind nicht als Entgelt zu qualifizieren18.
Unerheblich ist auch, dass der Rückerwerb aufgrund des mit der Bank vereinbarten Forwards bereits im Zeitpunkt der Veräußerung der Anleihen feststand. Ob die zurückgegebenen Anleihen vor Ende der Sachdarlehenslaufzeit unmittelbar von der X-Bank geliefert (physical delivery) oder aber von Dritten oder an der Börse erworben wurden und die Bank aufgrund des Forwards lediglich einen Barausgleich leistete, ist ebenfalls ohne Bedeutung.
Der Bundesfinanzhof verkennt nicht, dass sich die Sachdarlehensnehmerin durch die gewählte Gestaltung -Kombination des Sachdarlehens mit der Veräußerung und dem Rückerwerb der erhaltenen Anleihen, wobei die Stückzinsen zu vergüten waren- wirtschaftlich betrachtet ein Gelddarlehen verschafft hat, für das sie neben der Leihgebühr auch die Differenz der bei der Veräußerung der Anleihen vom Käufer erhaltenen und der von ihr beim Rückerwerb dem Verkäufer vergüteten Stückzinsen aufwenden musste, wobei die Rückgewähr zu einem Verlust der bis dahin ihr zustehenden Stückzinsen führte, während die A Ltd. sowohl die Leihgebühr als auch die während der Darlehenslaufzeit entstandenen Anleihenszinsen erhalten hat.
Das ist für das Ergebnis des Rechtsstreits aber ohne Bedeutung, weil für die Bestimmung der hinzuzurechnenden „Entgelte für Schulden“ der Gesetzeswortlaut und grundsätzlich nicht eine davon abweichende wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeblich ist. Für eine am Gesetzeswortlaut orientierte und gegen eine wirtschaftliche Auslegung hat sich der Bundesfinanzhof im Übrigen auch -dort zu Gunsten der Verwaltung- beim Leasing im Doppelstockmodell sowie bei der Weiter- und Zwischenvermietung entschieden19.
Dies widerspricht schließlich auch nicht dem BFH-Urteil in BFH/NV 2014, 1588, HFR 2014, 1007. Denn jener Entscheidung liegt keine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde, sondern die Erwägung, dass die monatlichen Zahlungen der dortigen Sachdarlehensnehmerin an die Verkäuferin nicht der Abwicklung oder Erfüllung des Kaufvertrags dienten, sondern die Sachdarlehensnehmerin auf den eigenständigen Rechtsgrund der Freistellungsverpflichtung zahlte, durch die wiederum die Anschaffung von Wirtschaftsgütern entgolten wurde.
Für den Bundesfinanzhof ist nicht ersichtlich, dass die gewählte Gestaltung als Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts (§ 42 AO) gewertet werden könnte. Die Beteiligten haben dazu nichts vorgetragen, und das Finanzgericht hat nicht festgestellt, dass es sich um eine ungewöhnliche Gestaltung handelt.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 7. Oktober 2021 – III R 15/18
- z.B. BFH, Urteil vom 14.12.2011 – I R 37/11, BFH/NV 2012, 993[↩]
- FG Baden-Württemberg, Urteil vom 22.02.2018 – 3 K 3018/15[↩]
- BFH, Urteile vom 06.06.1973 – I R 257/70, BFHE 109, 465, BStBl II 1973, 670; und vom 16.01.1974 – I R 254/70, BFHE 111, 425, BStBl II 1974, 388; Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 6. Aufl., § 8 Nr. 1 Rz 27; Abschn. 45 Abs. 1 Satz 2 ff. der Gewerbesteuer-Richtlinien 1998[↩]
- BFH, Urteil vom 11.12.1997 – IV R 92/96, BFH/NV 1998, 1222, Rz 13 und 19, betreffend Refinanzierungskredit für Darlehen an Schwestergesellschaft[↩]
- z.B. BFH, Urteil vom 30.07.2020 – III R 24/18, BFHE 269, 342, BFH/NV 2021, 122; BFH, Urteil vom 20.05.2021 – IV R 31/18, BFH/NV 2021, 1367, beide betreffend Mietaufwendungen als Teil von Herstellungskosten unterjährig ausgeschiedener Wirtschaftsgüter[↩]
- Schubert/Gadek in Beck Bil-Komm., 12. Aufl., § 255 HGB Rz 307; Brandis/Heuermann/Ehmcke, § 6 EStG Rz 858[↩]
- BFH, Urteile vom 09.08.2000 – I R 92/99, BFHE 193, 141, BStBl II 2001, 609, betreffend nach der Darlehenssumme bemessene laufende Verwaltungskostenbeiträge; vom 30.04.2003 – I R 19/02, BFHE 202, 357, BStBl II 2004, 192, betreffend aktivierte Bauzeitzinsen; vom 21.05.2014 – I R 85/12, BFH/NV 2014, 1588, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung -HFR- 2014, 1007, betreffend Freistellungsverpflichtung aus Kaufvertrag; und vom 29.03.2007 – IV R 55/05, BFHE 217, 103, BStBl II 2007, 655, betreffend Avalgebühr für Ausfallbürgschaft[↩]
- vgl. Brandis/Heuermann/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 41; Haisch/Helios, Rechtshandbuch Finanzinstrumente, 2011, § 4 Rz 260; Deloitte/Bunzeck, GewStG, 2009, § 8 Nr. 1a Rz 19[↩]
- BFH, Urteil vom 10.07.1996 – I R 12/96, BFHE 181, 86, BStBl II 1997, 253; Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 10. Aufl., § 8 Nr. 1 Buchst. a Rz 6b[↩]
- BFH, Urteil in BFHE 217, 103, BStBl II 2007, 655, betreffend Avalgebühr, zur Zusammenfassung mehrerer Schuldverhältnisse s. dort Rz 22[↩]
- vgl. dazu MünchKomm-BGB/K. P. Berger, 8. Aufl., § 607 Rz 28 und 32[↩]
- MünchKomm-BGB/K. P. Berger, a.a.O., § 607 Rz 32[↩]
- Erman/J. Schmidt, BGB, 16. Aufl., § 101 Rz 1[↩]
- vgl. BFH, Urteil vom 21.05.1986 – I R 199/84, BFHE 147, 44, BStBl II 1986, 794, Rz 16 f.[↩]
- BGH, Urteil vom 19.04.2011 – II ZR 237/09, BGHZ 189, 261, Rz 23; Staudinger/Stieper (2017), BGB § 101 Rz 7; MünchKomm-BGB/Stresemann, 9. Aufl., § 101 Rz 11[↩]
- z.B. BFH, Beschluss vom 10.08.2004 – I B 2/04, BFH/NV 2005, 239[↩]
- BFH, Urteile vom 27.06.1978 – VIII R 168/73, BFHE 125, 532, BStBl II 1978, 674; und vom 09.03.1982 – VIII R 160/81, BFHE 136, 72, BStBl II 1982, 540, bestätigt durch BFH (GrS), Beschluss vom 29.11.1982 – GrS 1/81, BFHE 137, 433, BStBl II 1983, 272; BFH, Urteil vom 22.05.1984 – VIII R 316/83, BFHE 141, 255, BStBl II 1984, 746, Rz 12[↩]
- BFH, Urteil in BFH/NV 2014, 1588, HFR 2014, 1007, Rz 18; Haisch/Helios, a.a.O., § 4 Rz 260; vgl. auch Bundesministerium der Finanzen, Gewerbesteuer-Handbuch 2016, § 8 GewStG H 8.1 zu Teilwertabschreibungen[↩]
- BFH, Urteil vom 11.12.2018 – III R 23/16, BFHE 263, 260, BFH/NV 2019, 640; BFH, Urteile vom 08.12.2016 – IV R 55/10, BFHE 256, 519, BStBl II 2017, 722; vom 04.06.2014 – I R 70/12, BFHE 246, 67, BStBl II 2015, 289, und BFH, Urteil vom 17.07.2019 – III R 24/16, BFHE 265, 379, BStBl II 2020, 48, Rz 25, offengelassen bei durchgeleitetem Darlehen[↩]
Bildnachweis:
- Börsenchart: Yiorgos Ntrahas