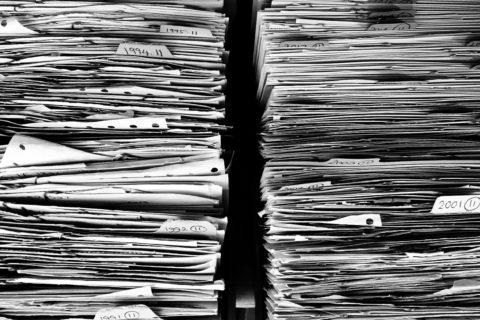Zum Jahresbeginn 2020 hat es einige Gesetzesänderungen gegeben: So ist die Kleinunternehmergrenze ab dem 1. Januar 2020 von 17.500 € auf 22.000 € angehoben worden.

Diese Änderung ist in dem Dritten Bürokratieentlastungsgesetz, BEG III,1 festgelegt worden. Mit diesem Gesetz soll der Bürokratieabbau vorangetrieben werden, denn sie hemmt Innovationen, belastet die Wirtschaft und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Besonders der Mittelstand wird durch zuviel Bürokratie belastet. Deshalb sollen Unternehmer außerdem dadurch Erleichterung erfahren, dass die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung eingeführt wird (§ 109 SGB IV-E; zum 1.1.2022). Außerdem ist geplant, dass es Erleichterungen bei der Vorhaltung von Datenverarbeitungssystemen für steuerliche Zwecke geben soll (§ 138 Abs. 1b AO-E; § 147 Abs. 6 Satz6 AO-E; geplant). Darüber hinaus müssen Gründer demnächst nur noch vierteljährlich – statt wie bisher monatlich – ihre Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Nach der bisherigen Regelung hat ein Gründer im Jahr der Gründung und im Folgejahr die Umsatzsteuervoranmeldungen jeden Monat abzugeben. In den nächsten Jahren, d.h. von 2021 bis 2026 wird das anders sein: Ein Gründer hat die Umsatzsteuervoranmeldungen dann grundsätzlich nur noch viermal pro Jahr abzugeben – statt wie bisher zwölfmal.
Jeder, der sich für das neue Jahr vorgenommen hat, in die Selbständigkeit zu wechseln, sollte sich mit den gesetzlichen Neuerungen vertraut machen. Wobei „selbständig sein“ viele Varianten beinhaltet: Sowohl ein Unternehmensgründer, ein Gewerbetreibender als auch ein Freiberufler zählen dazu. Und nicht für jede Art der Selbständigkeit gilt jede Vorschrift, vielmehr existieren sehr unterschiedliche Gesetze – abhängig von der Art der Selbständigkeit. Also hat die Entscheidung zum Gewerbeunternehmen oder zum Freiberufler langfristige und weitreichende Folgen.
Ein Unterscheidungskriterium zwischen Gewerbetreibendem und Freiberufler liegt im Bereich der Steuern. Nach dem Einkommenssteuergesetz gilt als Freiberufler, wer zu den Katalogberufen gem. § 18 EStG oder den sogenannten ähnlichen Berufen gehört. Anderenfalls zählt man zu den Gewerbetreibenden und unterliegt damit der Gewerbeordnung und hat Gewerbesteuer zu zahlen gem. § 2 Abs. 1 GewStG. Darin liegt ein wesentlicher Unterschied bezüglich der steuerlichen Behandlung gegenüber den Freiberuflern. Allerdings wird dieser Nachteil für den Unternehmer durch höhere Freibeträge (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 GewStG) und die Anrechnung bei der Einkommensteuer gemäßigt. Im Gegensatz dazu hat ein Freiberufler lediglich eine Einnahmenüberschussrechnung durchzuführen. Doch nicht jedem Selbständigen liegt die Unabhängigkeit und Freiheit des Freiberuflers. Darüber sollte man sich vor einer möglichen Entscheidung bewusst sein.
- BGBl I 2019, S. 1746; 28.11.2019[↩]