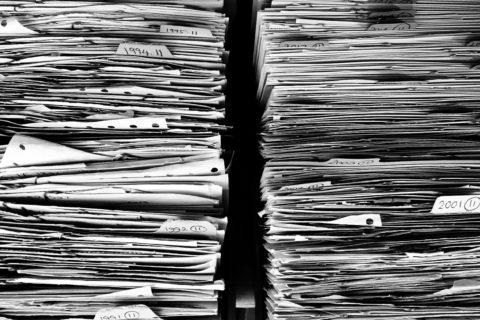Eine fortgesetzte Grundstücksnutzung für sakrale Zwecke befreit nicht beim Verkauf eines Kirchengrundstücks durch eine Religionsgemeinschaft an eine andere konfessionsverschiedene Religionsgemeinschaft von der Steuer gemäß § 4 GrEStG.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs hat das Finanzgericht in diesem Fall zu Unrecht angenommen, dass der Erwerb des Grundstücks durch die Klägerin (eine Religionsgemeinschaft orthodoxer Konfession) nach § 4 Nr. 1 GrEStG steuerfrei sei. Entgegen der Ansicht des Finanzgerichts sind im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb keine öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Beigeladenen auf die Klägerin übergegangen.
Gemäß § 4 Nr. 1 GrEStG ist der Erwerb eines Grundstücks durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts von der Besteuerung u.a. ausgenommen, wenn das Grundstück aus Anlass des Übergangs von öffentlich-rechtlichen Aufgaben von der einen auf die andere juristische Person übergeht und nicht überwiegend einem Betrieb gewerblicher Art dient. Nach seinem aus dem Wortlaut ersichtlichen Sinn und Zweck soll § 4 Nr. 1 GrEStG den Wechsel des Trägers einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe von Grunderwerbsteuer freihalten, sofern mit diesem Trägerwechsel auch ein (rechtsgeschäftlicher oder gesetzlicher) Übergang des Eigentums an Grundstücken verbunden ist1. Ein „Übergang“ von Aufgaben liegt nur vor, wenn die übernehmende juristische Person des öffentlichen Rechts eben die Funktionen wahrnimmt, welche bisher die übergebende juristische Person wahrgenommen hat2. Kein Übergang öffentlich-rechtlicher Aufgaben liegt daher vor, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts ihre Tätigkeiten aufeinander abstimmen, aber nach wie vor dieselben Aufgaben haben3.
Diese Voraussetzungen des § 4 Nr. 1 GrEStG sind im Streitfall nicht erfüllt. Die Klägerin hat das Grundstück nicht „aus Anlass des Übergangs von öffentlich-rechtlichen Aufgaben“ der Beigeladenen auf die Klägerin erworben. Die Beigeladene und die Klägerin nehmen als (konfessionsverschiedene) Religionsgemeinschaften je ihre eigenen Angelegenheiten (vgl. auch Art. 4 Abs. 1 und 2 sowie Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung) wahr. Dazu gehören auch und gerade die ihren jeweiligen konfessionellen Grundsätzen entsprechende Abhaltung von Gottesdiensten sowie die Seelsorge.
Demgemäß ergibt sich im Streitfall allein dadurch, dass das Kirchengrundstück nunmehr anstelle der Beigeladenen von der Klägerin für Zwecke des Gottesdienstes und der Seelsorge genutzt wird, kein Übergang von öffentlich-rechtlichen Aufgaben. Die Aufgabe der Beigeladenen zur (konfessionsgebundenen) Abhaltung von Gottesdiensten und zur seelsorgerischen Betätigung ist in vollem Umfang bei ihr verblieben und ist weder ganz noch teilweise auf die Klägerin übergegangen. Allein der hier mit dem Grundstücksgeschäft verfolgte Zweck, den sakralen Charakter des Kirchengebäudes durch eine weitere – wenn auch nunmehr konfessionsverschiedene – Nutzung für religiöse Zwecke zu bewahren, begründet keinen Übergang einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe.
Dass der Klägerin nach dem Grundstückserwerb die Unterhaltung des Grundstücks einschließlich der darauf befindlichen Gebäude obliegt, ist Folge und nicht Anlass des Grundstückserwerbs und kann schon deshalb die Anwendung des § 4 Nr. 1 GrEStG nicht begründen.
Die Klägerin wird entgegen ihrer Auffassung durch die Versagung der Steuerbefreiung des § 4 Nr. 1 GrEStG nicht diskriminiert oder im Verhältnis zu evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden ungleich behandelt. Denn der Grundstückserwerb durch die Klägerin ist nicht deshalb steuerpflichtig, weil die Klägerin und die Beigeladene Religionsgemeinschaften verschiedener Glaubensrichtungen sind. Für die Versagung der Steuerbefreiung aus § 4 Nr. 1 GrEStG ist vielmehr entscheidend, dass die Beigeladene ihre öffentlich-rechtlichen Aufgaben weiterhin selbst wahrnimmt.
Die Vorentscheidung stellt sich auch nicht aus anderen Gründen im Ergebnis als richtig dar. Der Erwerb des Grundstücks ist insbesondere nicht nach § 4 Nr. 3 GrEStG steuerbefreit.
Nach dieser Vorschrift ist von der Besteuerung ausgenommen der Erwerb eines Grundstücks durch einen ausländischen Staat oder eine ausländische kulturelle Einrichtung, wenn das Grundstück für kulturelle Zwecke bestimmt ist und Gegenseitigkeit gewährleistet wird. Dieser Tatbestand ist schon deshalb nicht erfüllt, weil es sich bei der Klägerin nicht um einen ausländischen Staat oder eine ausländische kulturelle Einrichtung, sondern um eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts handelt4.
Da das Finanzgericht von anderen Grundsätzen ausgegangen ist, war die Vorentscheidung aufzuheben. Die Sache ist spruchreif. Die Klage war abzuweisen.
- vgl. BFH, Urteil vom 17.05.1989 – II R 98/86, BFH/NV 1990, 263, m.w.N.[↩]
- Viskorf in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 17. Aufl., § 4 Rz 14; Pahlke/Franz, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 4. Aufl., § 4 Rz 9, jeweils m.w.N.[↩]
- vgl. BFH-Urteil in BFH/NV 1990, 263[↩]
- vgl. auch FG Köln, Urteil vom 31.05.1989 – 11 K 1026/87, EFG 1989, 647; Viskorf, a.a.O., § 4 Rz 36; Hofmann, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 9. Aufl., § 4 Rz 7[↩]