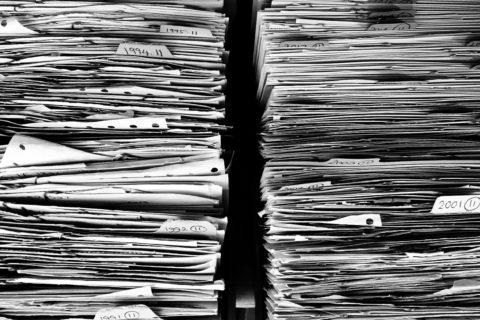Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung geändert: Wer einen Subventionsbetrug begeht oder an einer solchen Tat teilnimmt, haftet nicht nach § 71 AO für die zu Unrecht gewährte Investitionszulage. Ein (danach allein noch in Betracht kommender) deliktischer Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2, § 830 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB i.V.m. § 264 Abs. 1 Nr. 1, § 27 StGB kann nicht mittels eines Haftungsbescheids nach § 191 Abs. 1 AO geltend gemacht werden.

Nach bisheriger Auffassung des Bundesfinanzhofs war auf eine Person, die sich als Gehilfe eines Subventionsbetrugs strafbar gemacht hat, die Haftungsnorm des § 71 AO entsprechend anwendbar. Der Bundesfinanzhof hat dies in seinem zum Investitionszulagengesetz 1982 (InvZulG 1982) ergangenen Urteil vom 27. April 19991 mit der in § 5 Abs. 5 Satz 1 InvZulG 1982 (= § 7 Abs. 1 Satz 1 InvZulG 1993) enthaltenen Gesetzesverweisung begründet, wonach die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der AO entsprechend anwendbar seien. Diese allgemein gehaltene Verweisung auf die AO umfasse auch die Vorschriften über die Haftung (§§ 69 ff. AO). Insbesondere scheitere eine entsprechende Anwendung des § 71 AO nicht daran, dass diese Vorschrift lediglich eine Haftung (u.a.) des Steuerhinterziehers, nicht jedoch des Subventionsbetrügers normiere. Die in der Gesetzesverweisung angeordnete entsprechende Anwendung der Steuervergütungsvorschriften sei vielmehr so zu verstehen, dass der Fall des Subventionsbetruges im Rahmen der Haftung nach § 71 AO abgabenrechtlich wie ein Fall der Steuerhinterziehung zu behandeln sei2. Die Frage einer analogen Rechtsanwendung stelle sich daher nicht.
Die Verwaltung hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen3.
Hieran hält der Bundesfinanzhof nicht mehr fest. Die in § 7 Abs. 1 Satz 1 InvZulG enthaltene (allgemeine) Verweisung, nach der die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden sind, erlaubt es nach ihrem Wortsinn nicht, das auf die „Erschleichung“ einer Investitionszulage gerichtete Verhalten als eine Steuerhinterziehung i.S. des § 71 AO zu behandeln.
Die Investitionszulage ist keine Steuer i.S. des § 3 Abs. 1 AO4. Der Gesetzgeber hat die Investitionszulage materiell-rechtlich auch nicht als eine Steuervergütung ausgestaltet. Es fehlt -anders als z.B. für das Kindergeld (vgl. § 31 Satz 3 EStG) – eine Norm, welche die Investitionszulage als Steuervergütung qualifiziert. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der in den Investitionszulagengesetzen enthaltenen Gesetzesverweisung (z.B. § 5 Abs. 5 Satz 1 InvZulG 1982, § 7 Abs. 1 Satz 1 InvZulG 1993), die eine entsprechende Anwendung der Steuervergütungsvorschriften der AO anordnet. Durch diese Verweisungsnorm wird die Investitionszulage abgabenrechtlich nicht in eine Steuervergütung umqualifiziert, sondern allgemein das Investitionszulageverfahren geregelt5. Demnach hat der Gesetzgeber in Anbetracht des in § 1 Abs. 1 Satz 1 AO geregelten Anwendungsbereichs der AO und des Umstands, dass die Investitionszulage gerade keine Steuervergütung ist, in § 7 Abs. 1 Satz 1 InvZulG 1993 folgerichtig nur eine entsprechende Anwendung der Steuervergütungsvorschriften der Abgabenordnung angeordnet.
Aufgrund dieser Verweisung sind zwar auch die Haftungsnormen der §§ 69 ff. AO entsprechend anwendbar. Nach dem Wortsinn des § 71 AO scheitert dessen Anwendung auf die Investitionszulage aber daran, dass das auf die „Erschleichung“ einer Investitionszulage gerichtete Verhalten strafrechtlich keine Steuerhinterziehung, sondern ein Betrug (§ 263 StGB) bzw. ein Subventionsbetrug (§ 264 StGB) ist6. Auch wenn die Abgrenzung zwischen den unter § 370 AO fallenden Steuern bzw. Steuervorteilen und den von § 264 StGB erfassten Subventionen schwierig sein kann, gehört doch die Investitionszulage zu den Subventionen i.S. des § 264 Abs. 7 StGB und nicht zu den Steuern oder Steuervorteilen7. Abweichendes ergibt sich nicht aus § 370 Abs. 4 Satz 2 AO, wonach auch Steuervergütungen Steuervorteile sind. Die Investitionszulage ist -wie aufgezeigt- materiell-rechtlich gerade keine Steuervergütung. Schließlich lässt sich etwas anderes auch nicht aus § 9 InvZulG 1993 (= § 5a InvZulG 1977/1982/1986) entnehmen, nach dem die Vorschriften der Abgabenordnung über die Verfolgung von Steuerstraftaten entsprechend gelten. Hierdurch werden lediglich die Verfahrensvorschriften der §§ 385 ff. AO einschließlich der Ermittlungszuständigkeit der Finanzbehörden (vgl. § 386 Abs. 2 AO) für anwendbar erklärt8.
Auch die in § 7 Abs. 1 Satz 1 InvZulG 1993 angeordnete „entsprechende“ Anwendung des § 71 AO rechtfertigt es nicht, von dem tatbestandlichen Erfordernis einer Steuerhinterziehung abzusehen oder das auf die „Erschleichung“ einer Investitionszulage gerichtete Verhalten als eine Steuerhinterziehung i.S. des § 71 AO zu behandeln.
Dass es sich hierbei um eine Rechtsgrund- und nicht um eine Rechtsfolgenverweisung handelt, entspricht auch der bisherigen Bundesfinanzhofsrechtsprechung. Ein bloßer Verweis nur auf die Rechtsfolge des § 71 AO könnte schon gar nicht umgesetzt werden, weil der Haftungsumfang im Dunkeln bliebe. Allerdings reicht -entgegen der bisherigen Rechtsprechung- im Zusammenhang mit der Investitionszulage der Subventionsbetrug als Rechtsgrund nicht aus. Eine derartige -auf das Wort „entsprechend“ gestützte- Gesetzesauslegung überspannt den möglichen Wortsinn. Die entsprechende Geltung der Steuervergütungsvorschriften führt zwar -wie bereits erwähnt- dazu, dass die §§ 69 ff. AO dem Grunde nach anwendbar sind. Der Gesetzgeber hat aber bewusst davon abgesehen, im InvZulG -im Gegensatz zu anderen Zulagen- und Prämiengesetzen- auch eine entsprechende Anwendung des § 370 Abs. 1 bis Abs. 4 AO anzuordnen, weil er die Investitionszulage unter den besonderen strafrechtlichen Schutz des § 264 StGB gestellt hat. Hiernach ist § 370 AO auf die Investitionszulage gerade nicht entsprechend anwendbar. Damit wäre jedoch der Wortsinn einer entsprechenden Anwendung überspannt, wollte man die Erschleichung einer Investitionszulage abgabenrechtlich doch wieder wie eine Steuerhinterziehung behandeln.
Die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung des § 71 AO liegen nicht vor.
Eine Analogie würde voraussetzen, dass sich zum einen eine Gesetzeslücke feststellen ließe, zum anderen, dass sich aus dem Gesetzeswortlaut bzw. Gesamtzusammenhang oder aus den Gesetzesmaterialien eindeutig Rechtsprinzipien ergäben, nach denen diese Lücke zu schließen wäre9. Hieran fehlt es.
Ein Prinzip, wonach der im Zusammenhang mit einer Investitionszulage begangene Subventionsbetrug abgabenrechtlich wie eine Steuerhinterziehung zu behandeln ist, ist nicht eindeutig erkennbar. Ein solches Prinzip lässt sich weder § 7 Abs. 1 InvZulG 1993 noch § 9 InvZulG 1993 entnehmen.
§ 9 InvZulG 1993 (= § 5a InvZulG 1977/1982/1986) bestimmt, dass die Vorschriften der Abgabenordnung über die Verfolgung von Steuerstraftaten (§§ 385 ff. AO) entsprechend gelten. Diese Regelung geht auf das Erste Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (1. WiKG)10 zurück, mit dem die Vorschrift des § 264 StGB in das StGB neu eingefügt wurde. Der Gesetzgeber betrachtete die Investitionszulage als eine Subvention i.S. des § 264 StGB und wollte deren Vergabe strafrechtlich besonders schützen11. Da die Investitionszulage von den Finanzbehörden verwaltet wurde, fügte er den § 5a InvZulG neu ein, wonach u.a. für die Verfolgung einer Straftat nach § 264 StGB die Vorschriften der Reichsabgabenordnung vom 23.05.1931 über die Verfolgung von Steuerstraftaten entsprechend gelten. Demnach werden nach § 9 InvZulG 1993 (bzw. § 5a InvZulG 1977) lediglich die Verfahrensvorschriften der §§ 385 ff. AO einschließlich der Ermittlungszuständigkeit der Finanzbehörden (vgl. § 386 Abs. 2 AO) für anwendbar erklärt8. Hieraus lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass der Subventionsbetrug abgabenrechtlich wie eine Steuerhinterziehung zu behandeln ist.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 7 Abs. 1 Satz 1 InvZulG 1993. Diese Vorschrift hat die für den Streitfall maßgebliche Fassung im Kern bereits durch das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO 1977) vom 14.12 197612 erhalten. § 5 Abs. 5 Satz 1 InvZulG 1977 -die Vorgängerregelung zu § 7 Abs. 1 Satz 1 InvZulG 1993- lautete, dass „auf die Investitionszulage die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung … entsprechend anzuwenden“ sind (vgl. Art. 64 Nr. 1 EGAO 1977). Daneben wurde in § 5a InvZulG das Wort „Reichsabgabenordnung“ durch das Wort „Abgabenordnung“ ersetzt (vgl. Art. 64 Nr. 2 EGAO 1977). In den Gesetzesmaterialien heißt es lediglich, dass nunmehr auch für die Investitionszulagen die für die Steuervergütungen geltenden Vorschriften der AO gelten sollen13, ferner, dass sich die Anwendbarkeit der Vorschriften der AO über die Verfolgung von Steuerstraftaten auf die Investitionszulage bereits aus dem durch das 1. WiKG eingefügten § 5a InvZulG ergibt14. Zugleich normierte der Gesetzgeber im EGAO 1977 für andere Zulagen- und Prämien-Gesetze, in denen ebenfalls -wie im InvZulG- die Steuervergütungsvorschriften der AO für entsprechend anwendbar erklärt werden, dass auch § 370 Abs. 1 bis 4 AO entsprechend gilt (z.B. Art. 5 Nr. 5 und 6 EGAO 1977 zum BerlinFG, Art. 50 Nr. 5 EGAO 1977 zum Wohnungsbau-Prämiengesetz, Art. 83 Nr. 1 und 2 EGAO 1977 zum Dritten Vermögensbildungsgesetz). Eine solche Anordnung ist für das InvZulG unterblieben.
Es kann dahinstehen, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen das Finanzgericht im Klageverfahren oder der Bundesfinanzhof im Revisionsverfahren die vom Finanzamt im Haftungsbescheid konkret zugrunde gelegte Haftungsnorm des § 7 Abs. 1 InvZulG 1993 i.V.m. §§ 71, 191 AO durch § 191 Abs. 1 AO i.V.m. § 823 Abs. 2, § 830 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB i.V.m. § 264 Abs. 1 Nr. 1, § 27 StGB hätte austauschen dürfen. Denn dieser ggf. verwirklichte deliktische Schadensersatzanspruch kann nicht durch einen Haftungsbescheid geltend gemacht werden.
Nach § 191 Abs. 1 AO kann derjenige, der kraft Gesetzes für eine Steuer haftet, durch Haftungsbescheid in Anspruch genommen werden. Hiermit ist nicht nur die Haftung für Steuerschulden, sondern generell die Haftung für Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 Abs. 1 AO) gemeint15. Da auf das Investitionszulagenverfahren nach § 7 Abs. 1 InvZulG 1993 die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden sind, ist auch der Anspruch auf Rückzahlung der Investitionszulage wie ein Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis zu behandeln (vgl. § 37 Abs. 1, Abs. 2 AO). Das Haftungsverfahren nach § 191 AO ist daher im Grundsatz auch auf die Investitionszulage anwendbar.
Der zivilrechtliche Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2, § 830 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB i.V.m. § 264 Abs. 1 Nr. 1, § 27 StGB ist jedoch kein gesetzlicher Haftungsanspruch i.S. des § 191 Abs. 1 AO.
Nach ständiger Rechtsprechung können sich gesetzliche Haftungsansprüche i.S. des § 191 AO sowohl aus dem Steuerrecht als auch aus dem Zivilrecht ergeben16. Die Frage, ob auch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche nach § 823 BGB hierunter zu fassen sind, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden.
Soweit sich das Fachschrifttum mit dieser Frage beschäftigt, liefert es kein einheitliches Meinungsbild. Teilweise wird für deliktische Schadensersatzansprüche -ohne nähere Begründung- die Möglichkeit des Erlasses eines Haftungsbescheids bejaht17. Andere vertreten die Auffassung, dass Schadensersatzansprüche gemäß § 823 BGB keine Haftungsansprüche seien und im Zivilrechtswege verfolgt werden müssten18.
Die Gesetzesmaterialien enthalten zu dieser Frage keine ausdrückliche Stellungnahme. Will man diesen jedoch eine Aussage entnehmen, deuten sie eher darauf hin, dass ein zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB wegen einer Schutzgesetzverletzung nicht mittels Haftungsbescheid geltend gemacht werden kann. Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich die Vorschrift des § 191 AO (im Gesetzentwurf § 172) zwar auch auf „die Haftungsvorschriften des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts, soweit sie auch auf Steuerschulden anwendbar sind, wie z.B. § 128 HGB“19. Der Gesetzgeber spricht in diesem Zusammenhang aber von Haftungsvorschriften, nicht von Schadensersatzansprüchen, und verdeutlicht dies anhand § 128 HGB, einer Norm, die als Rechtsfolge das Einstehenmüssen für eine Verbindlichkeit eines Dritten -der offenen Handelsgesellschaft- begründet. In den Gesetzesmaterialien wird von Schadensersatzansprüchen nur in der Begründung zu § 71 AO gesprochen. Dort heißt es, dass Schadensersatzansprüche des Steuergläubigers, soweit sich solche aus der Steuerhinterziehung oder der Steuerhehlerei -etwa aufgrund der Vorschriften über unerlaubte Handlungen ergeben- nicht durch § 71 AO ausgeschlossen werden20. Der Gesetzgeber dürfte daher als zivilrechtliche Haftungsansprüche i.S. des § 191 AO eher solche Vorschriften vor Augen gehabt haben, die auf der Rechtsfolgenseite eine Einstandspflicht für anderweitig entstandene Steuerschulden begründen, wie z.B. die Gesellschafterhaftung nach § 128 HGB oder Vorschriften wie §§ 25 ff. HGB.
Dieser Sichtweise entspricht auch die vom BGH gefundene Auslegung. So hat er in dem Urteil vom 1. Dezember 198821 ausgeführt, dass unter zivilrechtlichen Haftungsansprüchen i.S. des § 191 AO einerseits gesellschaftsrechtliche u.ä. Bestimmungen und andererseits solche Bestimmungen gemeint sind, die wie § 25 HGB oder § 419 BGB für anderweitig entstandene Steuerschulden die Einstandspflicht eines Dritten begründen.
Als maßgeblich für die hier vertretene Ansicht sieht der Bundesfinanzhof jedoch an, dass selbst die abgabenrechtlichen Haftungsnormen, denen nach der Rechtsprechung des BFH Schadensersatzcharakter zukommt, letztlich in ihrer vom Gesetz vorgegebenen abstrakt-generellen Struktur keine Schadensersatznormen sind.
Abgabenrechtliche Haftungsnormen mit Schadensersatzcharakter sind namentlich die §§ 69 und 71 AO22. Insbesondere die Haftung nach § 71 AO und die nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 264 StGB ähneln sich sehr. In beiden Fällen soll gegenüber demjenigen, der eine vorsätzliche Straftat begangen hat, eine Ersatzmöglichkeit bestehen. Unterschiede existieren aber in dem gesetzlich -abstrakt-generell- normierten Haftungsumfang. In Fällen des § 71 AO richtet sich der Haftungsumfang danach, inwieweit das strafrechtlich erhebliche Verhalten für den Steuerausfall23, in Fällen des § 69 AO, inwieweit die Pflichtverletzung für den Steuerausfall ursächlich ist24. Auf diese steuerliche Haftung kann der im zivilrechtlichen Schadensersatzrecht anerkannte Grundsatz des Vorteilsausgleichs ebenso wenig uneingeschränkt übertragen werden wie die Berücksichtigung des Mitverschuldens nach § 254 BGB, eines hypothetischen Kausalverlaufs oder die Lehre vom Schutzzweck der verletzten Norm25. Vielmehr entstehen die Haftungsansprüche nach §§ 69 und 71 AO gemäß § 38 AO, wenn deren Tatbestandsmerkmale erfüllt sind26. Die vorstehend bezeichneten Gesichtspunkte des zivilrechtrechtlichen Schadensersatzrechts haben in den genannten abgabenrechtlichen Haftungsansprüchen keinen Niederschlag gefunden.
Die Ersatzmöglichkeit aus § 823 Abs. 2 BGB führt hingegen zu einem originär zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch. Es mag zwar sein, dass -bei Vergleichbarkeit der Sachverhalte- ein zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch gegen einen Gehilfen eines Subventionsbetrugs nach § 823 Abs. 2, § 830 BGB i.V.m. §§ 264, 27 StGB im Ergebnis auch der Höhe nach zu einer ähnlichen Ersatzmöglichkeit führt wie ein abgabenrechtlicher Haftungsanspruch nach § 71 AO gegen einen Gehilfen einer Steuerhinterziehung, insbesondere unter Berücksichtigung der bei § 191 AO anzustellenden Ermessenserwägungen (§ 5 AO). Entscheidend ist aber, dass der Gesetzgeber die genannten abgabenrechtlichen Haftungsnormen, auch wenn sie Schadensersatzcharakter besitzen, auf der Rechtsfolgenseite abstrakt-generell nicht als Schadensersatzansprüche ausgestaltet hat.
Dass es aufgrund der Sachnähe des Finanzamt als der für die Verwaltung der Investitionszulage (§ 7 Abs. 1 InvZulG 1993) und der für die Verfolgung eines hiermit im Zusammenhang stehenden Subventionsbetrugs (§ 9 InvZulG 1993 i.V.m. § 385 ff. AO) zuständigen Behörde zweckmäßig sein mag, dem Finanzamt auch die Möglichkeit des Erlasses eines Haftungsbescheids einzuräumen, ändert an dem gefundenen Ergebnis nichts.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 19. Dezember 2013 – III R 25/10
- BFH, Urteil vom 27.04.1999 – III R 21/96, BFHE 189, 255, BStBl II 1999, 670[↩]
- vgl. auch BFH, Urteil vom 28.08.1997 – III R 3/94, BFHE 183, 324, BStBl II 1997, 827, zur Investitionszulage nach dem Berlinförderungsgesetz -BerlinFG- wegen verlängerter Festsetzungsverjährung[↩]
- BMF, Schreiben vom 28.06.2001, BStBl I 2001, 379, Tz. 188[↩]
- Musil in HHSp, § 1 AO Rz 23[↩]
- ebenso BGH, Urteil vom 06.06.2007 – 5 StR 127/07, HFR 2007, 1157, zur Eigenheimzulage[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 07.02.1984 – 1 StR 10/83, HFR 1984, 391[↩]
- vgl. auch Perron in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 28. Aufl., § 264 Rz 10 a.E.[↩]
- ebenso BGH, Urteil in HFR 2007, 1157, zur Eigenheimzulage[↩][↩]
- BFH, Urteil vom 14.02.2007 – II R 66/05, BFHE 217, 176, BStBl II 2007, 621, m.w.N.[↩]
- vom 29.07.1976, BGBl I 1976, 2034[↩]
- BT-Drs. 7/3441, S. 48, BT-Drs. 7/5291, S. 24[↩]
- BGBl I 1976, 3341[↩]
- BT-Drs. 7/261, S. 54[↩]
- BT-Drs. 7/5458, S.20[↩]
- Boeker in HHSp, § 191 AO Rz 16[↩]
- ständige Rechtsprechung, z.B. BFH, Urteile vom 23.10.1985 – VII R 187/82, BFHE 145, 13, BStBl II 1986, 156; vom 09.05.2006 – VII R 50/05, BFHE 213, 194, BStBl II 2007, 600[↩]
- Loose in Tipke/Kruse, § 71 AO Rz 5, § 191 AO Rz 6; Halaczinsky, Die Haftung im Steuerrecht, 4. Aufl., Rz 590[↩]
- Nacke, Die Haftung für Steuerschulden, 3. Aufl., Rz 165[↩]
- BT-Drs. VI/1982, S. 159[↩]
- BT-Drs. VI/1982, S. 120[↩]
- BGH, Urteil vom 01.12 1988 – IX ZR 61/88, BGHZ 106, 134[↩]
- BFH, Urteile vom 26.09.2012 – VII R 3/11, BFH/NV 2013, 337, zu § 71 AO; vom 11.11.2008 – VII R 19/08, BFHE 223, 303, BStBl II 2009, 342, zu § 69 AO[↩]
- BFH, Urteil in BFH/NV 2013, 337[↩]
- BFH, Urteil vom 05.09.1989 – VII R 61/87, BFHE 158, 13, BStBl II 1989, 979[↩]
- vgl. BFH, Urteile in BFH/NV 2013, 337, m.w.N.; vom 05.06.2007 – VII R 65/05, BFHE 217, 233, BStBl II 2008, 273[↩]
- vgl. BFH, Urteil in BFH/NV 2013, 337[↩]