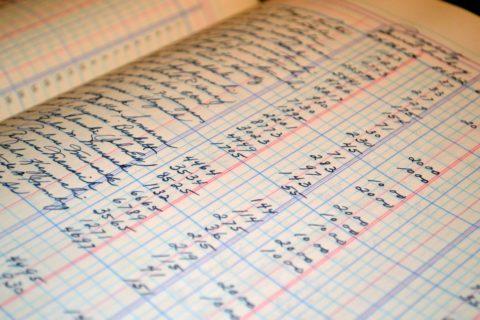Eine Holdinggesellschaft, die nachhaltig Leistungen gegen Entgelt erbringt, ist wirtschaftlich tätig und insoweit Unternehmer. Verfügt die Holding über umfangreiche Beteiligungen, die sie ohne Bezug zu ihren entgeltlichen Ausgangsleistungen hält, ist sie entsprechend § 15 Abs. 4 UStG nur insoweit zum Vorsteuerabzug berechtigt, als die Eingangsleistungen ihren entgeltlichen Ausgangsleistungen wirtschaftlich zuzurechnen sind. Eine Holdinggesellschaft, deren Hauptzweck das Halten von Beteiligungen ist und die entgeltliche Leistungen nur als Nebenzweck erbringt, kann höchstens zum hälftigen Vorsteuerabzug aus den Gemeinkosten berechtigt sein.

Der Anspruch auf Vorsteuerabzug bei Holdinggesellschaften ist seit Jahren im Streit. Im Ausgangspunkt ist das Halten von Beteiligungen keine wirtschaftliche Tätigkeit und unterliegt deshalb nicht der Umsatzsteuer. Folglich stellte sich die Frage, in welchem Umfang die Vorsteuer aus den Gemeinkosten auf diese nicht wirtschaftliche Tätigkeit entfällt und deshalb (teilweise) nicht abzugsfähig ist. Holdinggesellschaften, die neben dem Halten von Beteiligungen auch entgeltliche Dienstleistungen erbringen, gingen gleichwohl davon aus, zum uneingeschränkten Vorsteuerabzug berechtigt zu sein.
Der jetzt vom Bundesfinanzhof entschiedene Streitfall betraf eine Holdinggesellschaft, die über einen umfangreichen Beteiligungsbesitz verfügte und daneben auch entgeltliche Dienstleistungen erbrachte. Das Finanzamt hatte der Holding einen Vorsteuerabzug von 75% aus den Gemeinkosten zugebilligt. Die Klage, mit der die Holding den vollen Vorsteuerabzug begehrte, hatte keinen Erfolg.
Der Unternehmer ist nach § 15 UStG 1999 zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Eingangsleistungen für Zwecke seines Unternehmens und damit für seine wirtschaftliche Tätigkeit bezieht.
Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen. Ausgeschlossen ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG für Leistungen, die der Unternehmer für steuerfreie Umsätze verwendet. Diese Vorschriften beruhen auf Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG, wonach der Steuerpflichtige (Unternehmer), der Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet, befugt ist, die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden, von der von ihm geschuldeten Steuer abzuziehen.
Der Unternehmer ist nach diesen Vorschriften zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen für sein Unternehmen (§ 2 Abs. 1 UStG, Art. 4 der Richtlinie 77/388/EWG) und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbringung entgeltlicher Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 77/388/EWG) zu verwenden beabsichtigt. Im Hinblick auf den weiter erforderlichen direkten und unmittelbaren Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsumsatz ist dabei wie folgt zu differenzieren1.
Besteht der direkte und unmittelbare Zusammenhang zu einem einzelnen Ausgangsumsatz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit, der steuerpflichtig ist (gleichgestellt: Umsatz i.S. von § 15 Abs. 3 UStG und Art. 17 Abs. 3 der Richtlinie 77/388/EWG), kann der Unternehmer den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen. Die für den Leistungsbezug getätigten Aufwendungen gehören dann zu den Kostenelementen dieses Ausgangsumsatzes.
Bei einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang zu einem Ausgangsumsatz, der mangels wirtschaftlicher Tätigkeit nicht dem Anwendungsbereich der Steuer unterliegt oder ohne Anwendung von § 15 Abs. 3 UStG (Art. 17 Abs. 3 der Richtlinie 77/388/EWG)- steuerfrei ist, besteht keine Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Dies gilt auch, wenn der Unternehmer eine Leistung z.B. für einen steuerfreien Ausgangsumsatz bezieht, um mittelbar seine zum Vorsteuerabzug berechtigende wirtschaftliche Gesamttätigkeit zu stärken, da der von ihm verfolgte endgültige Zweck unerheblich ist.
Fehlt ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren Ausgangsumsätzen, kann der Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wenn die Kosten für die Eingangsleistung zu seinen allgemeinen Aufwendungen gehören und als solche- Bestandteile des Preises der von ihm erbrachten Leistungen sind. Derartige Kosten hängen direkt und unmittelbar mit seiner wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zusammen und berechtigen nach Maßgabe dieser Gesamttätigkeit zum Vorsteuerabzug.
Beabsichtigt der Unternehmer eine von ihm bezogene Leistung zugleich für seine wirtschaftliche und seine nichtwirtschaftliche Tätigkeit zu verwenden, kann er den Vorsteuerabzug grundsätzlich nur insoweit in Anspruch nehmen, als die Aufwendungen hierfür seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen sind. Beabsichtigt der Unternehmer daher eine teilweise Verwendung für eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit, ist er insoweit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt2. Bei der dann erforderlichen Vorsteueraufteilung für Leistungsbezüge, die einer wirtschaftlichen und einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmers dienen, ist § 15 Abs. 4 UStG analog anzuwenden3.
Im hier entschiedenen Fall steht der Holding steht kein weiter gehender Anspruch auf Vorsteuerabzug als vom Finanzamt anerkannt zu.
Im Streitfall war die Holding sowohl wirtschaftlich (unternehmerisch) als auch nichtwirtschaftlich (nichtunternehmerisch) tätig.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind der bloße Erwerb, das bloße Halten und der bloße Verkauf von Aktien an sich keine wirtschaftlichen Tätigkeiten, da diese Vorgänge nicht die Nutzung eines Gegenstands zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen beinhalten und das einzige Entgelt in einem etwaigen Gewinn beim Verkauf dieser Aktien liegt. Demgegenüber fallen nur Zahlungen, die die Gegenleistung für einen Umsatz oder eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellen, in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer, was aber auf Zahlungen nicht zutrifft, die auf dem bloßen Eigentum an einem Gegenstand beruhen, wie dies bei Dividenden oder anderen Erträgen von Aktien der Fall ist4.
Anders ist es aber dann, wenn die finanzielle Beteiligung an einem anderen Unternehmen mit unmittelbaren oder mittelbaren Eingriffen in die Verwaltung der Gesellschaft einhergeht, an der die Beteiligung besteht, soweit diese Eingriffe zu entgeltlichen Leistungen führen, die gemäß Art. 2 der Richtlinie 77/388/EWG der Mehrwertsteuer unterliegen oder wenn sich auf Aktien oder Anteile an einer Gesellschaft beziehende Umsätze in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fallen, da sie im Rahmen des gewerbsmäßigen Wertpapierhandels oder zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren Eingreifens in die Verwaltung der Gesellschaften erfolgen, an denen die Beteiligung besteht, oder wenn sie eine unmittelbare, dauerhafte und notwendige Erweiterung einer steuerbaren Tätigkeit darstellen5.
Danach beschränkte sich die wirtschaftliche Tätigkeit der Holding im Streitfall auf die Erbringung entgeltlicher „Beratungsleistungen“ an zwei Tochtergesellschaften sowie ggf. die Überlassung eines PKWs an einen Arbeitnehmer im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes. Selbst wenn zugunsten der Holding unterstellt wird, dass auch die Darlehensvergabe durch die Holding an die I-Inc. unter Berücksichtigung des EDM-Urteils des EuGH6 als nachhaltige und wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Unternehmens anzusehen sein könnte, kommt der wirtschaftlichen (unternehmerischen) Tätigkeit der Holding im Vergleich zu ihrem nichtwirtschaftlichen (nichtunternehmerischen) Beteiligungsbereich, den die Holding in ihrer Bilanz zum 31.12.2004 mit ca. 99 Mio. EUR aktiviert hatte, nur untergeordnete Bedeutung zu. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Holding die ca. 50 von ihr gehaltenen Beteiligungen mit Ausnahme ggf. der Beteiligungen an den beiden Gesellschaften, an die sie entgeltliche Leistungen erbrachte- im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit gehalten hat.
Bei der somit im Streitfall erforderlichen Vorsteueraufteilung für Leistungsbezüge, die einer wirtschaftlichen und einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmers dienen, ist § 15 Abs. 4 UStG analog anzuwenden3. Im Rahmen der danach maßgeblichen wirtschaftlichen Zurechnung aufgrund sachgerechter Schätzung stand der Holding jedenfalls kein weiter gehender Anspruch auf Vorsteuerabzug als vom Finanzamt anerkannt zu.
Das Finanzgericht hat für sein Urteil angeführt, dass ein Vorsteuerabzug nur insoweit in Betracht komme, als die Entgelte für Eingangsleistungen die Entgelte für Ausgangsleistungen nicht überstiegen, sofern nicht festzustellen sei, dass Eingangsleistungen wie z.B. bei Immobilieninvestitionen mit nachfolgenden Vermietungsumsätzen- erst in Folgejahren für Ausgangsleistungen verwendet würden. Bei einem Gesamtentgelt von 573.652 EUR ergebe sich danach eine Obergrenze für den Vorsteuerabzug von 91.784,32 EUR, die hinter dem vom Finanzamt anerkannten Vorsteuerabzug von 107.758,19 EUR zurückbleibe.
Im Streitfall kann offen bleiben, ob der Auffassung des Finanzgericht, nach der die Steuer auf Leistungsentgelte eine Obergrenze für den Vorsteuerabzug darstellt, sofern keine Investitions- oder Fehlmaßnahmen vorliegen, zu folgen ist.
Die Würdigung des Finanzgericht, dass der Holding ein nur geringerer Vorsteuerabzug als vom Finanzamt anerkannt aus den Gemeinkosten zusteht, ist aufgrund der Besonderheiten des Streitfalls im Ergebnis revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Denn nach den Verhältnissen des Streitfalls ist davon auszugehen, dass das nichtwirtschaftliche Halten von Beteiligungen die Haupttätigkeit und das Erbringen entgeltlicher Leistungen nur eine Nebentätigkeit der Holding war. Hierfür spricht insbesondere das Verhältnis der Leistungsentgelte von 573.652 EUR zu den bilanzierten Beteiligungswertansätzen von ca. 99 Mio. EUR, wie auch ein Vergleich zwischen den Leistungsentgelten und den mehr als fünffach höheren vorsteuerbelasteten und nicht vorsteuerbelasteten Aufwendungen der Holding im Streitjahr. Unter Berücksichtigung von Haupt- und Nebentätigkeit der Holding kommt im Streitfall allenfalls ein hälftiger Vorsteuerabzug aus den Gemeinkosten in Betracht. Danach war die vom Finanzamt vorgenommene Schätzung einer Vorsteuerquote von 75 v.H. nicht sachgerecht, sondern führte zu einem überhöhten Vorsteuerabzug der Holding.
Im Hinblick auf diesen überhöht gewährten Vorsteuerabzug aus den Gemeinkosten kam es auf die Frage, ob die Holding aus den möglicherweise- an die I-Inc. weiterbelasteten Kosten der Beteiligungsveräußerung durch die I-Inc. zu einem weiteren Vorsteuerabzug von 1.957,82 EUR berechtigt war, nicht mehr an. Im Hinblick auf das Verböserungsverbot und die Bindung an die Anträge (§ 96 Abs. 1 Satz 2 FGO) kann offen bleiben, in welcher Höhe im Streitfall ein anteiliger Vorsteuerabzug das Verhältnis zwischen wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tätigkeit objektiv widerspiegelt.
Im Streitfall bedarf es keines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH gemäß Art. 267 AEUV. Im Gegensatz zur vom EuGH entschiedenen Rechtssache Cibo Participations7 betrifft der Streitfall keine Holding, die gegenüber allen Tochtergesellschaften entgeltliche Leistungen erbrachte. Demgegenüber führte die Holding derartige Leistungen im Streitjahr nur gegenüber zwei von insgesamt ca. 50 Tochtergesellschaften aus. Darüber hinaus ist im Streitfall der Vorsteuerabzug aus Gemeinkosten, nicht aber der Vorsteuerabzug aus Kosten für den Erwerb von Beteiligungen streitig. Im Übrigen kommt es auch nicht auf den Ausgang der beim EuGH anhängigen Rechtssache Portugal-Telekom8 an. In diesem Verfahren ist zu klären, ob der Hauptgesellschaftszweck einer Holdinggesellschaft, der in der Verwaltung von Gesellschaftsanteilen besteht, dazu führt, dass die Holding den Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen, die sie für eine Nebentätigkeit (Erbringung entgeltlicher Dienstleistungen) bezieht, nur im Rahmen eines prorata-Satzes abziehen kann. Für die Frage des hier streitigen Vorsteuerabzugs aus Gemeinkosten ist dies nicht von Bedeutung.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 9. Februar 2012 – V R 40/10
- BFH, Urteile vom 09.12.2010 – V R 17/10, BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, unter II.01.b; vom 13.01.2011 – V R 12/08, BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, unter II.01.b, und vom 27.01.2011 – V R 38/09, BFHE 232, 278, BStBl II 2012, 68, unter II.02.b, m.w.N. zu den Urteilen des EuGH vom 06.04.1995 – C-4/94, BLP, Slg.1995, I-983; vom 08.06.2000 – C-98/98, Midland Bank, Slg.2000, I-4177; vom 22.02.2001 – C-408/98, Abbey National, Slg.2001, I-1361; vom 13.03.2008 – C-437/06, Securenta, Slg.2008, I-1597; und vom 29.10.2009 – C-29/08, SKF, Slg.2009, I-10413; sowie BFH, Urteil vom 03.03.2011 – V R 23/10, BFHE 233, 274, BStBl II 2012, 74, unter II.01.a[↩]
- BFH, Urteile in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, unter II.01.d; in BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, unter II.01., m.w.N. zu EuGH, Urteile Securenta in Slg.2008, I-1597, und vom 12.02.2009 – C-515/07, VNLTO, Slg.2009, I-839; sowie BFH, Urteil in BFHE 233, 274, BStBl II 2012, 74, unter II.01.c[↩]
- BFH, Urteil in BFHE 233, 274, BStBl II 2012, 74, Leitsatz 4[↩][↩]
- EuGH, Urteil SKF in Slg.2009, I-10413 Rdnrn. 28 f., m.w.N. zur EuGH-Rechtsprechung[↩]
- EuGH, Urteil SKF in Slg.2009, I-10413 Rdnrn. 30 f., m.w.N. zur EuGH-Rechtsprechung[↩]
- EuGH, Urteil vom 29.04.2004 – C-77/01, EDM, Slg.2004, I-4295 Rdnrn. 65 ff.[↩]
- EuGH, Urteil vom 27.09.2001 – C-16/00, Slg.2001, I-6663[↩]
- EuGH – C-496/11[↩]