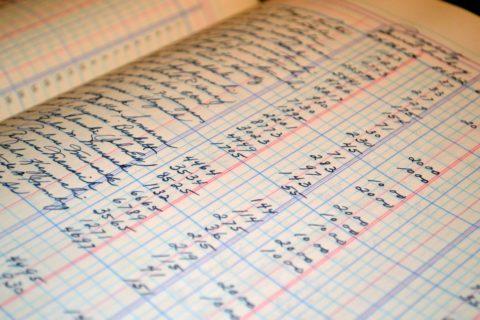Die vom Leasingnehmer an den Leasinggeber gezahlten Entgelte für die Freistellung von der Haftung für die unverschuldete oder fahrlässige Beschädigung oder Zerstörung des Leasingguts sind kein Versicherungsentgelt im Sinne des § 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 VersStG.

Der Versicherungsteuer unterliegt nach Maßgabe des § 1 VersStG die Zahlung des Versicherungsentgelts aufgrund eines durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandenen Versicherungsverhältnisses. Unter dem Versicherungsverhältnis sind das durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandene Rechtsverhältnis des einzelnen Versicherungsnehmers zum Versicherer und seine Wirkungen zu verstehen1, wobei wesentliches Merkmal für ein solches „Versicherungsverhältnis“ im Sinne des § 1 Abs. 1 VersStG das Vorhandensein eines vom Versicherer gegen Entgelt übernommenen Wagnisses ist2. Versicherungsentgelt ist gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 VersStG jede Leistung, die für die Begründung und zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses an den Versicherer zu bewirken ist. Zahlung des Versicherungsentgelts ist danach jede Leistung, die die Schuld des Versicherungsnehmers gegenüber dem Versicherer erlöschen lässt3; denn Gegenstand der Besteuerung ist wegen des Charakters der Versicherungsteuer als Verkehrsteuer nicht das Versicherungsverhältnis als solches4, sondern die Zahlung des Versicherungsentgelts durch den Versicherungsnehmer, d.h. durch den zur Zahlung Verpflichteten.
Die im Streitfall von den Leasingnehmern für die Haftungsfreistellung durch die „Dienstleistungsvereinbarung Haftungsbefreiung mit Eigenanteil“ aufgewendeten Beträge erfüllen nicht die Merkmale eines Versicherungsentgelts im Sinne des § 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 VersStG, weil es an der Übernahme eines ansonsten die Leasingnehmer treffenden Wagnisses durch die Leasinggeberin fehlt.
Es steht einem Leasinggeber grundsätzlich frei, einerseits das Risiko des zufälligen Untergangs des überlassenen Fahrzeugs und seiner fest eingebauten, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Teile und andererseits dasjenige der Beschädigung, der Zerstörung oder des Verlusts des jeweils überlassenen Fahrzeugs und seiner fest eingebauten Teile aufgrund fahrlässigen Verhaltens des Leasingnehmers selbst zu tragen und sich dies durch ein vom Leasingnehmer (zusätzlich) zu entrichtendes Leasingentgelt wirtschaftlich ausgleichen zu lassen.
Soweit beim Leasinggeber das Risiko der Beschädigung, der Zerstörung oder des Verlusts des jeweils überlassenen Fahrzeugs und seiner fest eingebauten, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Teile ohne Verschulden des Leasingnehmers verbleibt, trägt er lediglich das ihn als Eigentümer des Fahrzeugs ohnehin treffende Sachrisiko. Substanzbeeinträchtigungen des Leasingguts durch zufälligen Untergang oder zufällige Verschlechterung trägt nämlich grundsätzlich der Rechtsinhaber, also der Leasinggeber5.
Zwar ist es in der Leasingpraxis üblich, dass der Leasinggeber das vorgenannte Sachrisiko in AGB bzw. Einzelverträgen auf den Leasingnehmer überwälzt. Dies entspricht, wie der Bundesgerichtshof wiederholt entschieden hat6, den Besonderheiten des Finanzierungsleasings; die Überwälzung der Sachgefahr scheitert nicht an § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Dies beruht nicht zuletzt auf der Erwägung, dass sich der Leasingnehmer, wenn auch auf eigene Kosten, gegen die hiermit zusammenhängenden Risiken durch den Abschluss einer Sachversicherung in Form einer Objektversicherung für fremde Rechnung des Leasinggebers nach §§ 74 ff. VVG absichern kann7.
Es steht dem Leasinggeber als Rechtsinhaber allerdings frei, auf die Überwälzung des vorgenannten Sachrisikos auf den Leasingnehmer zu verzichten. Dies folgt bereits daraus, dass sich die Überwälzung des Sachrisikos als Ausnahme von der nach dem allgemeinen Zivilrecht geltenden Risikoverteilung darstellt. Verzichtet der Leasinggeber auf diese Überwälzung, so trägt er ein ihn nach dem Gesetz selbst treffendes Risiko (Eigenrisiko) und kein fremdes Wagnis. Auch wenn sich der Leasinggeber den Verzicht auf die allgemein übliche Risikoabwälzung durch gesondert ausgewiesene Beiträge bezahlen lässt, fehlt es deshalb an dem ein Versicherungsverhältnis konstituierenden Merkmal.
Nichts anderes gilt, soweit der Leasinggeber gegen zusätzliches Entgelt das Risiko der Zerstörung oder des Verlusts des jeweils überlassenen Fahrzeugs und seiner fest eingebauten Teile aufgrund fahrlässigen Verhaltens des Leasingnehmers trägt. Beruht die Zerstörung oder Beschädigung bzw. der Verlust eines Fahrzeugs auf einem Umstand, den der Leasingnehmer selbst zu vertreten hat, so stehen dem Leasinggeber zwar gegen den Leasingnehmer nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen Leistungs- und Schadensersatzansprüche zu8. Es steht dem Leasinggeber aufgrund seiner Eigentümerstellung aber frei, mit dem Leasingnehmer einen Leasingvertrag unter Ausschluss der gesetzlichen Haftung für fahrlässiges Verhalten des Leasingnehmers abzuschließen und insoweit von sonst üblichen Vertragsgestaltungen abzuweichen. Kraft einer solchen Vereinbarung trägt der Leasinggeber kein fremdes, sondern ein eigenes Risiko. Auch insoweit fehlt es an der für die Annahme eines Versicherungsverhältnisses erforderlichen Übernahme eines fremden Wagnisses. Denn eine Risikotragung durch den Leasingnehmer wird von Anfang an ausgeschlossen. Die Gefahr einer Inanspruchnahme des Leasingnehmers kann erst gar nicht entstehen.
Den Vertragsparteien eines Leasingvertrags steht es im Übrigen auch frei, die vereinbarte Risikotragung während der Laufzeit des Leasingvertrags durch Vertragsänderung mit Wirkung für die Zukunft neu zu regeln. Dies folgt aus dem Charakter des Leasingvertrags als Dauerschuldverhältnis. Entsprechend ist es möglich, etwa die zunächst vereinbarte Risikotragung durch den Leasingnehmer dahingehend vertraglich abzuändern, dass nunmehr der Leasinggeber die entsprechenden Risiken –ggf. gegen erhöhtes Leasingentgelt– tragen soll.
Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen hat die Leasinggesellschaft, soweit sie mit ihren Kunden die „Dienstleistungsvereinbarung Haftungsbefreiung mit Eigenanteil“ abgeschlossen hat, sowohl für den Fall des zufälligen Untergangs des jeweils überlassenen Fahrzeugs und seiner fest eingebauten, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Teile als auch für den Fall der Beschädigung, der Zerstörung oder des Verlusts des jeweils überlassenen Fahrzeugs und seiner fest eingebauten Teile aufgrund fahrlässigen Verhaltens des Leasingnehmers eine Risikotragung durch den jeweiligen Leasingnehmer von vornherein ausgeschlossen.
Soweit die Klägerin Neuverträge abgeschlossen hat, wird zwar durch § 8 der Anlage 1 zum Rahmenvertrag das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Fahrzeugs auf den Leasingnehmer abgewälzt. Diese Vereinbarung wird aber durch den gleichzeitigen Abschluss der „Dienstleistungsvereinbarung“ und der darin enthaltenen gegenläufigen Vereinbarung („abweichend von §§ 8, 10 der Anlage 1 des Rahmenvertrags“) von Anfang an suspendiert. Die Risikoabwälzung im Rahmenvertrag soll im Falle des Abschlusses der „Dienstleistungsvereinbarung“ erkennbar keine Anwendung finden. Rahmenvertrag und „Dienstleistungsvereinbarung“ sind deshalb keine getrennt zu sehenden Vereinbarungen, sondern stellen eine rechtliche Einheit dar, die zivilrechtlich eine Auslegung dahingehend ausschließt, dass die Leasingnehmer zunächst das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Fahrzeugs übernommen und dieses sodann durch Abschluss eines weiteren selbständigen Vertrags bei der Klägerin versichert haben. Angesichts des Umstandes, dass sämtliche Vereinbarungen bei Neuverträgen zeitgleich geschlossen werden und in Kraft treten und deshalb der Leasingnehmer zu keinem Zeitpunkt das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Fahrzeugs tatsächlich trägt, widerspräche eine andere Auslegung der Interessenlage der Beteiligten.
Auch das Risiko des fahrlässigen Untergangs oder der fahrlässigen Beschädigung des Fahrzeugs sollte von Anfang an von der Leasinggesellschaft als Eigentümerin und Leasinggeberin und nicht von den Leasingnehmern getragen werden. Rahmenvertrag und „Dienstleistungsvereinbarung“ stellen auch insoweit eine rechtlich einheitliche Vereinbarung dar, die als Ganzes darauf abzielt, die Haftung des Leasingnehmers auch für den fahrlässigen Untergang oder die fahrlässige Beschädigung des Fahrzeugs von vornherein auszuschließen. Der Annahme, dass die Leasingnehmer zunächst ein Risiko getragen und dieses durch Abschluss der „Dienstleistungsvereinbarung“, eines weiteren selbständigen Vertrags, bei der Klägerin versichert haben könnten, steht im Übrigen entgegen, dass die vertraglichen Vereinbarungen regelmäßig vor der Übernahme des Fahrzeugs durch den Leasingnehmer abgeschlossen werden. Ein den Leasingnehmer treffendes Risiko kann sich aber vor der tatsächlichen Fahrzeugübernahme nicht realisieren und daher auch nicht aufgrund der „Dienstleistungsvereinbarung“ von der Leasinggeberin gegen Entgelt übernommen worden sein.
Soweit die Leasinggesellschaft mit Kunden, welche bereits einen Leasingvertrag abgeschlossen hatten, nachträglich die „Dienstleistungsvereinbarung“ vereinbart hat, gilt nichts anderes. Den Vertragsbeteiligten stand es insoweit frei, die zunächst vereinbarte Risikoverteilung vertraglich abzuändern. Risiken, die vor dem Inkrafttreten der Vertragsänderung durch Vereinbarung der „Dienstleistungsvereinbarung“ eingetreten waren, waren noch nach den zuvor geltenden Vereinbarungen abzuwickeln. Nach Inkrafttreten der „Dienstleistungsvereinbarung“ eintretende Risiken hatte alleine die Leasinggesellschaft zu tragen.
Dass die Leasinggesellschaft für die Entlassung der Leasingnehmer aus deren Haftung ein Entgelt verlangt und sich für den Leasingnehmer der Abschluss einer Vollkaskoversicherung erübrigt, begründet nicht die entgeltliche Übernahme eines fremden Risikos. Insoweit mag die „Dienstleistungsvereinbarung“ zwar wirtschaftlich einer Kaskoversicherung ähneln. Da aber die Versicherungsteuer eine Verkehrsteuer auf den rechtlich erheblichen Vorgang des Geldumsatzes ist9, kommt es alleine auf eine rechtliche Betrachtung an. Danach handelt es sich bei der Haftungsfreistellung gegen Entgelt lediglich um die Ausgestaltung des Leasingvertrags und nicht um die Begründung eines Versicherungsverhältnisses.
Den von der Leasinggesellschaft aufgrund der „Dienstleistungsvereinbarung“ erbrachten Schadensleistungen kann im Übrigen auch unter dem Gesichtspunkt der fehlenden gemeinsamen Risikotragung nicht die Eigenschaft eines Versicherungsentgelts zukommen. Der von ihr aus eigenem Vermögen zu bewirkende Schadensausgleich kommt einer „Eigendeckung“ gleich, die als Nichtversicherung keine Versicherungsteuerpflicht auslöst10.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 8. Dezember 2010 – II R 21/09
- BFh, Urteile vom 30.08.1961 – II 234/58 U, BFHE 73, 628, BStBl III 1961, 494; vom 29.04.1964 – II 187/60 U, BFHE 79, 510, BStBl III 1964, 417; vom 05.02.1992 – II R 93/88, BFH/NV 1993, 68; vom 16.12.2009 – II R 44/07, BFHE 228, 285, BStBl II 2010, 1097[↩]
- BFH, Urteile vom 15.07.1964 – II 147/61, HFR 1965, 85; vom 29.11.2006 – II R 78/04, BFH/NV 2007, 513; in BFHE 228, 285, BStBl II 2010, 1097[↩]
- BFH, Urteil vom 20.04.1977 – II R 47/76, BFHE 122, 559, BStBl II 1977, 748[↩]
- Begründung zum VersStG 1937, RStBl 1937, 839[↩]
- von Westphalen, Der Leasingvertrag, 6. Aufl., 2008, Kap. I Rz 2; Beckmann/Kügel in Büschgen, Praxishandbuch Leasing, 1998, § 6 Rz 157 sowie Berninghaus, ebenda, § 15 Rz 16 zum Kfz-Leasing[↩]
- vgl. die Nachweise in BGH, Urteil vom 30.09.1987 – VIII ZR 226/86, BB 1987, 2260[↩]
- vgl. von Westphalen, a.a.O., Kap. I Rz 10 ff.; Ackermann in Martinek/Stoffels/Wimmer-Leonhardt, Handbuch des Leasingrechts, 2. Aufl., 2008, § 31 Rz 26 f.[↩]
- vgl. Ackermann, a.a.O., § 33 Rz 8; von Westphalen, a.a.O., Kap. I Rz 32 und 33[↩]
- vgl. BFH, Urteil in BFHE 228, 285, BStBl II 2010, 1097[↩]
- vgl. zuletzt BFH, Urteil in BFHE 228, 285, BStBl II 2010, 1097[↩]