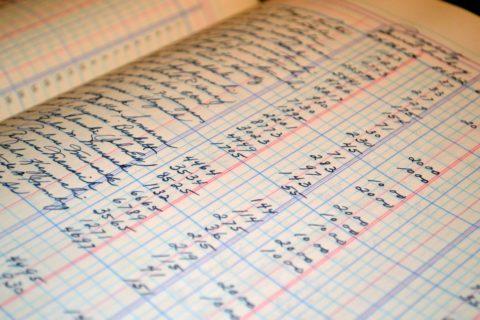Die Vorschrift des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, nach der der Unternehmer die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unternehmen als Vorsteuer abziehen kann, gilt bei richtlinienkonformer Auslegung nicht für den Fall, dass der Unternehmer im Mitgliedstaat der Identifizierung mehrwertsteuerpflichtig ist, weil er die Besteuerung des fraglichen innergemeinschaftlichen Erwerbs im Mitgliedstaat der Beendigung des Versands oder der Beförderung nicht nachgewiesen hat.

Ein innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt setzt gemäß § 1a Abs. 1 UStG u.a. voraus, dass ein Gegenstand bei einer Lieferung an den Abnehmer (Erwerber) aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates gelangt, der Erwerber ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt, und die Lieferung an den Erwerber durch einen Unternehmer gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausgeführt wird. Diese Regelung beruht auf Art. 28a Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG). Danach unterliegt der Mehrwertsteuer unter weiteren Voraussetzungen u.a. auch der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen, der gegen Entgelt im Inland durch einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, bewirkt wird, wenn der Verkäufer ein Steuerpflichtiger ist, der als solcher handelt und für ihn die Steuerbefreiung für Kleinunternehmen gemäß Art. 24 der Richtlinie 77/388/EWG nicht gilt.
Der innergemeinschaftliche Erwerb wird zwar gemäß § 3d Satz 1 UStG grundsätzlich auf dem Gebiet des Mitgliedstaates bewirkt, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet. Verwendet der Erwerber gegenüber dem Lieferer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet, erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, gilt der Erwerb gemäß § 3d Satz 2 UStG solange im Gebiet dieses Mitgliedstaates als bewirkt, bis der Erwerber nachweist, dass der Erwerb durch den in § 3d Satz 1 UStG bezeichneten Mitgliedstaat besteuert worden ist oder nach den Bestimmungen über innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte gemäß § 25b Abs. 3 UStG als besteuert gilt, sofern der erste Abnehmer nach § 18a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 –seit 1. Juli 2010 § 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4– UStG seiner Erklärungspflicht hierüber nachgekommen ist.
Diese Regelung steht im Einklang mit Art. 28b Teil A der Richtlinie 77/388/EWG. Als Ort eines innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen gilt der Ort, in dem sich die Gegenstände zum Zeitpunkt der Beendigung des Versands oder der Beförderung an den Erwerber befinden (Art. 28b Teil A Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG). Als Ort eines innergemeinschaftlichen Erwerbs gilt jedoch unbeschadet der Regelung in Art. 28b Teil A Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG das Gebiet des Mitgliedstaates, der dem Erwerber die von ihm für diesen Erwerb verwendete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat, sofern der Erwerber nicht nachweist, dass dieser Erwerb nach Maßgabe der Regelung in Art. 28b Teil A Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG besteuert worden ist (Art. 28b Teil A Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG). Wird der Erwerb nach Art. 28b Teil A Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG im Mitgliedstaat der Beendigung des Versands oder der Beförderung der Gegenstände besteuert, nachdem er nach Maßgabe des Art. 28b Teil A Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG besteuert wurde, so wird die Besteuerungsgrundlage in dem Mitgliedstaat, der dem Erwerber die von ihm für diesen Erwerb verwendete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat, entsprechend verringert (Art. 28b Teil A Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG).
Der Unternehmer kann gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unternehmen als Vorsteuerbetrag abziehen. Diese Regelung entspricht Art. 17 Abs. 2 Buchst. d i.V.m. Art. 28a Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG und setzt diese unionsrechtliche Bestimmung in nationales Recht um. Das Recht auf Vorsteuerabzug ist zwar ein grundlegendes Prinzip des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems und kann grundsätzlich nicht eingeschränkt werden1. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat aber entschieden, dass der Erwerber in dem in Art. 28b Teil A Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG genannten Fall, dass er im Mitgliedstaat der Identifizierung mehrwertsteuerpflichtig ist, weil er die Besteuerung der fraglichen innergemeinschaftlichen Erwerbe im Mitgliedstaat der Beendigung der Versendung oder Beförderung nicht nachgewiesen hat, nicht zum sofortigen Abzug der auf einen innergemeinschaftlichen Erwerb entrichteten Mehrwertsteuer als Vorsteuer berechtigt ist2.
Der deutsche Unternehmer kann nicht geltend machen, dass das nationale Recht in Gestalt des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, nach dem der Unternehmer die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unternehmen als Vorsteuer abziehen kann, für ihn günstiger sei. Bei richtlinienkonformer Auslegung im Lichte der neueren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union3 ist diese Vorschrift auf den Fall des innergemeinschaftlichen Erwerbs nach § 3d Satz 1 UStG zu beschränken4. Mit dieser Gesetzesauslegung überschreitet der Bundesfinanzhof die ihm zustehenden Befugnisse nicht. Die Rechtsprechung ist sowohl nach nationalem5 als auch nach Unionsrecht6 verpflichtet, den Sinn und Zweck einer Norm unter Berücksichtigung ihrer Einordnung in das Gesetz und damit ihres systematisch-teleologischen Zusammenhangs zu ermitteln. Es bestehen daher keine Bedenken, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, der nach seinem Wortlaut innergemeinschaftliche Erwerbe sowohl nach § 3d Satz 1 UStG als auch nach § 3d Satz 2 UStG erfasst, im vorgenannten Sinne einschränkend auszulegen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 8. September 2010 – XI R 40/08
- vgl. z.B. EuGH, Urteil vom 22.04.2010 – C-536/08 und C-539/08 [X und Facet Trading BV], BFH/NV 2010, 1225, Rz 28, m.w.N.[↩]
- vgl. EuGH, Urteil [X und Facet Trading BV] in BFH/NV 2010, 1225, Rz 39, 45[↩]
- EuGH, Urteil [X und Facet Trading BV] in BFH/NV 2010, 1225[↩]
- vgl. auch Klenk, HFR 2010, 778; Korf, IStR 2010, 368; Maunz, UR 2010, 418; DG, DStZ 2010, 507; a.A. Wagner, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht 2010, 220; Prätzler, jurisPR-SteuerR 27/2010, Anm. 6[↩]
- vgl. z.B. BFH, Urteil vom 15.04.2010 – IV R 5/08, BFHE 229, 524, BFH/NV 2010, 1926, Rz 30, m.w.N.[↩]
- vgl. z.B. EuGH, Urteil vom 27.11.2003 – C-497/01 [Zita Modes], Slg. 2003, I-14393, BFH/NV Beilage 2004, 128, Rz 34, m.w.N.[↩]