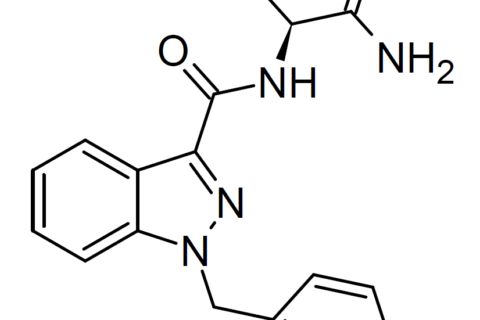Die umfassende gerichtliche Kognitionspflicht gebietet, dass der durch die zugelassene Anklage abgegrenzte Prozessstoff vollständig erschöpft wird1.

Die Tat als Gegenstand der Urteilsfindung ist der geschichtliche Vorgang, auf den Anklage und Eröffnungsbeschluss hinweisen und innerhalb dessen der Angeklagte einen Straftatbestand verwirklicht haben soll. Hierbei handelt es sich um einen eigenständigen Begriff; er ist weiter als derjenige der Handlung im sachlichen Recht.
Zur Tat im prozessualen Sinne gehört – unabhängig davon, ob Tateinheit oder Tatmehrheit vorliegt – das gesamte Verhalten des Täters, soweit es nach der Auffassung des Lebens einen einheitlichen Vorgang darstellt. Somit umfasst der Lebensvorgang, aus dem die zugelassene Anklage einen strafrechtlichen Vorwurf herleitet, alle damit zusammenhängenden und darauf bezüglichen Vorkommnisse, auch wenn diese in der Anklageschrift nicht ausdrücklich erwähnt sind.
Dabei kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an. Entscheidend ist, ob zwischen den in Betracht kommenden Verhaltensweisen – unter Berücksichtigung ihrer strafrechtlichen Bedeutung – ein enger sachlicher Zusammenhang besteht2.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 19. April 2017 – 2 StR 290/16