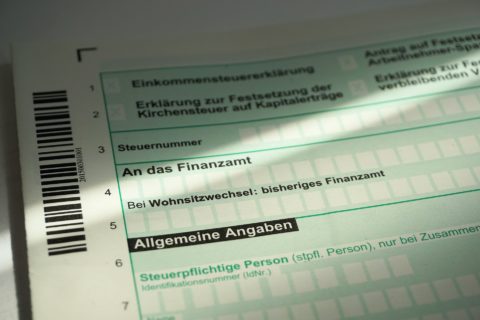Bei einer Umsatzsteuerhinterziehung hängt die Frage der Tatvollendung davon ab, ob die (unrichtigen) Steueranmeldungen zu einer Steuervergütung (§ 168 Satz 2 AO) oder zu einer Zahllast (§ 168 Satz 1 AO) der beteiligten Unternehmen geführt haben.

§ 370 Abs. 1 AO ist nicht lediglich ein Erklärungs, sondern auch ein Erfolgsdelikt. Vollendung tritt erst ein, wenn der Täter durch seine Tathandlung Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt hat1.
Betreffen wie hier alle verfahrensgegenständlichen Taten des Angeklagten die Umsatzsteuer, sei es als Jahreserklärung oder als Voranmeldung, tritt für die Fälle der Herabsetzung der bisher zu entrichtenden Steuer oder der Steuervergütung der tatbestandliche Verkürzungserfolg erst aufgrund der gemäß § 168 Satz 2 AO erforderlichen Zustimmung der Finanzbehörde ein.
In den Konstellationen des § 168 Satz 1 AO ist die Steuerhinterziehung dagegen bereits mit der (unrichtigen) Anmeldung selbst vollendet2.
Die Frage, ob Versuch oder Vollendung vorliegt, entscheidet sich mithin nach dem Saldo der jeweiligen Erklärungen. Die Urteilsgründe beschränken sich demgegenüber jedoch auf die bloße Addition der in den inkriminierten Rechnungen ausgewiesenen Umsatzsteuer je Voranmeldungszeitraum3, mithin auf die Bestimmung der – lediglich strafzumessungsrechtlich relevanten – Höhe des beabsichtigten oder tatsächlich eingetretenen Steuerschadens.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 8. Juni 2017 – 1 StR 217/17