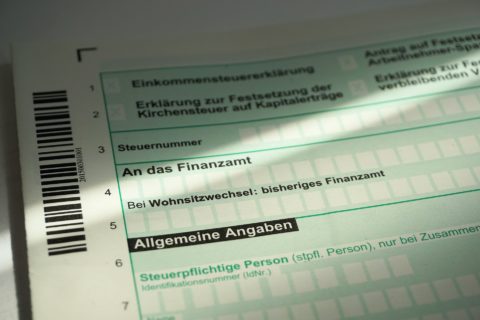Täter – auch Mittäter – einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO kann nur derjenige sein, der selbst zur Aufklärung steuerlich erheblicher Tatsachen besonders verpflichtet ist1.

Gemäß § 19 TabStG aF entsteht die deutsche Tabaksteuer, wenn Tabakwaren unzulässiger Weise entgegen § 12 Abs. 1 TabStG aF aus dem freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten zu gewerblichen Zwecken in das Steuergebiet der Bundesrepublik Deutschland verbracht werden. Das Überführen der Zigaretten aus Polen, die sich dort im freien Verkehr befanden, nach Deutschland ohne Inanspruchnahme des innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahrens (§ 16 Abs. 1 Satz 1 TabStG aF) ist ein gewerbliches unversteuertes Verbrin- gen. Für die Zigaretten war deshalb unverzüglich nach dem Verbringen in das Steuergebiet der Bundesrepublik Deutschland eine Steuererklärung abzugeben (§ 19 Satz 3 TabStG aF). Mit der Missachtung dieser Pflicht wurde die deut- sche Tabaksteuer gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 Satz 1 AO hinterzogen2.
Steuerschuldner ist, wer Tabakwaren verbringt oder versendet und der Empfänger, sobald er Besitz an den Tabakwaren erlangt hat (§ 19 Satz 1 TabStG aF). Dafür ist zwar nicht entscheidend, dass der Steuerschuldner die Zigaretten selbst aus einem anderen Mitgliedstaat nach Deutschland transportiert, allerdings ist ein gewisses Maß an Herrschaft über die Tabakwaren beim Verbringen nach Deutschland erforderlich. So wird als Verbringer auch angesehen, wer kraft seiner Weisungsbefugnis beherrschenden Einfluss auf das Transportfahrzeug hat, indem er die Entscheidung zur Durchführung des Transports trifft oder die Einzelheiten der Fahrt (z.B. Route, Ort, Zeitabfolge) bestimmt3.
Schließen sich mehrere Täter zu einer Bande zusammen, so hat dies nicht zur Folge, dass jede von einem Bandenmitglied begangene Tat einem anderen Bandenmitglied ohne weiteres als gemeinschaftlich begangene Tat im Sinne des § 25 Abs. 2 StGB zugerechnet werden kann. Die Frage, ob die Beteiligung als Mittäterschaft oder Beihilfe zu werten ist, beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen Grundsätzen4. Danach ist Mittäter im Sinne von § 25 Abs. 2 StGB, wer einen eigenen Tatbeitrag leistet und diesen so in die Tat einfügt, dass er als Teil der Handlung eines anderen Beteiligten und umgekehrt dessen Handeln als Ergänzung des eigenen Tatanteils erscheint. Zwar kann für die Einordnung als Mittäterschaft ein die Tatbestandsverwirklichung fördernder Beitrag ausreichen, der sich auf eine Vorbereitungs- oder Unterstützungshandlung beschränkt. Stets muss sich die objektiv aus einem wesentlichen Tatbeitrag bestehende Mitwirkung aber nach der Willensrichtung des sich Beteiligenden als Teil der Tätigkeit aller darstellen5.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 23. März 2017 – 1 StR 451/16
- st. Rspr.; BGH, Urteil vom 09.04.2013 – 1 StR 586/12, BGHSt 58, 218 mwN; BGH, Beschluss vom 14.10.2015 – 1 StR 521/14, wistra 2016, 74[↩]
- BGH, Beschluss vom 01.02.2007 – 5 StR 372/06, wistra 2007, 224 – 228[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 01.02.2007 – 5 StR 372/06, NStZ 2007, 590; BGH, Urteil vom 14.03.2007 – 5 StR 461/06, NStZ 2007, 592; BGH, Beschluss vom 14.10.2015 – 1 StR 521/14, wistra 2016, 74[↩]
- BGH, Beschluss vom 19.01.2012 – 2 StR 590/11, NStZ 2012, 517[↩]
- BGH, Urteile vom 30.06.2005 – 5 StR 12/05, NStZ 2006, 44; und vom 09.04.2013 – 1 StR 586/12, BGHSt 58, 218; Beschlüsse vom 14.07.2016 – 3 StR 129/16, StraFo 2016, 392; und vom 20.10.2016 – 3 StR 321/16[↩]