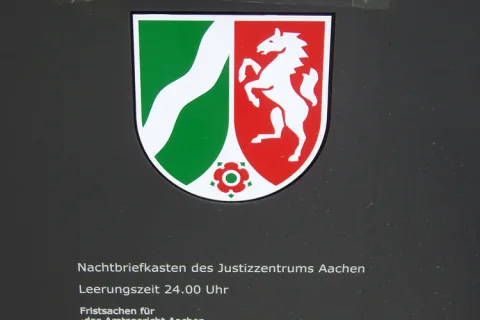DAISY-Abspielgeräte sind keine Gegenstände, die der allgemeinen Lebenshaltung unterliegen. Sie sind vielmehr beihilfefähige Hilfsmittel, da die Geräte von Seiten des Herstellers auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen abgestimmt wurden, um diesen einen strukturierten interaktiven Zugriff auf unterschiedliche schriftliche Medien im DAISY-Standard zu ermöglichen.

Der Einordnung als Hilfsmittel steht nicht entgegen, dass das DAISY-Abspielgerät auch von Gesunden benutzt werden kann. Vielmehr ist entscheidend, ob der zu beurteilende Gegenstand von diesem Personenkreis üblicherweise benutzt wird.
„DAISY“ ist eine Kurzform für heißt: „Digital Accessible Information System“ und bezeichnet die Standards und Technologien, die von den Blindenbüchereien der Welt für eine neue digitale Hörbuchgeneration entwickelt worden sind. Bisher wurden Hörbücher für Blinde und Sehbehinderte auf Audiokassetten angeboten. Da die im kommerziellen Hörbuchmarkt häufig eingesetzte Audio-CD aus Speicher- und Navigationsgründen für vollständig aufgesprochene Hörbücher ungeeignet ist, wurde ein neues digitales Medium entwickelt werden – DAISY. Auf eine DAISY-CD passen bis zu 40 Stunden lange Hörbücher, bzw. mehrere kürzere Bücher, auf eine handelsübliche Audio-CD hingegen lediglich bis zu 80 Minuten. Der Leser kann auf einer DAISY-CD wie in einem richtigen Buch blättern, es von der ersten bis zur letzten Seite lesen oder einfach von Kapitel zu Kapitel springen. Auch Seiten- bzw. Satzsuche ist in manchen Büchern möglich. Die Anzahl der Hierarchiestufen ist vom Informationsgehalt des Buches abhängig. Für Sachliteratur, z. B. Nachschlagewerke oder Kochbücher, werden mehr Suchebenen angeboten als für Romane.
So hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in dem hier vorliegenden Fall entschieden. Der Kläger ist bei der beklagten Postbeamtenkrankenkasse als A-Mitglied krankenversichert und aufgrund einer Augenerkrankung beidseitig erblindet. Er begehrt von der Beklagten die Genehmigung zur Anschaffung eines DAISY-Abspielgeräts. Nach der Beschreibung handelt es sich um ein Abspielgerät für Hörbücher, mit dem neben Büchern in einem besonderen, mit den Buchstaben DAISY (für Digital Accessible Information System) bezeichneten Format auch herkömmliche Hörbücher im Audio und MP3-Format abgespielt werden können; die Nutzung erfolgt über eine besonders einfach zu bedienende Tastatur.
Nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Beklagten haben die Mitglieder für sich und die mitversicherten Angehörigen Anspruch auf die in den §§ 31 bis 48 festgelegten Leistungen. Nach § 30 Abs. 1 Satz 2 der Satzung sind erstattungsfähig im Sinne dieser Bestimmungen Aufwendungen, wenn sie beihilfefähig und Leistungen dafür in der Satzung vorgesehen sind. § 35 Abs. 1 der Satzung bestimmt in diesem Zusammenhang weiter, dass Aufwendungen für Anschaffung, Reparatur, Betrieb und Unterhaltung der vom Arzt schriftlich verordneten Hilfsmittel in dem für die Anwendung der Beihilfevorschriften des Bundes vom 01.01.2004 geltenden Rahmen erstattungsfähig sind. Gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 der Satzung bedarf die Anschaffung von Hilfsmitteln grundsätzlich der vorherigen Genehmigung durch die Beklagte. Eine solche Genehmigung ist zu erteilen, wenn dem A-Mitglied ein Anspruch auf Kassenleistungen nach §§ 30 Abs. 1, 35 Abs. 1 der Satzung für das anzuschaffende Hilfsmittel zusteht. Das ist hier der Fall.
Bei dem DAISY-Abspielgeräte handelt es sich um ein Hilfsmittel, das im Rahmen der Beihilfevorschriften des Bundes beihilfefähig wäre und damit nach der Satzung der Beklagten erstattungsfähig ist.
Die Beurteilung der Beihilfefähigkeit des DAISY-Abspielgeräts richtet sich nach den Beihilfevorschriften des Bundes vom 01.01.2004. Danach sind gemäß § 5 i.V.m. § 6 BhV anlässlich einer Krankheit entstandene Aufwendungen beihilfefähig, wenn sie dem Grunde nach notwendig und soweit sie in der Höhe angemessen sind. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 BhV sind aus Anlass einer Krankheit die Aufwendungen für die Anschaffung der vom Arzt schriftlich verordneten Hilfsmittel beihilfefähig. Voraussetzungen und Umfang der Beihilfefähigkeit bestimmen sich nach der Anlage 3. Nach Nr. 1 der Anlage 3 sind die notwendigen und angemessenen Aufwendungen für die Anschaffung der Hilfsmittel – gegebenenfalls im Rahmen der Höchstbeträge – beihilfefähig, wenn sie vom Arzt schriftlich verordnet und nachstehend aufgeführt sind. Ergänzend zu Nr. 1 der Anlage 3 gilt Nr. 9 (sog. Negativkatalog), in dem Gegenstände aufgeführt werden, die nicht zu den Hilfsmitteln gehören. Durch die Formulierung „insbesondere“ wird in diesem Zusammenhang klargestellt, dass dieser Katalog nicht abschließend ist; danach gehören generell solche Gegenstände nicht zu den Hilfsmitteln, die nicht notwendig und angemessen (§ 5 Abs. 1), von geringem oder umstrittenen therapeutischen Nutzen oder geringem Abgabepreis (§ 6 Abs. 4 Nr. 3) sind oder der allgemeinen Lebenshaltung unterliegen.
Vor dem Hintergrund dieser Systematik ist eine Gesamtabwägung vorzunehmen, ob die Aufwendungen für den zu beurteilenden Gegenstand unter Berücksichtigung der genannten Beispielsfälle notwendig und angemessen sind oder ob sie im Hinblick auf die genannten Ausschlussgründe – insbesondere weil die Gegenstände der allgemeinen Lebenshaltung unterliegen – von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen sind. Allein der Umstand, dass der zu beurteilende Gegenstand nicht ausdrücklich unter Nr. 1 der Anlage 3 aufgelistet ist, schließt die Einordnung des Gegenstands zu den Hilfsmitteln nicht aus1. Wenn ein Gegenstand nicht unter Nr. 1 der Anlage 3 aufgelistet ist, kann dies zwar als Indiz für den Ausschluss der Beihilfefähigkeit angesehen werden. Angesichts der Vielzahl der möglichen Erkrankungen und der Vielzahl der in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehenden „Hilfsmittel“ kommt es jedoch auch in diesem Fall maßgeblich darauf an, ob der Gegenstand im Hinblick auf die jeweilige Erkrankung bzw. Behinderung notwendig und angemessen ist. Dies wird bestätigt durch die Regelung in Nr. 10 Satz 1 der Anlage 3. Danach entscheidet über die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für Hilfsmittel, die weder in dieser Anlage aufgeführt noch mit den aufgeführten Gegenständen vergleichbar sind, die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern. Dies bedeutet zugleich, dass zunächst vorrangig zu prüfen ist, ob die zu beurteilenden Hilfsmittel in der Anlage 3 genannt oder mit den dort aufgeführten vergleichbar sind. Maßstab des Vergleichs sind die Schwere der Erkrankung und der Einsatzzweck des Gegenstands2.
Das hier zu beurteilende DAISY-Abspielgerät ist unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe als – beihilfefähiges – Hilfsmittel anzusehen. Im Ausschlusskatalog der Nr. 9 zur Anlage 3 ist das Gerät nicht aufgeführt. Darüber hinaus kann es entgegen der Ansicht der Beklagten und des Verwaltungsgerichts auch nicht als Gegenstand qualifiziert werden, der der allgemeinen Lebenshaltung unterliegt. Für die Abgrenzung kommt es darauf an, ob der Gegenstand bzw. das Mittel spezifisch der Bekämpfung einer Krankheit oder dem Ausgleich einer Behinderung dient. Gegenstände, die regelmäßig auch von Gesunden benutzt werden, sind auch bei hohen Kosten grundsätzlich nicht beihilfefähig bzw. fallen nicht in die Leistungspflicht der Beklagten. Für die Einordnung als Hilfsmittel kommt es danach auf die objektive Eigenart und die Beschaffenheit des betreffenden Gegenstands an, nicht dagegen darauf, ob im Einzelfall der Gegenstand auch ohne Erkrankung überhaupt und in gleich teurerer Ausführung beschafft worden wäre3. Danach sind Geräte, die für die speziellen Bedürfnisse kranker oder behinderter Menschen entwickelt sowie hergestellt worden sind und die ausschließlich oder ganz überwiegend von diesem Personenkreis benutzt werden, jedenfalls nicht als Gegenstände anzusehen, die der allgemeinen Lebenshaltung unterliegen4.
DAISY-Abspielgeräte wurden von den Herstellern gerade im Hinblick auf die Bedürfnisse blinder bzw. sehbehinderter Menschen entwickelt, um diesen einen strukturierten interaktiven Zugriff auf unterschiedliche schriftliche Medien in einem besonderen, von Blindenbüchereien entwickelten Standard zu ermöglichen. Kennzeichen des DAISY-Hörbuchs sind umfassende hierarchische Navigationsfunktionen. Der Benutzer kann nicht nur von Kapitel zu Kapitel eines Textes springen, sondern über mehrere Hierarchiestufen vom Kapitel über die Seitenzahl bis zum einzelnen Satz oder einer Fußnote und wieder zurück gelangen. Der Benutzer kann beliebig viele Buchzeichen platzieren, das DAISY-Abspielgerät zeigt die markierten Textstellen wieder an. Daneben kann der Benutzer Anmerkungen in ein Mikrofon sprechen, die von dem Gerät aufgenommen werden, und sich so gewissermaßen Notizen zu dem gelesenen Text machen. Mit dem DAISY-Standard können die Sehbehinderten nicht nur die auf dem Markt befindlichen digitalen Hörbücher nutzen, sondern darüber hinaus auch digitale Zeitungen und Zeitschriften und sogar Lexika. Auch die Handhabung der DAISY-Abspielgeräte ist speziell auf die Bedürfnisse blinder Nutzer abgestimmt. Die Tasten sind großflächig, mit größerem Abstand zueinander angeordnet und unterschiedlich gestaltet, so dass die zur Verfügung stehenden Funktionen anhand der Tastenposition und der Tastenform besonders gut zu „erfühlen“ sind. Hinzu kommen sprachliche Hilfs-, Info-Ansagen und Klänge, die über die jeweilige Funktion Auskunft erteilen5.
Der Umstand, dass das DAISY-Abspielgerät auch von Gesunden benutzt werden kann, stellt entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts die Einordnung als Hilfsmittel nicht in Frage. Das Gleiche gilt auch für andere Hilfsmittel, wie etwa Rollstühle und Krücken, die nach Nr. 1 der Anlage 3 unstreitig beihilfefähig sind. In diesem Zusammenhang kann es nicht allein darauf ankommen, ob der Gegenstand möglicherweise von einem Gesunden benutzt werden kann. Entscheidend ist vielmehr, ob der Gegenstand von einem Gesunden üblicherweise benutzt wird, d.h. dass es sich bei typisierender Betrachtung um einen Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens auch für Gesunde handelt.
Unerheblich ist auch der Umstand, dass Hörbücher nicht nur von blinden bzw. sehbehinderten Menschen benutzt werden, sondern dies auch bei gesunden Menschen heutzutage allgemein verbreitet ist. Gesunde nutzen hierfür üblicherweise MP-3- oder CD-Player, da sie die besonderen Funktionen von DAISY nicht benötigen. Sie nutzen im Regelfall auf diesem Wege auch keine Zeitschriften oder gar Lexika.
Die einen Anspruch auf Kassenleistungen der Beklagten auslösende Hilfsmitteleigenschaft des DAISY-Abspielgeräts setzt demzufolge allein voraus, dass seine Anschaffung, für die der Kläger die Genehmigung erstrebt, notwendig und angemessen i.S.d. § 5 Abs. 1 BhV ist. Auch davon ist im vorliegenden Fall auszugehen.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur gesetzlichen Krankenversicherung ist ein Hilfsmittel erforderlich, wenn sein Einsatz zur Lebensbetätigung im Rahmen der allgemeinen Grundbedürfnisse benötigt wird. Zu den allgemeinen Grundbedürfnissen ist dabei auch ein gewisser körperlicher und geistiger Freiraum zu rechnen, der die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben umfasst; dazu gehört etwa die Aufnahme von Informationen und die Kommunikation mit anderen zur Vermeidung von Vereinsamung. Maßstab ist stets der gesunde Mensch, zu dessen Grundbedürfnissen der kranke oder behinderte Mensch durch die medizinische Rehabilitation oder mit Hilfe der von der Krankenkasse gelieferten Hilfsmittel wieder aufschließen soll6. Auf diese zum Recht der gesetzlichen Krankenversicherung entwickelten Grundsätze kann auch im Rahmen entsprechender beihilferechtlicher Entscheidungen und demzufolge auch bei der Auslegung von § 35 Abs. 1 der Satzung der Beklagten zurückgegriffen werden. Sie entsprechen den Verpflichtungen des Dienstherrn, die diesem aus seiner Fürsorgepflicht gegenüber seinen Beamten erwachsen7.
Das DAISY-Abspielgerät erweist sich danach zur Überzeugung des Verwaltungsgerichtshofs als notwendig. Durch das Geräte wird der Kläger in die Lage versetzt, selbständig aus einer Vielzahl von Publikationen (Belletristik, klassische Literatur, Sachbücher, Lexika, Zeitschriften und Informationen unterschiedlicher Verbände) auszuwählen, die im DAISY-Format zur Verfügung stehen und insbesondere über Blindenbüchereien kostenlos (wie z.B. Bücher) bzw. gegen geringe Entgelte (wie z.B. Zeitschriften) zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch wird sein als elementares Grundbedürfnis des täglichen Lebens zu wertendes Bedürfnis nach Kommunikation und Information ((vgl. dazu BSG, Urteil vom 16.04.1998 – B 3 KR 6/97 R, SozR 3 – 2500 § 33 Nr. 26) erheblich umfassender befriedigt als dies ohne dieses Hilfsmittel bislang der Fall ist.
Es ist ferner von der Angemessenheit des Hilfsmittels auszugehen. Der Kläger muss sich insbesondere nicht auf die Nutzung eines handelsüblichen MP-3- oder CD-Players verweisen lassen. Solche Geräte sind nur geeignet, ein durchgängiges Abspielen der Informationen zu leisten, und sie können nicht gezielt nach Informationen im Text suchen, Abschnitte überspringen oder in sonstiger Weise in den Texten navigieren. Aufgrund der geringen Größe solcher Geräte ist ferner deren Bedienung für blinde oder hochgradig sehbehinderte Menschen äußerst schwierig. Insgesamt erweist sich der Nutzen eines DAISY-Abspielgeräts für den Kläger gerade durch die angesprochenen speziell auf die Bedürfnisse blinder bzw. hochgradig sehbehinderter Menschen ausgerichteten Zusatzfunktionen als so hoch, dass auch in Abwägung mit den Kosten in einer Größenordnung von 350,– bis 400,– EUR ein entsprechender Versorgungsanspruch besteht.
Schließlich ist auch nicht ersichtlich, dass der Kläger auf die Anschaffung eines günstigeren Abspielgeräts eines anderen Herstellers verwiesen werden könnte. Auch die Beklagte hat nicht behauptet, dass eine solche billigere Variante existiere.
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 26. September 2011 – 2 S 825/11
- BVerwG, Urteil vom 28.05.2008 – 2 C 9.07, NVwZ-RR 2008, 711[↩]
- BVerwG, Urteil vom 28.05.2008, aaO[↩]
- BVerwG, Urteil vom 14.03.1991 – 2 C 23.89, DÖD 1991, 203[↩]
- vgl. Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18.02.2010 – L 5 KR 146/09[↩]
- vgl. zum Ganzen: LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18.02.2010, aaO und SG des Saarlands, Urteil vom 14.12.2009 – S 23 KR 416/09[↩]
- vgl. zum Ganzen: BSG, Urteil vom 07.03.1990 – 3 RK 15/89, BSGE 66, 245[↩]
- vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil vom 24.04.1996 – 4 S 3208/94, DÖD 1997, 37[↩]