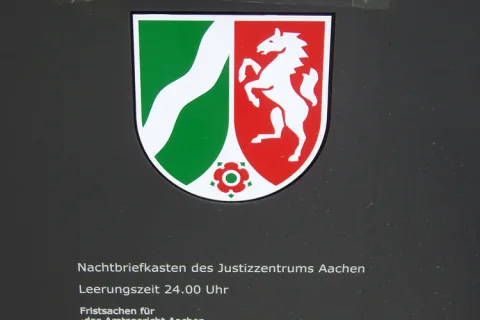Die Anerkennung der Notwendigkeit des im Ausland gemieteten Wohnraums im Rahmen einer Entscheidung über die Gewährung eines Mietzuschusses nach § 57 BBesG 2002 bzw. § 54 BBesG kann auf der Grundlage sowohl einer individuellen Prüfung der konkreten Verhältnisse als auch der typisierenden Regelung einer Mietobergrenze erfolgen.

Der Dienstherr kann im Rahmen seiner Organisationsgewalt bestimmen, ob und welche wohnraumbezogenen Anforderungen mit der Wahrnehmung von Ämtern im Ausland verbunden sind (z.B. Arbeitszimmer, Empfänge in der Privatwohnung). Allerdings muss er die hierdurch verursachten Kosten tragen und darf sie nicht dem Beamten aufbürden.
Eine Wohnung ist auch dann im Hinblick auf den Familienstand angemessen, wenn der zu berücksichtigende Familienangehörige zwar nicht sofort mit dem Beamten die Wohnung im Ausland bezieht, aber doch so zeitnah nachzieht, dass es dem Beamten unzumutbar oder unmöglich ist, zunächst eine kleinere Wohnung für sich und ab dem Eintreffen des Familienangehörigen eine größere Wohnung für die Familie insgesamt zu mieten.
echtsgrundlage für den Anspruch auf Mietzuschuss im hier entschiedenen Zeitraum ist noch § 57 Abs. 1 Satz 1 BBesG1, der dem derzeit geltenden § 54 Abs. 1 Satz 1 BBesG inhaltlich entspricht. Danach wird der Mietzuschuss gewährt, wenn die Miete für den als notwendig anerkannten leeren Wohnraum 18 % der Summe aus Grundgehalt, Familienzuschlag der Stufe 1, Amts, Stellen, Ausgleichs- und Überleitungszulagen mit Ausnahme des Kaufkraftausgleichs übersteigt. Er beträgt grundsätzlich 90 % des Mehrbetrags (§ 57 Abs. 1 Satz 2 BBesG 2002).
Sinn und Zweck des zur Auslandsbesoldung gehörenden Mietzuschusses (vgl. § 52 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 BBesG 2002, § 1 Abs. 2 Nr. 6 BBesG)2 ist es, die durch die teilweise sehr hohe Wohnungsmiete im Ausland entstehenden Mehrbelastungen des Beamten auszugleichen; der im Ausland Dienst leistende und deshalb auch dort wohnende Beamte soll nur eine dem im Inland Dienst leistenden und wohnenden Beamten vergleichbare Mietbelastung selbst zu tragen haben3. Der Mietzuschuss trägt dem Umstand Rechnung, dass ein ins Ausland entsandter Beamter in aller Regel am ausländischen Dienstort seinen Wohnsitz nehmen muss (vgl. § 13 Abs. 1 Satz 2, § 27 Abs. 1 des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst – GAD4 -). Dabei sind – jedenfalls im Auswärtigen Dienst – vielfach auch dienstlich veranlasste Repräsentationsaufgaben in der privaten Wohnung wahrzunehmen. Nach § 27 Abs. 2 Satz 1 GAD soll dem Beamten im Ausland eine angemessene Wohnung unter Berücksichtigung der Zahl der zu seiner häuslichen Gemeinschaft gehörenden Personen, seiner dienstlichen Aufgaben und der örtlichen Verhältnisse zur Verfügung stehen. Die hierfür erforderlichen Mittel hat der Dienstherr zur Verfügung zu stellen. Der Beamte darf nicht gezwungen sein, auf die für die sonstige private Lebensführung bestimmten Besoldungsbestandteile zurückzugreifen. Dementsprechend ordnet § 27 Abs. 2 Satz 2 GAD an, dass der aus eigenen Mitteln zu bestreitende Anteil der Wohnkosten die durchschnittlichen Aufwendungen für Wohnzwecke im Inland nicht übersteigen soll. Die durchschnittliche Wohneigenbelastung hat der Gesetzgeber mit 20 % der Inlandsdienstbezüge für Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 8 und 22 % der Inlandsdienstbezüge für Beamte ab der Besoldungsgruppe A 9 angesetzt (vgl. § 57 Abs. 1 Satz 3 BBesG 2002).
§ 57 Abs. 1 Satz 1 BBesG 2002 setzt für die Gewährung eines Mietzuschusses voraus, dass der Wohnraum als notwendig anerkannt worden ist. Mit der Tatbestandsvoraussetzung „als notwendig anerkannt“ wird der Bewilligung des Mietzuschusses eine Zwischenentscheidung der Verwaltung über die Notwendigkeit des Wohnraums vorgeschaltet. Das Gesetz lässt für diese Anerkennung sowohl eine individuelle Prüfung der konkreten Verhältnisse als auch eine typisierende Regelung etwa durch Mietobergrenzen zu, bei deren Einhaltung der gemietete Wohnraum generell und ohne weitere Prüfung als notwendig anerkannt wird (vgl. nunmehr auch § 54 Abs. 2 Satz 1 BBesG). In beiden Fällen ist unter Fürsorgeaspekten wie unter Vertrauensschutzaspekten zu beachten, dass der Beamte bei Abschluss des Mietvertrages Klarheit darüber haben sollte, ob und inwieweit er mit einem Mietzuschuss rechnen kann. Dem tragen Mietobergrenzen in besonderer Weise Rechnung, weil sie dem Beamten bereits bei der Suche nach einer Wohnung Kenntnis darüber verschaffen, bis zu welcher Miethöhe eine Miete im Rahmen des Mietzuschusses in jedem Fall berücksichtigungsfähig ist und dass er einen darüber hinausgehenden Betrag selbst zu tragen hat, wenn er nicht dartun kann, im konkreten Fall keine Möglichkeit gehabt zu haben, angemessenen Wohnraum günstiger zu beschaffen.
Hinsichtlich der Anerkennung der Notwendigkeit des Wohnraums kommt der Verwaltung ein – allerdings durch das Alimentationsprinzip (Art. 33 Abs. 5 GG) begrenzter – Entscheidungsspielraum zu. Dabei ist wie folgt zu unterscheiden:
Dienstbezogene Anforderungen hinsichtlich des häuslichen Wohnraums (z.B. Arbeitszimmer, Repräsentationsmöglichkeiten) kann der Dienstherr nach seinem Organisationsermessen bestimmen. Es ist Sache des Auswärtigen Amtes und unterliegt seinem Letztentscheidungsrecht5, festzulegen, welches Repräsentationsniveau bei dienstlich veranlassten Empfängen in der Privatwohnung als angemessen und „notwendig“ angesehen wird. Ebenso unterliegt es der Organisationsgewalt des Dienstherrn, darüber zu befinden, welche Repräsentationspflichten der Inhaber eines bestimmten Funktionsamts hat und ob hierfür auch Privatempfänge erforderlich sind. Diese Entscheidungen sind einer gerichtlichen Überprüfung nicht zugänglich. § 57 Abs. 1 Satz 1 BBesG 2002 knüpft an die Entscheidung über die Notwendigkeit des Wohnraums aber die dienstrechtlich gebotene Folge, dass hierdurch verursachte Kosten vom Dienstherrn getragen werden müssen. Soweit Anforderungen an die Wohnung dienstlich veranlasst sind, können sie nicht dem Beamten zur Finanzierung überlassen bleiben. Dies verstieße gegen das als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums in Art. 33 Abs. 5 GG verankerte Alimentationsprinzip. Die Besoldung dient dazu, dass der Beamte seine private Lebensführung bestreiten kann, sie dient nicht zur Finanzierung dienstlicher Zwecke.
Es ist vorbehaltlich dies regelnder normativer Vorgaben auch der Entscheidung des Dienstherrn überlassen, ob er Repräsentationspflichten schon bei den Mietobergrenzen pauschalierend berücksichtigt oder ob er ihnen – ggf. auch nur für einige Status- oder Funktionsämter mit besonderen Repräsentationspflichten – durch eine Höherstufung bei den Mietobergrenzen oder individuell Rechnung trägt (vgl. nunmehr § 54 Abs. 2 BBesG; hierzu BT-Drs. 17/12455 S. 65).
Uneingeschränkter gerichtlicher Kontrolle unterliegt dagegen die Frage, ob bei der Anerkennung der Notwendigkeit des Wohnraums die subjektiven Rechte des Beamten ausreichend berücksichtigt worden sind6. Reichte der Mietzuschuss nicht aus, um am Dienstort eine im Hinblick auf Statusamt und Familienstand angemessene Wohnung zu finanzieren (vgl. § 27 Abs. 2 Satz 2 GAD), wäre der Beamte vor die Wahl gestellt, sich mit einem nicht amtsangemessenen Wohnniveau zu begnügen oder zur Finanzierung des amtsangemessenen Wohnniveaus einen so hohen Anteil seiner Besoldung aufzuwenden, dass eine amtsangemessene Lebensführung im Übrigen nicht mehr möglich ist.
Im vorliegenden Fall hat das Auswärtige Amt als Dienstherr außerdem die Repräsentationsanforderungen für den gesamten Zeitraum ab dem Beginn der Tätigkeit des Beamten in Paris gestellt, also auch schon vor seiner Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 BBesO. Damit stand dem Beamten von Anfang an – und nicht erst mit der Beförderung – der Mietzuschuss aufgrund der das übliche Maß übersteigenden Repräsentationspflichten auf der Basis der erhöhten Mietobergrenze zu. Für ein vom Beklagten angenommenes Nebeneinander von – allein an den Status des Beamten anknüpfenden – Mietzuschuss einerseits und daneben zu gewährender Aufwandsentschädigung für höhere dienstbezogene Anforderungen an den Wohnraum andererseits gibt es nach der gesetzlichen Regelung des § 57 BBesG 2002 (und § 54 BBesG) weder einen Bedarf noch eine Rechtfertigung. Dem Gesetzeszweck dieser Norm kann und muss auch für einen dienstpostenbezogenen höheren – und damit denjenigen des Statusamts des Beamten übersteigenden – Repräsentationsaufwand durch Anwendung dieser Norm Rechnung getragen werden.
Soweit sich die Revision gegen den vom Oberverwaltungsgericht zugebilligten Mietzuschuss für Verheiratete bereits von Beginn der Tätigkeit des Beamten in Paris wendet, obwohl seine Ehefrau erst einige Wochen später nachgezogen ist, genügt das Vorbringen der Beklagten bereits nicht den Begründungsanforderungen aus § 139 Abs. 3 VwGO.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verlangt § 139 Abs. 3 VwGO für die Revisionsbegründung eine Sichtung und rechtliche Durchdringung des Streitstoffes und eine damit verbundene sachliche Auseinandersetzung mit den die Entscheidung des Berufungsgerichts tragenden Gründen, aus der hervorgeht, warum der Revisionskläger diese Begründung als nicht zutreffend erachtet7.
Zu der Frage der Berücksichtigung des Familienmehrbedarfs enthält die ohnehin sehr knapp gehaltene Revisionsbegründung der Beklagten lediglich Ausführungen zu einer von mehreren Kontrollüberlegungen des Oberverwaltungsgerichts, nicht aber zu dessen Hauptbegründung, und verweist im Übrigen auf den Vortrag in der Vorinstanz. Die bloße Infragestellung einer Kontrollüberlegung und der Verweis auf Vorbringen in früheren Instanzen genügen den dargestellten Anforderungen des § 139 Abs. 3 VwGO nicht.
Ungeachtet dessen sind die Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Eine Wohnung ist auch dann im Hinblick auf den Familienstand angemessen, wenn der zu berücksichtigende Familienangehörige zwar nicht sofort mit dem Beamten die Wohnung im Ausland bezieht, aber doch so zeitnah nachzieht, dass es dem Beamten unzumutbar oder sogar unmöglich ist, zunächst eine kleinere Wohnung für sich und ab dem Eintreffen des Familienangehörigen eine größere Wohnung für die Familie insgesamt zu mieten.
Nichts anderes folgt daraus, dass die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesbesoldungsgesetz in Nr. 57.01.3 u.a. bestimmt: „Bezieht er (= der Besoldungsempfänger) eine Familienwohnung, bevor die Familie am ausländischen Dienstort eingetroffen ist, so kann nur der Bedarf eines Alleinstehenden als notwendig anerkannt werden. Dieser ist der Berechnung des Mietzuschusses zugrunde zu legen.“ Wie das Oberverwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, erfasst diese Regelung nicht jeden Fall adäquat und ist – da es sich um eine nur die Verwaltung intern bindende Verwaltungsvorschrift handelt, die überdies mit der gebotenen Auslegung der Ausgangsnorm des Bundesbesoldungsgesetzes nicht in Einklang steht – vom Gericht unangewendet zu lassen.
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22. Januar 2015 – 2 C 14.2013 –
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.08.2002, BGBl. I S. 3020[↩]
- BVerwG, Urteil vom 28.10.2010 – 2 C 56.09, Buchholz 240 § 17 BBesG Nr. 1 Rn. 8 ff.[↩]
- BVerwG, Urteile vom 21.08.1979 – 6 C 5.78, Buchholz 235 § 57 BBesG 1975 Nr. 1 S. 5; und vom 25.09.1987 – 6 C 26.85, Buchholz 240 § 57 BBesG Nr. 3 S. 2; BT-Drs. 4/1337 S. 3, zu § 28; BT-Drs. 11/6543 S. 9, zu § 57[↩]
- vom 30.08.1990, BGBl. I S. 1842[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 31.05.2011 – 1 BvR 857/07, BVerfGE 129, 1, 22[↩]
- BVerfG, Beschluss vom 31.05.2011 – 1 BvR 857/07, BVerfGE 129, 1, S. 22 f.[↩]
- BVerwG, Urteil vom 03.03.1998 – 9 C 20.97, BVerwGE 106, 202, 203 m.w.N.; Beschluss vom 12.06.2006 – 5 C 26.05 – NJW 2006, 3081[↩]