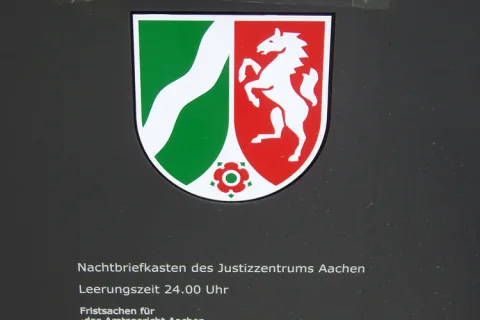Ein Beamter (hier: ein Städtischer Rat), der mit der Einstellung in das Beamtenverhältnis ohne eine Wahlmöglichkeit teilzeitbeschäftigt wurde, hat einen Anspruch auf Aufhebung der bestandskräftigen Teilzeitbeschäftigungsanordnung und auf Vollzeitbeschäftigung sowie auf besoldungs- und versorgungsrechtliche Gleichstellung mit vollzeitbeschäftigten Beamten.

In dem hier vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschiedenen Rechtsstreit beruhte die Teilzeitanordnung auf der Regelung des seinerzeitigen § 80 c NBG. Diese Bestimmung, die eine antraglose Teilzeitbeschäftigung gegen den Willen des Betroffenen ermöglicht hatte, ist durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.20071 für nichtig erklärt worden.
Die Teilzeitbeschäftigung von Beamten ist nur mit deren Einverständnis zulässig. Sie darf nur angeordnet werden, wenn dem Beamten die Möglichkeit offen gestanden hat, Vollzeitbeschäftigung zu wählen oder daran festzuhalten. Die erforderliche Wahlmöglichkeit besteht dann nicht, wenn der Dienstherr zu erkennen gibt, er werde die Verbeamtung nur vornehmen, wenn der Bewerber einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung stellt2.
Die vom Dienstherrn im Zusammenhang mit der Berufung des Beamten in das Beamtenverhältnis auf Probe getroffene Anordnung der Teilzeitbeschäftigung des Beamten beruhte vorliegend nicht auf Freiwilligkeit. Hierfür wäre erforderlich gewesen, dass der Beamte eine echte Wahlmöglichkeit zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung hatte3. Das war nicht der Fall.
Rechtsgrundlage des geltend gemachten Anspruchs, die Stadt unter entsprechender Aufhebung der dem Beamten gegenüber im Zusammenhang mit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe mündlich getroffenen Teilzeitanordnung zu verurteilen, an ihn für die Zeit vom 01.10.2007 bis zum 31.12 2008 die Differenz zwischen der erhaltenen Besoldung und der bei einer Vollzeitbeschäftigung gesetzlich vorgesehenen Besoldung zu zahlen und ihn für die Zeit vom 01.10.2007 bis zum 31.12 2008 versorgungsrechtlich so zu stellen, als wäre er mit der vollen regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt gewesen, ist § 1 Abs. 1 Nds. VwVfG in Verbindung mit § 51 Abs. 5 VwVfG und § 48 Abs. 1 VwVfG4. Danach kann die Behörde ein abgeschlossenes Verwaltungsverfahren nach pflichtgemäßem Ermessen zu Gunsten des Betroffenen wiederaufgreifen und eine neue – der gerichtlichen Überprüfung zugängliche – Sachentscheidung treffen (so genanntes Wiederaufgreifen im weiteren Sinne). Der Ermessensspielraum ist jedoch bei Maßnahmen, die dauerhaft Rechtswirkungen entfalten (so genannte Dauerverwaltungsakte) – bei Teilzeitanordnungen handelt es sich um Dauerverwaltungsakte5 – und auf einer verfassungswidrigen Rechtsgrundlage beruhen, erheblich eingeschränkt. Wird das Gesetz, auf das der Dauerverwaltungsakt gestützt ist, durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für nichtig erklärt, folgt daraus in aller Regel, dass die Behörde den Verwaltungsakt auf Antrag des Betroffenen mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Nichtigerklärung an die dadurch geschaffene Rechtslage anpassen muss. Das Ermessen ist insoweit zu Gunsten des Betroffenen auf Null reduziert; dieser hat einen Anspruch darauf, künftig verfassungskonform behandelt zu werden. Dagegen handelt die Behörde regelmäßig ermessensfehlerfrei, wenn sie eine rückwirkende Anpassung des Dauerverwaltungsaktes für die Zeit vor der Nichtigerklärung ablehnt. Der Nichtigerklärung muss für die Zukunft Rechnung getragen werden, während sie für die Vergangenheit folgenlos bleiben kann6. In den Regelungen des § 79 Abs. 2 Satz 1 und 2 BVerfGG kommt zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber bis zur Nichtigerklärung des dem Dauerverwaltungsakt zugrunde liegenden Gesetzes der Rechtssicherheit, für die Zeit danach aber der materiellen Gerechtigkeit den Vorrang einräumt. Die Unanfechtbarkeit des Dauerverwaltungsaktes kann nicht dazu führen, dass dieser trotz feststehender Verfassungswidrigkeit für die Zukunft weiterhin Rechtswirkungen entfaltet7. Diese Grundsätze gelten auch für bestandskräftige Anordnungen, die den Beamten ohne deren Einverständnis und damit verfassungswidrig Teilzeitbeschäftigung auferlegen. Die Nichtigerklärung der zugrunde liegenden gesetzlichen Regelungen muss die Aufhebung der Teilzeitanordnungen für die Zukunft nach sich ziehen8.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 19.09.2007 die Vorschrift des früheren § 80 c NBG, auf der die dem Beamten gegenüber im Zusammenhang mit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe mündlich getroffene Teilzeitanordnung beruhte, für nichtig erklärt. Der Beamte hatte bereits vor seiner Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe, nachdem die Stadt ihm deutlich gemacht hatte, dass er nur unter der Voraussetzung einer Teilzeitbeschäftigung in das Beamtenverhältnis eingestellt werden könne, gebeten, bei Gelegenheit zu prüfen, ob eine Vollzeitbeschäftigung realisierbar sei. Im August 2008 hat er sodann ausdrücklich unter Berufung auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 die Umwandlung der Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung beantragt. Spätestens den vorgenannten Antrag hätte die Stadt zum Anlass nehmen müssen, durch Aufhebung der verfassungswidrigen Teilzeitanordnung einen verfassungskonformen Zustand herzustellen, und zwar mit Wirkung ab dem 1.10.2007, dem auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 folgenden Monat. Das Ermessen der Stadt zur Rücknahme der Teilzeitanordnung war ab diesem Zeitpunkt auf Null reduziert9.
Der Anspruch des Beamten, für die Vergangenheit besoldungs- und versorgungsrechtlich so gestellt zu werden, als wäre er vollzeitbeschäftigt gewesen, ist vorliegend nicht verwirkt oder verjährt.
Die Verwirkung als Hauptanwendungsfall des Verbots widersprüchlichen Verhaltens (venire contra factum proprium) bedeutet, dass ein Recht nicht mehr ausgeübt werden darf, wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung längere Zeit verstrichen ist und besondere Umstände hinzutreten, die die späte Geltendmachung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Das ist insbesondere der Fall, wenn der Verpflichtete infolge eines bestimmten Verhaltens des Berechtigten darauf vertrauen durfte, dass dieser das Recht nach so langer Zeit nicht mehr geltend machen würde (Vertrauensgrundlage), der Verpflichtete ferner tatsächlich darauf vertraut hat, dass das Recht nicht mehr ausgeübt würde (Vertrauenstatbestand) und sich infolgedessen in seinen Vorkehrungen und Maßnahmen so eingerichtet hat, dass ihm durch die späte Durchsetzung des Rechts ein unzumutbarer Nachteil entstehen würde10.
Ob ein Recht verwirkt ist und die Ausübung beziehungsweise Geltendmachung deshalb unzulässig geworden ist, kann immer nur angesichts der besonderen Umstände des konkreten Einzelfalls beurteilt werden11. Ein Recht kann allerdings nur verwirkt werden, wenn und soweit es zur Disposition des jeweiligen Inhabers steht. Hinsichtlich unverzichtbarer Rechte und Befugnisse und in Bereichen, in denen dem öffentlichen Interesse besonderes Gewicht zukommt, ist eine Verwirkung in der Regel nicht möglich12.
Nach Maßgabe der vorstehend dargestellten Grundsätze ist das Recht des Beamten, die streitigen Begehren gegen die Stadt geltend zu machen, nicht verwirkt.
Insoweit ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass es vorliegend um unverzichtbare Rechte des Beamten geht. Denn der Beamte kann als Beamter auf die ihm gesetzlich zustehende Besoldung oder Versorgung weder ganz noch teilweise verzichten (vgl. § 1 Abs. 2 NBesG i. V. m. § 2 Abs. 3 BBesG in der bis zum 31.08.2006 geltenden Fassung vom 06.08.2002 – BBesG a. F., BGBl. I S. 3020; § 3 Abs. 3 NBeamtVG). Zur Durchsetzung der besoldungs- und versorgungsrechtlichen Ansprüche hat es nicht eines zeitnah gestellten Antrags des Beamten bedurft, da Ansprüche auf Besoldung oder Versorgung kraft Gesetzes zu erfüllen sind und von dem Beamten nicht geltend gemacht werden müssen. Die Ansprüche auf Zahlung der vollen Dienstbezüge und der einer Vollzeitbeschäftigung entsprechenden Versorgung ergeben sich als Erfüllungsansprüche unmittelbar aus den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen13.
Abgesehen davon, dass es vorliegend um unverzichtbare Rechte des Beamten geht, sind in diesem konkreten Einzelfall aber auch die dargestellten Voraussetzungen der Verwirkung nicht erfüllt. Der Beamte hat zwar erstmals am 25.07.2011 ausdrücklich seine besoldungs- und versorgungsrechtliche Gleichstellung mit einem in Vollzeit eingestellten Beamten beantragt. Es liegen jedoch keine besonderen Umstände vor, die die späte Geltendmachung des Begehrens als Verstoß des Beamten gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Insoweit ist zum einen zu berücksichtigen, dass der Beamte schon anlässlich seiner Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe gebeten hatte, bei Gelegenheit zu prüfen, ob aus beamten- und versorgungsrechtlichen Gründen eine Vollzeitbeschäftigung realisierbar sei. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass der Beamte bereits im August 2008 unter Berufung auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 die Umwandlung seiner Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung begehrt hatte. Diesem Antrag musste die Stadt – wie schon ausgeführt wurde – bei verständiger und sorgfältiger Würdigung des Begehrens entnehmen, dass er sich auf den Zeitpunkt der Nichtigerklärung des früheren § 80 c NBG bezieht. Die Stadt war ihrerseits verpflichtet, spätestens auf den von dem Beamten im August 2008 gestellten Antrag durch Aufhebung der verfassungswidrigen Teilzeitanordnung mit Wirkung ab dem 1.10.2007 einen verfassungskonformen Zustand herzustellen. Dies hat sie versäumt, obwohl sie, wie der zur Personalakte des Beamten genommene Vermerk einer Mitarbeiterin der Stadt belegt, die Verfassungswidrigkeit der dem Beamten gegenüber getroffenen Teilzeitanordnung spätestens am 6.06.2008 erkannt hatte. Die Stadt hat die Teilzeitbeschäftigung des Beamten auch nicht etwa unverzüglich nach diesem Zeitpunkt in eine Vollzeitbeschäftigung umgewandelt. Hierüber ist vielmehr mehr als drei Monate später am 16.09.2008 im Verwaltungsausschuss der Stadt zunächst einmal diskutiert worden, und zwar streitig. Dabei hat der damalige Oberbürgermeister F. deutlich seine Verärgerung über das Begehren des Beamten zum Ausdruck gebracht, seine Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung umzuwandeln, obwohl das Begehren des Beamten berechtigt war.
Die Teilzeitbeschäftigung des Beamten ist sodann auch nicht – wie es in der Beschlussvorlage vorgesehen war – zum 1.10.2008 in eine Vollzeitbeschäftigung umgewandelt worden, sondern erst zum 1.01.2009. Den Beamten hat die Stadt hierüber erst im Nachhinein mit Schreiben vom 14.01.2009 informiert. Der Beamte hat gegen diese Maßnahme zwar keinen Widerspruch eingelegt. Die Rechtsauffassung der Stadt, mit ihrer Entscheidung, die Teilzeitbeschäftigung des Beamten ab dem 1.01.2009 in eine Vollzeitbeschäftigung umzuwandeln, habe sie konkludent auch das Begehren des Beamten für die Vergangenheit abgelehnt, teilt das Oberverwaltungsgericht jedoch nicht. Mit der rückwirkenden Umwandlung der Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung hat sich die Stadt ausweislich des Verwaltungsvorganges überhaupt nicht befasst. In der Vorlage zur Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt vom 16.09.2008 ist lediglich auf die Verpflichtung hingewiesen worden, die Teilzeitbeschäftigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in eine Vollzeitbeschäftigung umzuwandeln. Eine rückwirkende Umwandlung der Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung ist auch nicht in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 16.09.2008 diskutiert worden. Dementsprechend ist auch in dem Schreiben der Stadt vom 14.01.2009 keine Feststellung getroffen worden, die als konkludente Ablehnung des Begehrens des Beamten für die Vergangenheit gewertet werden kann. Es trifft deshalb nicht zu, dass – wie die Stadt meint – über die rückwirkende Umwandlung der Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung mit dem Schreiben vom 14.01.2009 bestandskräftig und ablehnend entschieden worden und die Klage deshalb verfristet sei.
Die Stadt kann auch nicht mit Erfolg einwenden, eventuelle bis zum 31.12 2007 entstandene Ansprüche seien jedenfalls mit Ablauf des 31.12 2010 verjährt, weil dem Beamten der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 spätestens seit Ende 2007 bekannt sei.
Die von dem Beamten mit der Klage verfolgten Ansprüche unterfallen allerdings der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren gemäß § 195 BGB14.
Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Dies war vorliegend hinsichtlich der bis zum 31.12 2007 entstandenen Ansprüche des Beamten der Ablauf des Jahres 2007.
Außerdem setzt der Verjährungsbeginn gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB voraus, dass der Gläubiger – hier der Beamte – von den Tatsachen, die den Anspruch begründen, Kenntnis erlangt hat oder diese ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen können. Der Gläubiger muss den Hergang in seinen Grundzügen kennen und wissen, dass der Sachverhalt erhebliche Anhaltspunkte für die Entstehung des Anspruchs bietet. Maßgebend und entscheidend ist dabei, ob der Gläubiger aufgrund der ihm bekannten Tatsachen gegen eine bestimmte Person Klage erheben kann, das heißt dem Anspruchsberechtigten muss die Erhebung einer entsprechenden Klage erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos möglich, mithin zumutbar sein. Hingegen ist es aus Gründen der Rechtssicherheit und der Billigkeit in der Regel nicht erforderlich, dass der Anspruchsberechtigte aus den ihm bekannten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zieht15.
Der von der Stadt schon erstinstanzlich vorgetragenen Behauptung, der Beamte habe den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 spätestens seit Ende 2007 gekannt, ist der Beamte in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht ausdrücklich entgegengetreten. Der Beamte hat seinerzeit auf Befragen durch die Prozessbevollmächtigte der Stadt erklärt, er habe (erst) im Jahre 2008 durch einen Zeitungsartikel von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Kenntnis erlangt und sich daraufhin mündlich mit der Bitte an die Stadt gewandt, ihn nach Maßgabe dieser Rechtsprechung mit einem Vollzeitbeschäftigten gleichzustellen. Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen, dass dieses Vorbringen des Beamten nicht der Wahrheit entspricht, sind von der Stadt nicht vorgetragen worden und im Übrigen auch sonst nicht ersichtlich.
Dem Beamten ist auch nicht eine grob fahrlässige Unkenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB vorzuhalten. Grob fahrlässige Unkenntnis im Sinne der vorgenannten Vorschrift setzt einen objektiv schweren und subjektiv nicht entschuldbaren Verstoß gegen die Anforderungen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt voraus. Sie liegt vor, wenn dem Gläubiger die Kenntnis fehlt, weil er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich grobem Maß verletzt und auch ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt oder das nicht beachtet hat, was jedem hätte einleuchten müssen; ihm muss persönlich ein schwerer Obliegenheitsverstoß in seiner eigenen Angelegenheit der Anspruchsverfolgung vorgeworfen werden können16.
Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist das Oberverwaltungsgericht in dem vorliegenden Einzelfall zu der Überzeugung gelangt, dass dem Beamten nicht vorgeworfen werden kann, infolge grober Fahrlässigkeit bis zum Ende des Jahres 2007 nicht von dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 Kenntnis erlangt zu haben. Der Beamte ist zwar Volljurist und von der Stadt im Jahr 2005 auf der Grundlage des damaligen § 80 c NBG, den das Bundesverfassungsgericht mit dem genannten Beschluss für nichtig erklärt hat, in das Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt worden. Das Oberverwaltungsgericht hält es jedoch nicht für gerechtfertigt, dem Beamten vorzuwerfen, dadurch einen schweren Obliegenheitsverstoß begangen zu haben, dass er nicht schon vor dem Ablauf des Jahres 2007 bei der Stadt unter Berufung auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 seine besoldungs- und versorgungsrechtliche Gleichstellung mit einem vollzeitbeschäftigten Beamten beantragt hat. Für diese Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass die vollständige Fassung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 erst Ende des Jahres 2007 veröffentlicht worden ist, und zwar in speziellen öffentlich-rechtlichen Fachzeitschriften17. In Heft 51 vom 17.12 2007 der Zeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift“ ist nur der Leitsatz der Entscheidung veröffentlicht worden. In der von den niedersächsischen Behörden möglicherweise überwiegend vorgehaltenen Zeitschrift „Niedersächsische Verwaltungsblätter“ ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 sogar erst Anfang des Jahres 2008 mit seiner vollständigen Fassung abgedruckt worden18. Zuvor war in der Ausgabe Nummer 51 des Bundesgesetzblatts I vom 22.10.2007 lediglich die Entscheidungsformel des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 abgedruckt worden.
Die Kenntnis der Entscheidungsformel und/oder des Leitsatzes des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 boten noch nicht erhebliche Anhaltspunkte für die Entstehung des streitigen besoldungs- und versorgungsrechtlichen Anspruchs. Das Oberverwaltungsgericht hält es auch nicht für gerechtfertigt, dem Beamten vorzuwerfen, dass er dadurch die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerer Weise vernachlässigt hat, dass er die genannten speziellen öffentlich-rechtlichen Fachzeitschriften nicht vorgehalten und hinsichtlich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2007 im Blick gehabt hat. Dass der Beamte problemlos auf diese Zeitschriften zugreifen konnte, etwa in dem Bestand der von der Stadt abonnierten Zeitschriften, ist nicht vorgetragen worden und zudem auch nicht ersichtlich.
Der Beamte kann allerdings nicht beanspruchen, dass die Stadt ihm gemäß § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB bereits seit der Ablehnung der Nachzahlung unter dem Gesichtspunkt des Verzuges Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gewährt. Denn die allgemeinen Grundsätze über Verzinsung öffentlich-rechtlicher Ansprüche sind dadurch gekennzeichnet, dass Verzugszinsen nur aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Regelung im jeweiligen Fachrecht gewährt werden19. Eine solche gesetzliche Grundlage existiert für den von dem Beamten geltend gemachten Anspruch nicht.
Die Stadt ist jedoch verpflichtet, dem Beamten in entsprechender Anwendung der §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an, das heißt seit dem 25.08.2011, Prozesszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu gewähren20.
Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 8. Juli 2014 – 5 LB 10/14
- BVerfG, Beschluss vom 19.09.2007 – 2 BvF 3/02[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 08.05.2013, a. a. O., Rn 8; Urteil vom 17.06.2010 – BVerwG 2 C 86.0818[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 17.06.2010, a. a. O., Rn 19 m. w. N.[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 24.02.2011 – BVerwG 2 C 50.0910; Beschluss vom 08.05.2013, a. a. O., Rn 9[↩]
- vgl. BVerwG, Beschluss vom 08.05.2013, a. a. O., Rn 9[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 08.05.2013, a. a. O., Rn 10[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 08.05.2013, a. a. O., Rn 11; Urteil vom 25.10.2012 – BVerwG 2 C 59.1128 f.; Urteil vom 26.09.2012 – BVerwG 2 C 48.1125 ff.[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 08.05.2013, a. a. O., Rn 12[↩]
- vgl. BVerwG, Beschluss vom 08.05.2013, a. a. O., Rn 14; Urteil vom 25.10.2012, a. a. O., Rn 20 ff.[↩]
- BVerwG, Urteil vom 17.03.2008 – 6 C 22.0741 m. w. N.; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 03.04.2012 – 5 B 59.114 m. w. N.; Beschluss vom 29.10.2008 – BVerwG 2 B 22.084 m. w. N.; Kopp/Ramsauer, a. a. O., § 53 Rn 41 ff.[↩]
- vgl. BVerfG, Entscheidung vom 26.01.1972 – 2 BvR 255/6724; BVerwG, Urteil vom 25.01.1974 – 4 C 2.7223[↩]
- Kopp/Ramsauer, a. a. O., § 53 Rn 44 m. w. N.[↩]
- NBesG, BBesG a. F., NBeamtVG; vgl. BVerwG, Urteil vom 17.06.2010, a. a. O., Rn 29 f.[↩]
- vgl. etwa Nds. OVG, Beschluss vom 15.04.2014 – 5 LA 84/1310 m. w. Nw.[↩]
- BVerwG, Urteil vom 26.07.2012 – BVerwG 2 C 70.1137; Nds. OVG, Beschluss vom 15.04.2014, a. a. O., Rn 17; Beschluss vom 19.05.2014 – 5 LA 227/13[↩]
- Nds. OVG, Beschluss vom 15.04.2014, a. a. O., Rn 19; BGH, Urteil vom 10.05.2012 – I ZR 145/1123 m. w. Nw.[↩]
- vgl. zum Beispiel NVwZ, Heft Dezember 2007 vom 15.12.2007, S. 1396 ff.; ZBR, Heft November 2007, S. 381 ff.; DVBl, Heft 21 vom 01.11.2007, S. 1359 ff.[↩]
- Nds. VBl., Heft Januar 2008, S. 9 ff.[↩]
- BVerwG, Urteil vom 22.02.2001 – BVerwG 5 C 34.0014; Urteil vom 12.06.2002 – BVerwG 9 C 6.0150[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 22.02.2001, a. a. O., Rn 6 und 14; Urteil vom 15.06.2006 – BVerwG 2 C 14.0520; Urteil vom 17.06.2010, a. a. O., Rn 31; Nds. OVG, Urteil vom 13.01.2009 – 5 LB 312/0848[↩]