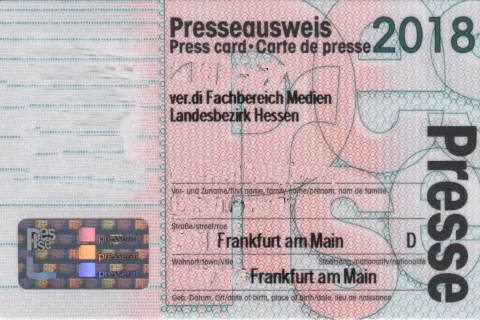Vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin war jetzt der Antrag des Abgeordneten Martin Delius im Organstreitverfahren gegen den Berliner Bundesverfassungsgericht wegen Verletzung des Fragerechts überwiegend erfolgreich. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat dem Antrag des Mitglieds des Abgeordnetenhauses Martin Delius auf Feststellung der Verletzung seines parlamentarischen Fragerechts aus Art. 45 Abs. 1 der Verfassung von Berlin – VvB – durch den Senat von Berlin überwiegend stattgegeben.

Die Entscheidung im Überblick[↑]
Der Antragsteller beanstandete die erst im verfassungsgerichtlichen Verfahren erfolgte Beantwortung von zwei Fragen, die Gegenstand einer schriftlichen Anfrage zum Themenkomplex Flughafen BER waren. Seit Juni 2012 hatte er hierzu insgesamt über 100 parlamentarische Anfragen an das Bundesverfassungsgericht gerichtet.
Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag für zulässig gehalten. Das Rechtsschutzbedürfnis des Abgeordneten entfällt nicht durch das Nachholen einer zuvor unterbliebenen Auskunftserteilung, wenn nicht das Bundesverfassungsgericht zugleich die Verpflichtung aus Art. 45 Abs. 1 VvB vorbehaltlos anerkennt. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Verletzung des Fragerechts des Abgeordneten Delius bestritten.
Dem verfassungsrechtlich verbürgten Fragerecht des Abgeordneten entspricht eine grundsätzliche Antwortpflicht des Bundesverfassungsgerichts. Der Informationsanspruch des Abgeordneten wird lediglich durch das Gewaltenteilungsprinzip, das Staatswohl, Grundrechte Dritter, den Schutz der Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Regierung sowie durch eine Missbrauchsgrenze begrenzt. Will das Bundesverfassungsgericht von seiner grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht abweichen, Informationsansprüche der Abgeordneten zu erfüllen, muss er innerhalb der in der Verfassung von Berlin bestimmten dreiwöchigen Antwortfrist die Gründe dafür darlegen. Dem Bundesverfassungsgericht ist hinsichtlich des Umfangs seiner Antwort auf beantwortungsbedürftige schriftliche Anfragen ein Spielraum eingeräumt, der durch die Pflicht zur vollständigen und zutreffen-den Antwort begrenzt wird.
Das Bundesverfassungsgericht hat in dem vom Verfassungsgerichtshof entschiedenen Verfahren gegen das Fragerecht des Abgeordneten Delius verstoßen, indem er in seiner Antwort nicht ausgeführt hatte, welche von der schriftlichen Anfrage erfassten Sitzungsprotokolle ihm vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung übermittelt worden sind. Darüber hinaus hatte er zunächst nicht beantwortet, ob er mit Sicherheit ausschließen könne, dass ihn Pro-tokolle auf anderem Wege erreicht haben. Die weitere Teilfrage des Antragstellers, ob das Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit ausschließen könne, dass ihm sämtliche Protokolle in aller Vollständigkeit vorliegen, hatte der Antragsgegner dagegen ausreichend beantwortet.
Zulässigkeit des Organstreitverfahrens[↑]
Der Antrag ist zulässig.
Der Antrag ist nach Art. 84 Abs. 2 Nr. 1 der Verfassung von Berlin – VvB, § 14 Nr. 1 VerfGHG statthaft. Im Wege des Organstreits können Verletzungen oder Gefährdungen der durch die Verfassung von Berlin übertragenen Rechte und Pflichten durch Maßnahmen oder Unterlassungen der in § 36 VerfGHG i. V. m. § 14 Nr. 1 VerfGHG bezeichneten Organe geltend gemacht werden. Insofern kommt es nicht darauf an, ob es sich bei den gerügten Antworten des Antragsgegners jeweils um eine Maßnahme in Form der Verweigerung einer hinreichenden Antwort oder um ein Unterlassen in Form einer pflichtwidrigen Nichtbeantwortung oder einer nicht hinreichenden Beantwortung der jeweiligen Anfrage handelt1.
Der Antragsteller wird als Abgeordneter durch Art. 38 Abs. 4 und Art. 45 VvB sowie durch die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses mit eigenen Rechten ausgestattet und ist damit gemäß § 36 VerfGHG i. V. m. § 14 Nr. 1 VerfGHG parteifähig. Die Parteifähigkeit des Bundesverfassungsgerichts als oberstem Landesorgan (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 VvB) folgt ebenfalls aus § 36 i. V. m. § 14 Nr. 1 VerfGHG.
Der Antrag ist auch innerhalb der Sechsmonatsfrist des § 37 Abs. 3 VerfGHG gestellt worden.
Das Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers an der Klärung der von ihm aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Frage besteht fort. Dieses ist insbesondere nicht dadurch nachträglich entfallen, dass der Antragsgegner dem Antragsteller die mit der schriftlichen Anfrage begehrten Informationen im Laufe des Organstreitverfahrens hat zukommen lassen. Das Rechtsschutzbedürfnis entfällt grundsätzlich nicht durch das Nachholen einer zuvor unterbliebenen Auskunftserteilung2. Im Organstreitverfahren geht es nicht nur um die Durchsetzung bestimmter Auskunftsrechte des Antragstellers, sondern um die objektive Klärung der zwischen den beteiligten Organen streitigen verfassungsrechtlichen Fragen. Durch die Entscheidung soll in diesem Bereich Rechtsfrieden auch für die Zukunft hergestellt werden3. Etwas anderes gilt, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht nur die Frage beantwortet, sondern auch die vom Abgeordneten behauptete Verpflichtung aus Art. 45 Abs. 1 VvB vorbehaltlos anerkennt4. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Der Antragsgegner bestreitet weiterhin eine Verletzung des parlamentarischen Fragerechts des Antragstellers.
Fragerecht der (Berliner) Abgeordneten[↑]
Abs. 1 Satz 1 VvB schützt das Recht jedes Abgeordneten, sich im Abgeordnetenhaus und in den Ausschüssen durch Rede, Anfragen und Anträge an der Willensbildung und Entscheidungsfindung zu beteiligen. Die Rechte der einzelnen Abgeordneten können nur insoweit beschränkt werden, wie es für die gemeinschaftliche Ausübung der Mitgliedschaft im Parlament notwendig ist (Art. 45 Abs. 1 Satz 2 VvB). Das Fragerecht wird nach Art. 45 Abs. 1 Satz 3 VvB durch schriftliche Anfragen und spontane Fragen ausgeübt. Schriftliche Anfragen sind vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich innerhalb von drei Wochen schriftlich zu beantworten. Sie dürfen nicht allein wegen ihres Umfangs zurückgewiesen werden, Art. 45 Abs. 1 Satz 4 VvB, § 50 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses – GOAbgh -.
Das verfassungsrechtlich verbürgte Fragerecht des Abgeordneten, dem eine grundsätzliche Antwortpflicht des Bundesverfassungsgerichts entspricht5, dient als Minderheitenrecht in erster Linie dazu, Informationen zur Kontrolle der Regierung zu gewinnen. Es erstreckt sich daher nur auf Bereiche, für die die Regierung verantwortlich ist6. Begrenzt wird der Informationsanspruch des Abgeordneten ferner durch das Gewaltenteilungsprinzip, das den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung schützt7, das Staatswohl8, Grundrechte Dritter9 sowie den aus dem Verfassungsgebot zu gegenseitiger Rücksichtnahme der Verfassungsorgane folgenden Schutz der Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Regierung10. Das Fragerecht wird auch durch eine Missbrauchsgrenze beschränkt11.
Will das Bundesverfassungsgericht von seiner grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht abweichen, Informationsansprüche der Abgeordneten zu erfüllen, muss er die Gründe darlegen, aus denen er die erbetenen Auskünfte verweigert. Der Abgeordnete kann seine Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle des Regierungshandelns nur dann effektiv wahrnehmen, wenn er anhand einer der jeweiligen Problemlage angemessen ausführlichen Begründung beurteilen und entscheiden kann, ob er die Verweigerung der Antwort akzeptiert oder ob er um verfassungsgerichtlichen Rechtschutz nachsucht. Eine Begründung der Antwortverweigerung ist daher nur dann entbehrlich, wenn sie evident ist12. Die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Pflicht zur Benennung der Ablehnungsgründe kann nicht in ein sich anschließendes Organstreitverfahren verlagert werden. Dieses dient allein der Nachprüfung, ob ein bestimmter – abgeschlossener – Vorgang den Abgeordneten in seinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt. In der Antragserwiderung oder sonst im Verlauf des Organstreitverfahrens erstmals genannte, d. h. nachgeschobene Gründe können mithin eine bereits erfolgte Ablehnung der Beantwortung einer Frage nicht rechtfertigen13.
Allerdings ist dem Bundesverfassungsgericht hinsichtlich des Umfangs seiner Antwort auf grundsätzlich beantwortungsbedürftige schriftliche Anfragen ein Spielraum eingeräumt. Er darf unter anderem entscheiden, wie er seine Antwort abfasst, in welchem Umfang er auf Einzelheiten eingeht und ob er sogleich oder erst nach gründlicher Auseinandersetzung mit der Frage antwortet. Zulässig ist es danach auch, wenn lediglich zusammenfassende, sich auf den Kern der Frage konzentrierende Antworten gegeben werden14. Begrenzt wird dieser Antwortspielraum jeweils durch die Pflicht des Bundesverfassungsgerichts zur vollständigen und zutreffenden Antwort15.
Die streitgegenständlichen Fragen zum Flughafen BER[↑]
Der vorliegende Antrag ist überwiegend begründet. Die Antwort des Regierenden Bürgermeisters vom 24.03.2014 verletzt das Recht des Antragstellers aus Art. 45 Abs. 1 VvB in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang.
Nach diesen Maßgaben verletzt die unterbliebene Beantwortung der Frage 1 und Frage 2 (2. Teil) der schriftlichen Anfrage vom 03.03.2014 durch die Antwort des Antragsgegners vom 24.03.2014 den Antragsteller in seinem Fragerecht aus Art. 45 Abs. 1 VvB. Hinsichtlich der Frage 2 (1. Teil) liegt dagegen kein Verfassungsverstoß vor.
Der Antragsgegner hat in seiner Antwort vom 24.03.2014 weder ausgeführt, welche Protokolle der Sitzungen der „Soko BER“ ihm vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung übermittelt worden sind (Frage 1), noch, ob er mit Sicherheit ausschließen kann, dass ihn Protokolle auf anderem Wege erreicht haben (Frage 2 – 2. Teil).
Das Bundesverfassungsgericht war dem Grunde nach aber verpflichtet, dem Antragsteller die genannten Informationen mitzuteilen. Eine Auslegung der schriftlichen Anfrage vom 03.03.2014 anhand der allgemeinen Auslegungsgrundsätze16 dahingehend, dass es dem Antragsteller nicht im Wesentlichen um die konkrete Benennung der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung übermittelten Protokolle der Sitzungen der „Soko BER“ (Frage 1) bzw. der Übermittlung von Protokollen auf anderen Wegen als durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Frage 2 – 2. Teil) ging, ist angesichts des eindeutigen Wortlauts der Fragen nicht möglich.
Eine ausnahmsweise Befreiung des Antragsgegners von seiner grundsätzlichen Antwortverpflichtung ist nicht ersichtlich. Soweit die Antragserwiderung unter Hinweis auf eine große Zahl parlamentarischer Anfragen zum Themenkomplex BER seit Juni 2012 erstmalig eine mögliche Beeinträchtigung der Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts andeutet, ist diese Begründung für das Unterbleiben der Informationserteilung bereits nicht rechtzeitig mit der Informationsverweigerung erfolgt.
Darüber hinaus hat der Antragsgegner auch nicht dargetan, dass die konkrete Beantwortung der Fragen 1 und 2 (2. Teil) innerhalb der Dreiwochenfrist aus Art. 45 Abs. 1 Satz 4 VvB, § 50 Abs. 1 Satz 3 GOAbgh nicht möglich gewesen wäre. Hierfür ist angesichts des Umfangs der in der Antragserwiderung enthaltenen Informationen auch sonst nichts ersichtlich.
Ohne Erfolg wendet der Antragsgegner schließlich ein, er habe sich angesichts erkennbaren Informationsinteresses hinsichtlich der Zahl und des Datums der erhaltenen Protokolle sowie der Art und Weise der Erlangung bei seiner Antwort zulässigerweise auf den Kern der Fragen 1 und 2 (2. Teil) konzentriert. Der Antragsgegner kann sich insoweit nicht auf seine Einschätzungsprärogative beim Umfang der von ihm geschuldeten Antworten berufen. Führt die zusammenfassende Beantwortung von in einer schriftlichen Anfrage enthaltenen Teilfragen dazu, dass diese vollständig unbeantwortet bleiben, betrifft dies die grundsätzlich bestehende Antwortpflicht des Bundesverfassungsgerichts (das „Ob“), während ein Einschätzungsspielraum nur hinsichtlich der Art und Weise der Beantwortung (des „Wie“) anzunehmen sein kann. In diesem Zusammenhang steht es dem Bundesverfassungsgericht nicht zu, die Zielrichtung der Fragen von Abgeordneten zu beurteilen; vielmehr müssen diese selbst darüber befinden können, welcher Informationen sie für eine verantwortliche Erfüllung ihrer Aufgaben bedürfen17.
Für die Beurteilung, ob die Beantwortung einer schriftlichen Anfrage das Fragerecht des Abgeordneten aus Art. 45 Abs. 1 VvB verletzt, ist schließlich unerheblich, ob eine willentliche Auskunftsverweigerung oder eine Verhüllungsabsicht des Bundesverfassungsgerichts vorgelegen hat. Verschuldensaspekte spielen insoweit keine Rolle.
Die Frage des Antragstellers, ob das Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit ausschließen könne, dass ihm sämtliche Protokolle der „Soko BER“ in aller Vollständigkeit vorliegen (Frage 2 – 1. Teil), hat der Antragsgegner dagegen ausreichend beantwortet. Die gewählte Art der Abfassung der Antwort hält sich innerhalb seines Einschätzungsspielraums. Der Antragsgegner hat in seiner Antwort vom 24.03.2014 ausgeführt, es handele sich um keine gemeinsame Arbeitsgruppe der drei Gesellschafter, sondern um eine verwaltungsinterne Arbeitseinheit des Bundes, die zur Meinungsbildung eines Gesellschafters eingerichtet worden sei. Es sei daher nachvollziehbar, dass deren Unterlagen nicht durchgängig weitergegeben worden seien. Hieraus wird hinreichend deutlich, dass dem Antragsgegner nicht sämtliche Sitzungsprotokolle vorlagen.
Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Beschluss vom 18. Februar 2015 – VerfGH 92/14
- vgl. BVerfG, Urteil vom 21.10.2014 – 2 BvE 5/11 106[↩]
- vgl. Niedersächsischer Staatsgerichtshof, Urteil vom 17.08.2012 – 1/12, StGH 1/12 50; VerfG Brandenburg, Beschlüsse vom 28.03.2001 – 46/00 34; und vom 16.11.2000 – 31/00 47[↩]
- vgl. Bayerischer VerfGH, Entscheidung vom 22.05.2014 – Vf. 53-IVa-13 25 m. w. N.[↩]
- vgl. VerfGH Sachsen, Beschluss vom 18.03.2004 – Vf. 62-I-03[↩]
- vgl. BVerfG, Urteil vom 21.10.2014, a. a. O. 130 m. w. N.[↩]
- vgl. BVerfG, Urteil vom 21.10.2014, a. a. O. 135; Bayerischer VerfGH, Entscheidung vom 22.05.2014, a. a. O. 33, jeweils m. w. N.[↩]
- vgl. BVerfG, Urteil vom 21.10.2014, a. a. O. 136; VerfGH Sachsen, Urteil vom 30.09.2014 – Vf. 69-I-13 24[↩]
- vgl. BVerfG, Urteil vom 21.10.2014, a. a. O. 150; Hamburgisches VerfG, Urteil vom 06.11.2013 – HVerfG 6/12 55[↩]
- vgl. BVerfG, Urteil vom 21.10.2014, a. a. O. 154[↩]
- vgl. VerfG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 23.01.2014 – LVerfG 8/13 22; Hamburgisches VerfG, Urteil vom 06.11.2013, a. a. O.[↩]
- Hamburgisches VerfG, Urteil vom 06.11.2013, a. a. O. 56 m. w. N.[↩]
- vgl. BVerfG, Urteil vom 21.10.2014, a. a. O. 157[↩]
- vgl. VerfGH Sachsen, Urteil vom 30.09.2014, a. a. O. 26; Bayerischer VerfGH, Entscheidung vom 11.09.2014, a. a. O. 40, jeweils m. w. N.[↩]
- vgl. Bayerischer VerfGH, Entscheidung vom 06.06.2011, a. a. O. 102[↩]
- vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 19.08.2008 – 7/07 249[↩]
- vgl. Niedersächsischer Staatsgerichtshof, Urteil vom 17.08.2012 – StGH 1/12 56[↩]
- vgl. VerfG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 23.01.2014, a. a. O. 21 m. w. N.[↩]