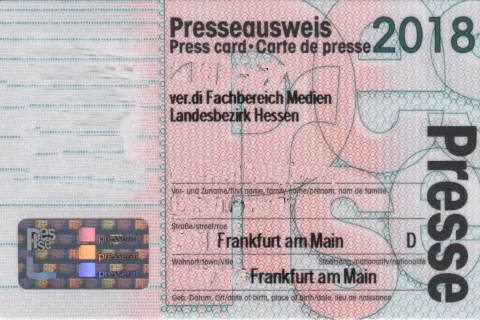Das Bundesverfassungsgericht hat einen konkreten Normenkontrollantrag des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, der die Frage betraf, ob das Gesetz über die Errichtung und den Betrieb einer Kohlenmonoxid-Rohrleitungsanlage zwischen Dormagen und Krefeld-Uerdingen mit Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG vereinbar sei, als unzulässig behandelt.

Ausgangssachverhalt[↑]
Die Vorlage des Oberverwaltungsgerichts betrifft die Frage, ob das Gesetz über die Errichtung und den Betrieb einer Rohrleitungsanlage zwischen Dormagen und Krefeld-Uerdingen vom 21.03.20061 (im Folgenden: Rohrleitungsgesetz – RohrlG) mit Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG vereinbar ist. Das Rohrleitungsgesetz regelt die Zulässigkeit von Enteignungen zugunsten Privater für die Errichtung der dort beschriebenen Rohrleitungsanlage.
Die Vorhabenträgerin der Rohrleitung, die Bayer AG, betreibt Produktionsanlagen unter anderem in den Chemieparks in Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Sie beabsichtigt, im Chemiepark Dormagen produziertes gasförmiges Kohlenmonoxid mittels einer Rohrleitungsanlage zum Chemiepark Krefeld-Uerdingen zu transportieren. Die Kläger des Ausgangsverfahrens sind Eigentümer von Grundstücken in der Trasse der Rohrleitungsanlage, mittels derer im Chemiepark Dormagen produziertes gasförmiges Kohlenmonoxid zum Chemiepark Krefeld-Uerdingen transportiert werden soll.
Das Verwaltungsgericht stellte unter Klagabweisung im Übrigen fest, dass der Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig und nicht vollziehbar ist. Zur Begründung führte es aus, der Planfeststellungsbeschluss weise relevante Mängel zum Nachteil der Kläger hinsichtlich der Erdbebensicherheit bezogen auf eine mögliche Bodenverflüssigung in Teilen der Trasse und auf oberirdische Sonderbauwerke der Rohrleitungsanlage sowie hinsichtlich der Baugrunduntersuchung auf Hohlräume in verkarstungsfähigen Kalksteinzügen auf.
Auf die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung hat das Oberverwaltungsgericht das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG, § 80 Abs. 1 BVerfGG die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob § 1 Satz 1 RohrlG mit Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG vereinbar ist2.
Anforderungen an eine Richtervorlage[↑]
Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GG hat ein Gericht das Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält. Dem Begründungserfordernis des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG genügt ein Vorlagebeschluss nur, wenn die Ausführungen des Gerichts erkennen lassen, dass es sowohl die Entscheidungserheblichkeit der Vorschrift als auch ihre Verfassungsmäßigkeit sorgfältig geprüft hat3. Hierfür muss das vorlegende Gericht in nachvollziehbarer und für das Bundesverfassungsgericht nachprüfbarer Weise darlegen, dass es bei seiner anstehenden Entscheidung auf die Gültigkeit der Norm ankommt und aus welchen Gründen das vorlegende Gericht von der Unvereinbarkeit der Norm mit der Verfassung überzeugt ist4.
In diesem Zusammenhang muss das vorlegende Gericht seine für die Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit maßgeblichen Erwägungen nachvollziehbar und erschöpfend darlegen5. Der Vorlagebeschluss muss den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben, die naheliegenden tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte erörtern, sich eingehend sowohl mit der einfachrechtlichen als auch mit der verfassungsrechtlichen Rechtslage auseinandersetzen, dabei die in der Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen und insbesondere auf die maßgebliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eingehen6. Zudem muss das vorlegende Gericht die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung erörtern7 und vertretbar begründen, dass es diese nicht für möglich hält8.
Diesen Anforderungen wird die Vorlage nicht gerecht. Sie begründet die von ihr angenommene Verfassungswidrigkeit des § 1 Satz 1 RohrlG am Maßstab des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung mit der mangelnden Bestimmtheit und der fehlenden Sicherung des Enteignungszwecks durch Bindung des begünstigten Privaten an diesen nur unzureichend.
Enteignungen aufgrund des Rohrleitungsgesetzes[↑]
Das Rohrleitungsgesetz regelt die Zulässigkeit von Enteignungen für die Errichtung der dort beschriebenen Rohrleitungsanlage zugunsten Privater. Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG stellt unter den Gesichtspunkten der Bestimmtheit des Enteignungszwecks und seiner Sicherung besondere Anforderungen an ein Gesetz, das die Enteignung zugunsten Privater gestattet9.
Das zur Enteignung ermächtigende Gesetz muss hinreichend bestimmt regeln, zu welchem Zweck, unter welchen Voraussetzungen und für welche Vorhaben enteignet werden darf10.
Wie konkret der Gesetzgeber in dem jeweiligen Enteignungsgesetz das die Enteignung legitimierende Gemeinwohl benennen muss, lässt sich nicht allgemein festlegen. Dies hängt unter anderem von dessen Zusammenspiel mit den das angestrebte Gemeinwohlziel fördernden Vorhaben und deren Konkretisierung im Enteignungsgesetz ab11.
Nur selten wird ein gesetzlich bestimmtes Gemeinwohlziel unmittelbar durch einzelne Enteignungsmaßnahmen verwirklicht werden. In diesem Fall genügt eine präzise Bestimmung des Enteignungsziels durch den Gesetzgeber, sofern in dieser zugleich das dabei letztlich verfolgte Gemeinwohlziel erkennbar ist. Zumeist wird es zwischen der Inanspruchnahme einzelner Eigentumspositionen und dem Erreichen des angestrebten Gemeinwohlziels in zumindest noch einem Zwischenschritt der Realisierung konkreter Vorhaben – etwa des Baus einer Straße, eines Schienenwegs, eines Flughafens oder eines Bergbaugewinnungsbetriebs – bedürfen, zu deren Verwirklichung die Enteignungsmaßnahmen erforderlich sind. In diesen Fällen muss der Gesetzgeber nicht die konkreten Einzelvorhaben bestimmen. Er ist aber gehalten, die Vorhaben der Art nach zu benennen, über deren Verwirklichung das angestrebte Gemeinwohlziel erreicht werden soll12. Ergibt sich aus gesetzlich ihrer Art nach hinreichend bestimmten Vorhaben zugleich eindeutig der vom Gesetzgeber angestrebte Gemeinwohlzweck, ist die ausdrückliche Benennung des Gemeinwohls im Gesetz entbehrlich. Umgekehrt entlastet ihn eine präzise Umschreibung des verfolgten Gemeinwohlziels von einer näheren Festlegung der zu seiner Erreichung zulässigen Vorhaben, wenn dafür von vornherein nur Vorhaben bestimmter Art in Frage kommen, die mit der Festlegung des Gemeinwohlziels ersichtlich legitimiert sein sollen13.
Den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen aus Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG genügt hingegen eine Regelung nicht, die die Entscheidung, für welche Vorhaben und zu welchen Zwecken enteignet werden darf, faktisch in die Hand der Verwaltung legt14. Enteignungsgesetze, die eine Enteignung gestatten, um „ein dem Wohl der Allgemeinheit dienendes Vorhaben“ zu verwirklichen und dabei weder das Vorhaben noch das Wohl der Allgemeinheit näher präzisieren, wiederholen nur den Wortlaut des Grundgesetzes und verfehlen damit die dem Gesetzgeber vorbehaltene Konkretisierungsaufgabe15.
Die Verfassung schließt Enteignungen zugunsten Privater nicht aus16. Die Enteignung zugunsten Privater stellt allerdings besondere Anforderungen an die Bestimmung des verfolgten Zieles, die gesetzliche Ausgestaltung der Voraussetzungen und an die weiteren Geltungsbedingungen einer solchen Enteignung. Dabei bedarf es einer besonders sorgfältigen Prüfung, ob hinter dem verfolgten Gemeinwohlziel ein auch unter Berücksichtigung der Privatnützigkeit der Enteignung hinreichend schwerwiegendes, spezifisch öffentliches Interesse steht17.
Ordnet der Staat Enteignungen zugunsten Privater an, kann er sich trotz der grundsätzlichen Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) nicht ohne weiteres darauf verlassen, dass die enteignungsbegünstigten Privaten tatsächlich das Gemeinwohlziel verfolgen, das der Staat mit der Enteignung erreichen oder zumindest fördern will. Es bedarf daher in diesen Fällen gesetzlicher Regeln, die sicherstellen, dass begünstigte Private das enteignete Gut zur Verwirklichung des die Enteignung legitimierenden Ziels verwenden werden und dass diese Nutzung dauerhaft erfolgt, soweit sie nicht der Natur der Verwendung gemäß auf eine einmalige Inanspruchnahme beschränkt ist18.
Bei Enteignungen zugunsten Privater, die nur mittelbar dem gemeinen Wohl dienen, sind erhöhte Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit der gesetzlichen Enteignungsregeln zu stellen. So hat der Gesetzgeber unzweideutig zu regeln, ob und für welche Vorhaben eine solche Enteignung statthaft sein soll19. Die Verantwortung dafür, welches konkrete Vorhaben zur Erreichung des Gemeinwohlziels verwirklicht werden soll, welches Eigentum als dafür geeignet heranzuziehen ist und ob dessen Enteignung im Einzelfall verhältnismäßig ist, muss in den Händen des Staates bleiben. Dies gilt in den Fällen der Enteignung von Grund und Boden vor allem für die Auswahl der zu enteignenden Grundstücke.
Die Sicherung der dauerhaften Gemeinwohlnutzung des enteigneten Gutes bedarf umso genauerer und detaillierterer gesetzlicher Vorgaben, je weniger schon der Geschäftsgegenstand des privaten Unternehmens, zu dessen Gunsten die Enteignung erfolgt, darauf ausgerichtete ist, dem gemeinen Wohl zu dienen19. Das kann eine Regulierung des privatwirtschaftlichen Handelns erfordern, die durch gesetzliche Verpflichtungen gegenüber anderen Privaten oder der Allgemeinheit oder durch geeignete und effektive Zulassungs, Überwachungs- und Eingriffsrechte einer Behörde die Rückbindung des Privaten an seine Verpflichtung auf das Gemeinwohlziel sicherstellt, solange er den Nutzen aus einer Enteignung zieht20.
Das Oberverwaltungsgericht weicht mit den in seinem Vorlagebeschluss gebildeten Obersätzen und der daran anschließenden Subsumtion wesentlich von diesen sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergebenden Vorgaben hinsichtlich der Bestimmtheit des Gemeinwohlzwecks und der Sicherung des Enteignungszwecks durch Bindung des privaten Begünstigten ab. Auf dieser Grundlage ist die Begründung der Vorlage insgesamt unzureichend.
Soweit das Oberverwaltungsgericht die Gemeinwohltauglichkeit und hinreichende Bestimmtheit der in § 2 RohrlG benannten Enteignungszwecke in Abrede stellt, wird es den verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht gerecht und setzt sich nicht genügend mit den hierfür entwickelten Grundsätzen auseinander.
§ 1 Satz 1 RohrlG bestimmt, dass die Rohrleitungsanlage für die Durchleitung von Kohlenmonoxid und Kohlenmonoxid-Wasserstoffgenmischen zwischen Dormagen und Krefeld-Uerdingen dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne von Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG dient. § 2 RohrlG ist mit „Enteignungszweck“ überschrieben und beschreibt in der Sache näher, welchen Zwecken die Verwirklichung der Rohrleitung dient. Danach soll die Rohrleitungsanlage die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Kohlenmonoxidversorgung erhöhen, um dadurch die wirtschaftliche Struktur der Chemieindustrie und der mittelständischen Kunststoff verarbeitenden Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zu stärken und damit Arbeitsplätze zu sichern (§ 2 Nr. 1 RohrlG), den Verbund von Standorten und Unternehmen stärken (§ 2 Nr. 2 RohrlG), einen diskriminierungsfreien Zugang bei hoher Verfügbarkeit gewährleisten (§ 2 Nr. 3 RohrlG) und die Umweltbilanz der Kohlenmonoxidproduktion insgesamt verbessern (§ 2 Nr. 4 RohrlG). Die Errichtung und der Betrieb der Rohrleitungsanlage sind danach erkennbar von dem gesetzgeberischen Anliegen getragen, die in § 2 RohrlG näher bezeichneten wirtschaftlichen Strukturen zu stärken und dadurch zugleich Arbeitsplätze zu sichern und Umweltbelange zu fördern.
Indem das Oberverwaltungsgericht dem allgemein entgegen hält, die Sicherung der Versorgung der Industrie mit Kohlenmonoxid sei als solche selbst dann kein Gemeinwohlziel, wenn sie bislang ungesichert und unzuverlässig sei, und für die Gewährleistung des diskriminierungsfreien Zugangs bei hoher Verfügbarkeit (§ 2 Nr. 3 RohrlG) sei bereits kein Gemeinwohlbezug erkennbar, trägt es dem weiten Spielraum des Gesetzgebers bei der Bestimmung des Gemeinwohlziels und dem dementsprechend begrenzten verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab21 nicht hinreichend Rechnung. Es ist nicht erkennbar und wird vom Oberverwaltungsgericht auch nicht näher begründet, weshalb die genannten Enteignungszwecke gemessen an dem gebotenen großzügigen Maßstab keine verfassungsrechtlich zulässigen Gemeinwohlziele sein sollten. Auch daran, dass die genannten Zwecksetzungen grundsätzlich geeignet und hinreichend gewichtig sind, die für die Erreichung dieser Ziele typischerweise in Betracht kommenden Enteignungen zu rechtfertigen22, zeigt der Vorlagebeschluss keine durchgreifenden Zweifel auf. Denn ungeachtet der jeder Enteignung innewohnenden Schwere23 wird die Verwirklichung der Rohrleitung in der Regel nicht mehr als die Bestellung einer durch eine vergleichsweise geringe Belastungsintensität gekennzeichneten Grunddienstbarkeit erfordern. Hinzu kommt, dass die vom Rohrleitungsgesetz zugelassene Enteignung nicht nur dem die Anlage betreibenden Unternehmen dient, sondern einer Vielzahl von Kohlenmonoxid verarbeitenden Betrieben in der Region zugutekommt24.
Hinsichtlich der Bestimmtheit der gesetzlichen Umschreibung der Enteignungszwecke, zieht das Oberverwaltungsgericht zu weitgehende Schlüsse aus den zu § 79 Abs. 1 BBergG ergangenen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts im Urteil zum Tagebau zur Braunkohlegewinnung in Garzweiler. Dort ließ das Gericht offen, ob die in § 79 Abs. 1 BBergG für eine Enteignung genannten Tatbestandsvarianten, „die Erhaltung der Arbeitsplätze im Bergbau“ und „der Bestand oder die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur“, den Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 GG an eine hinreichend bestimmte Gemeinwohlpräzisierung genügten25. Die Festlegung der Enteignungszwecke in § 2 RohrlG ist damit nicht vergleichbar. Danach sollen durch den Bau der Pipeline nicht lediglich eine allgemein und unspezifisch benannte Branche gefördert und hierzu Enteignungen zugelassen werden. Vielmehr werden die Enteignungszwecke des § 2 RohrlG durch das im Gesetz und in den im Rahmen seiner Auslegung heranzuziehenden Gesetzesmaterialien26 in hohem Maße konkretisierte Vorhaben verfolgt: den Bau einer Rohrleitungsanlage für die Durchleitung von Kohlenmonoxid und Kohlenmonoxid-Wasserstoffgemischen von dem Chemiepark in Dormagen in den Chemiepark in Krefeld-Uerdingen, auf einer Länge von 67 km, gebaut und betrieben durch die B… AG. Damit wird durch das Rohrleitungsgesetz nicht die Enteignung zum Bau und Betrieb irgendeiner Rohrleitung zur Durchleitung von beliebigen Stoffen und Stoffgemischen gerechtfertigt. Das Vorhaben wird vielmehr seiner Art, seiner geographisch räumlichen Einbettung und Größenordnung sowie seiner Funktion nach in einer Weise gekennzeichnet, die der bezweckten Förderung wirtschaftlicher Strukturen eine klare Kontur gibt. Dass darüber hinaus – wie das Oberverwaltungsgericht bemängelt – nicht auch noch technische Grunddaten erwähnt und geregelt werden, wie etwa das Leistungsvermögen oder die tatsächliche Leistung der Rohrleitungsanlage, ist für die Bestimmtheit des Enteignungszwecks unschädlich, denn das Vorhaben und der Gemeinwohlzweck, zu deren Verwirklichung Enteignungen grundsätzlich zulässig sein sollen, sind durch die erfolgten Festlegungen durch den Gesetzgeber auch ohne diese hinreichend bestimmt.
Die weitere Annahme des Oberverwaltungsgerichts, dass die gebotene Gesamtabwägung nicht der Behörde überlassen werden dürfe, findet keine Grundlage in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. So ist unbeanstandet geblieben, dass in den Ausgangsverfahren zum Braunkohletagebau in Garzweiler die Enteignungsbehörde eine Gesamtabwägung sämtlicher für und gegen das Vorhaben sprechender Belange vorgenommen hatte27. Das Bundesverfassungsgericht hat dort zwar verlangt, dass eine Gesamtabwägung der für das Vorhaben sprechenden Gemeinwohlgründe mit den durch seine Verwirklichung beeinträchtigten öffentlichen und privaten Belangen gesetzlich vorgesehen sein muss28. Diesem Erfordernis ist hier jedoch insoweit Genüge getan, als § 20 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Verbindung mit der Nummer 19.3 der Anlage 1 zu diesem Gesetz die Planfeststellungsbedürftigkeit des Vorhabens begründet und die planfeststellungsrechtliche Abwägung eine solche Gesamtabwägung umfasst. Das Bundesverfassungsgericht hat keine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Gesetzgebers gesehen, diese Gesamtabwägung bereits selbst vorzunehmen.
Eine solche Gesamtabwägung könnte das Rohrleitungsgesetz im Übrigen auch nicht leisten. Denn sie setzt notwendig die Kenntnis des konkreten Vorhabens voraus, insbesondere des spezifischen Trassenverlaufs, der im Einzelnen betroffenen Grundstücke sowie des konkreten Ausmaßes der jeweiligen Betroffenheiten. Eine konkrete Gesamtabwägung kann deshalb lediglich in den von Verfassungs wegen nur ausnahmsweise zulässigen Fällen einer Legalplanung durch den Gesetzgeber selbst vorgenommen werden29. Eine derartige Legalplanung liegt dem allein den Anfangs- und Endpunkt der Trasse festlegenden Rohrleitungsgesetz nicht zugrunde.
Soweit der Vorlagebeschluss in Bezug auf die Sicherung des Enteignungszwecks durch Bindung des privaten Begünstigten ausführt, an das Vorhandensein, die Genauigkeit und den Detaillierungsgrad der zur Sicherung des Enteignungszwecks erforderlichen Vorgaben seien hohe Anforderungen zu stellen, die hier nicht erfüllt würden, löst sich das Oberverwaltungsgericht ebenfalls von der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ohne dass es dies entsprechend kennzeichnen und mit abweichenden Meinungen in Rechtsprechung oder Schrifttum belegen würde.
Das Oberverwaltungsgericht überzeichnet die von der Verfassung vorgegebenen Erfordernisse, wenn es den Gesetzgeber auf die Sicherung des Erfolges der in § 2 Nr. 1 bis 4 RohrlG im Einzelnen beschriebenen Zwecke der Rohrleitungsanlage verpflichten will. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht die Sicherung eines Erfolges, sondern die Sicherung des Enteignungszwecks erforderlich30, hier also die Sicherung der Förderung wirtschaftlicher Strukturen in den durch die Parameter der Errichtung und des Betriebs der Rohrleitung vorgegebenen Grenzen. Die gebotene dauerhafte Gemeinwohlsicherung verlangt gesetzliche Regelungen, die sicherstellen, dass begünstigte Private das enteignete Gut zur Verwirklichung des die Enteignung legitimierenden Zwecks verwenden und dass diese Nutzung dauerhaft erfolgt31. Inwieweit mit dieser Nutzung das mit der Enteignung verfolgte Gemeinwohlziel erreicht wird, ist keine Frage der Sicherung des Enteignungszwecks, sondern ist im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unter dem Aspekt der Eignung gerichtlicher Überprüfung zugänglich.
Die Verfassung verlangt ferner, anders als das Oberverwaltungsgericht meint, keine maximale und umfassende Sicherung des Enteignungszwecks. Die geforderten Regelungen müssen umso genauer und detaillierter sein, je weniger schon der Geschäftsgegenstand des privaten Unternehmens, zu dessen Gunsten die Enteignung erfolgt, darauf ausgerichtet ist, dem gemeinen Wohl zu dienen32. Dies kann aber auch lediglich eine Regulierung privatwirtschaftlichen Verhaltens oder die Begründung behördlicher Eingriffsbefugnisse erfordern33.
Dem Vorlagebeschluss ist nicht zu entnehmen, dass das Rohrleitungsgesetz, gemessen daran, zu beanstanden wäre. § 5 RohrlG begrenzt die Nutzung der Rohrleitungsanlage dauerhaft auf die Durchleitung von Kohlenmonoxid beziehungsweise Kohlenmonoxid-Wasserstoffgemischen. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 RohrlG setzt die Enteignung zudem voraus, dass das die Anlage errichtende und betreibende Unternehmen glaubhaft macht, das Grundstück oder das Recht daran werde innerhalb angemessener Frist zu dem vorgegebenen Zweck verwendet beziehungsweise ausgeübt werden. Damit hat der Gesetzgeber möglichen Fehlverwendungen der durch die Enteignung erlangten Positionen, die er in der Enteignung ohne Errichtung oder Inbetriebnahme der konkreten Rohrleitungsanlage beziehungsweise in der Einstellung der Nutzung der Rohrleitungsanlage erkannt hat, entgegengewirkt. Seiner Verpflichtung zur Sicherung des Enteignungszwecks hat er damit hinreichend Genüge getan. Dass die in § 2 RohrlG genannten „Enteignungszwecke“ nur mehr oder weniger wahrscheinliche, nicht aber zwingende Folgewirkungen der Errichtung und des Betriebs der Anlage sind, die theoretisch durch das die Rohrleitung betreibende Unternehmen konterkariert werden könnten, lässt – anders als das Oberverwaltungsgericht meint – keinen weitergehenden Sicherungsbedarf entstehen.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 21. Dezember 2016 – 1 BvL 10/14
- GV.NW. S. 130[↩]
- OVG NRW, Beschluss vom 28.08.2014 .20 A 1923/11[↩]
- vgl. BVerfGE 127, 335, 355 f.; stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 105, 61, 67; stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 78, 165, 171 f.; 86, 71, 77 f.; 88, 70, 74; 88, 198, 201; 93, 121, 132[↩]
- vgl. BVerfGE 76, 100, 104; 79, 240, 243 f.; 86, 52, 57; 86, 71, 77 f.; 88, 198, 202; 94, 315, 325[↩]
- vgl. BVerfGE 85, 329, 333 f.; 124, 251, 262[↩]
- vgl. BVerfGE 121, 108, 117 m.w.N.[↩]
- vgl. zuletzt BVerfGE 134, 242, 290 ff. Rn. 164 ff.[↩]
- vgl. BVerfGE 56, 249, 261; 74, 264, 285; 134, 242, 293 Rn. 174[↩]
- BVerfGE 134, 242, 293 Rn. 175[↩]
- vgl. BVerfGE 24, 367, 403; 56, 249, 261; 74, 264, 285[↩]
- BVerfGE 134, 242, 293 Rn. 176[↩]
- vgl. BVerfGE 74, 264, 285 f.[↩]
- BVerfGE 134, 242, 294 Rn. 177[↩]
- vgl. BVerfGE 66, 248, 257; 74, 264, 284[↩]
- vgl. BVerfGE 74, 264, 281 ff., 289; 134, 242, 294 f. Rn. 178[↩]
- vgl. BVerfGE 38, 175, 180; 74, 264, 286; 134, 242, 295 Rn. 179[↩]
- vgl. BVerfGE 74, 264, 285[↩][↩]
- BVerfGE 134, 242, 296 Rn. 181[↩]
- vgl. BVerfGE 134, 242, 292 Rn. 171 f.[↩]
- vgl. BVerfGE 134, 242, 293 Rn. 173[↩]
- vgl. BVerfGE 134, 242, 290 Rn. 166[↩]
- vgl. LT-Drs. 14/909 S. 5[↩]
- vgl. BVerfGE 134, 242, 305 Rn.204[↩]
- LT-Drs. 14/909[↩]
- BVerfGE 134, 242, 310 Rn. 217[↩]
- BVerfGE 134, 242, 307 f. Rn. 211 f.[↩]
- vgl. BVerfGE 95, 1, 17[↩]
- vgl. BVerfGE 74, 264, 286; 134, 242, 294 ff. Rn. 178 ff., 307 Rn.209[↩]
- vgl. BVerfGE 134, 242, 295 Rn. 179[↩]
- vgl. BVerfGE 74, 264, 285; 134, 242, 296 Rn. 181[↩]
- vgl. BVerfGE 134, 242, 296 Rn. 181[↩]