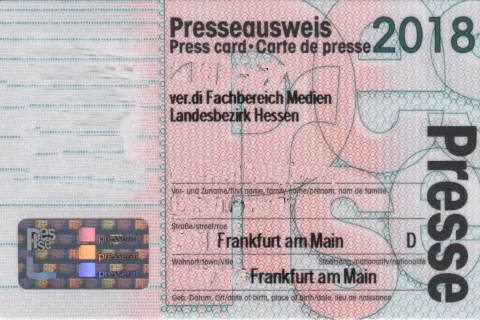Nach § 35 Abs. 6 Satz 1 GewO ist die Ausübung des Gewerbes wieder zu gestatten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Unzuverlässigkeit i.S.d. § 35 Abs. 1 GewO nicht mehr vorliegt.

Diese Entscheidung fordert wie die Gewerbeuntersagung eine Prognose über die Zuverlässigkeit des Antragstellers nach Wiederaufnahme der gewerblichen Tätigkeit. Sie muss prospektiv, das heißt bezogen auf eine mögliche Gefährdung des redlichen Geschäftsverkehrs in der Zukunft begründet werden, wobei allerdings in der Vergangenheit gezeigtes Verhalten als Indiz gewertet werden kann.
Zu beachten ist dabei, dass durch die Gewerbeuntersagung und ihre Aufrechterhaltung nicht vergangenes Verhalten „gleichsam bestraft“ werden soll1.
Aus der Gewährleistung des Berufsfreiheit in Art. 12 Abs. 1 GG ergibt sich, dass niemand länger von der Gewerbeausübung ferngehalten werden darf, als dies durch überwiegende Interessen der Allgemeinheit geboten ist2. Auf die Wiedergestattung besteht daher ein Rechtsanspruch, wenn etwa die den Untersagungsbescheid tragenden Gründe inzwischen entfallen oder Gefährdungen i.S.d. § 35 Abs. 1 GewO nicht mehr zu befürchten sind oder es inzwischen an der Verhältnismäßigkeit des Fortbestehens der Untersagung mangelt3.
Dabei sind maßgeblich die Verhältnisse im Zeitpunkt der letzten gerichtlichen Tatsachenentscheidung4. Die Beweislast für die Rechtmäßigkeit des Ablehnungsbescheides und die Aufrechterhaltung der Untersagungsverfügung liegt bei der Gewerbeaufsichtsbehörde5.
Bereits der Umstand, dass im hier entschiedenen Fall der Kläger die zuvor genannten erheblichen Rückstände beim Finanzamt hat entstehen und über viele Jahre hinweg weder tilgen noch nennenswert zurückführen können, zeigt, dass er die Gewähr für die Erfüllung von öffentlichen Zahlungspflichten nicht bieten kann, und belegt zudem, dass er wirtschaftlich leistungsunfähig und zahlungsunfähig ist. Dieser Befund wird zusätzlich bestätigt dadurch, dass er wiederholt die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. Der Kläger ist danach seit langem und auch aktuell nicht in der Lage, den Zustand seiner wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit zu überwinden. Ein Erfolg versprechendes Sanierungskonzept, auf dessen Grundlage er den jederzeitigen Zugriff seiner Gläubiger auf etwaige Einkommens- oder Vermögenszugriffe abwenden und welches die Annahme rechtfertigen könnte, dass er zukünftig die beabsichtigte Gebäudeenergieberatung als selbständiges Gewerbe ordnungsgemäß ausüben könnte, hat er nicht vorgelegt. Er müsste mit einer jederzeitigen Zwangsvollstreckung seitens seiner Gläubiger, insbesondere auch privater Gläubiger rechnen, sodass auch nicht zu erkennen ist, inwieweit er bei Aufnahme der beabsichtigten Gewerbetätigkeit in der Lage sein soll, etwaige Steuer- und Abgabenverpflichtungen durch monatliche Vorauszahlungen oder Barleistungen zu erfüllen.
Unter den gegebenen Umständen wäre selbst dann von der Unzuverlässigkeit des Klägers auszugehen, wenn das Finanzamt die Steuerschulden des Klägers inzwischen erlassen hätte. Denn dies könnte lediglich als eine Teilentschuldung des Klägers angesehen werden und nichts daran ändern, dass er weiterhin dem Zugriff anderer Gläubiger ausgesetzt wäre. Auch an dem Umstand seiner durch Abgabe eidesstattlicher Versicherungen zum Ausdruck gekommenen wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit und seines Unvermögens, ein tragfähiges Konzept für eine nachhaltige und umfassende Sanierung darzutun, änderte sich nichts. Eine Perspektive für eine ordnungsgemäße zukünftige Gewerbeausübung zeigt sich danach nicht.
Der Kläger kann sich nicht mit Erfolg auf den vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 27.01.20116 angesprochenen, aber nicht weiter vertieften Gesichtspunkt berufen, dass er lediglich eine Beratungstätigkeit in der Form eines Ein-Mann-Betriebs führen wolle, in dessen Rahmen er keine Waren ankaufen, sondern (lediglich) durch eigene Dienstleistung in Vorlage treten müsse. Der Gesichtspunkt führt zu keiner abweichenden – positiven – Prognose für die zukünftige Gewerbeausübung. Mit Blick auf die seit langem bestehende wirtschaftliche Leistungs- und Zahlungsunfähigkeit des Klägers bestehen durchgreifende Zweifel daran, dass er einen auch nur mit geringem organisatorischen Aufwand einzurichtenden und mit einfachen sachlichen Mitteln auszustattenden Gewerbebetrieb wird ordnungsgemäß führen können.
Die Versagung der Wiedergestattung der Gewerbeausübung ist auch nicht unverhältnismäßig. Zwar ist nicht zu verkennen, dass die gegenüber dem Kläger verfügte Gewerbeuntersagung des Landkreises Hannover mittlerweile über 24 Jahre zurück liegt und die Aufrechterhaltung dieser Maßnahme, die nicht als Sanktionierung früheren (Fehl)-Verhaltens missverstanden werden kann7, ihm die Chance nimmt, seine im Jahr 2008 abgeschlossene Weiterbildung als Gebäudeenergieberater im Rahmen einer selbständigen Gewerbeausübung zu Nutze zu machen. Der schlichte Zeitablauf rechtfertigt es indes nicht, nunmehr eine positive Prognose in Bezug auf die beabsichtigte Gewerbeausübung zu stellen. Der Kläger muss sich entgegenhalten lassen, dass er im maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts – wie dargelegt – ein auch nur in Ansätzen Erfolg versprechendes Sanierungskonzept, auf dessen Grundlage eine Konsolidierung seiner Vermögensverhältnisse und Überwindung seiner wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit realistisch erscheinen könnte, nicht vorweisen kann. Seine Erklärung, durch Ausübung der selbständigen Gewerbetätigkeit werde er in die Lage versetzt, etwaige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten zu verringern, ist ohne Substanz geblieben und unter den gegebenen Umständen als eine nicht realistische Erwartung anzusehen. Konkrete Anhaltspunkte, dass es ihm tatsächlich gelingen könnte, den seit langem bestehenden negativen Zustand seiner wirtschaftlichen Verhältnisse und seine Leistungsunfähigkeit zu überwinden, sind jedenfalls nicht zu erkennen.
Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 8. September 2014 – 7 LB 93/13
- vgl. Nds. OVG, Beschlüsse vom 27.01.2011, a.a.O.; und vom 06.01.2012, a.a.O.[↩]
- Kramer, GewArch 2010, 273[↩]
- vgl. Nds. OVG, Urteil vom 15.01.1998 – 7 L 781/97, juris; Beschluss vom 06.01.2012, a.a.O.; Hess. VGH, Urteil vom 28.05.1990 – 8 UE 878/89, GewArch 1990, 326; Marcks, in: Landmann/Rohmer, GewO, Stand: März 2014, § 35 Rn. 174[↩]
- vgl. BayVGH, Beschluss vom 02.05.2011 – 22 ZB 11.184 und Beschluss vom 25.06.2013 – 22 ZB 13.1102[↩]
- Nds. OVG, Beschluss vom 03.02.2011 – 7 PA 101/10, GewArch 2011, 208, und Beschluss vom 06.01.2012, a.a.O.; Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, GewO, 8. Auflage, § 35 Rn.203 m.w.N.[↩]
- Nds. OVG, Beschluss vom 27.01.2011, a.a.O.[↩]
- vgl. Nds. OVG, Beschluss vom 06.01.2012, a.a.O.[↩]