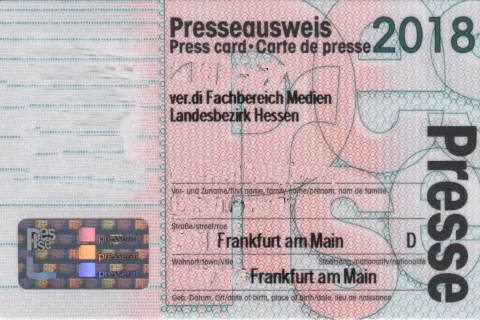Einer kommunalen Wählervereinigung ist die Verwendung des Wortes „grün“ in ihrem Namen nicht verwehrt, wenn durch weitere Namensbestandteile sicher gestellt ist, dass sich der Name von dem Namen der Klägerin, der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“, ausreichend abgrenzt und die kommunale Wählerschaft nicht von personellen oder organisatorischen Zusammenhängen oder einer Zustimmung der Klägerin zur Namensnutzung ausgehen kann.

Ein Unterlassungsanspruch ergibt sich weder aus § 4 PartG, noch aus § 12 BGB.
Kein Unterlassunganspruch aus dem Parteienrecht
Eine zwar nicht direkte, aber diskussionswürdige analoge Anwendung des § 4 Abs. 1 PartG würde einen Unterlassungsanspruch wegen hinreichend deutlicher Unterscheidbarkeit des Namens der Wählervereinigung nicht begründen.
Auf das Verhältnis der Parteien des vorliegenden Rechtsstreits untereinander findet § 4 Abs. 1 PartG schon nach dem Wortlaut keine Anwendung. § 4 PartG erweitert den nach § 12 BGB bestehenden namensrechtlichen Schutz vielmehr für eine Partei im Verhältnis zu anderen politischen Parteien1. Eine andere Auslegung widerspräche dem Gesetzestext und der Gesetzesbegründung.
Es erscheint zwar zweifelhaft, ob nicht hinsichtlich des Namensschutzes einer Partei gegenüber einer Wählervereinigung oder Gruppierung von Mandatsträgern entgegen der Begründung des Landgerichts2 eine Regelungslücke und ein Bedürfnis für eine analoge Anwendung des § 4 Abs. 1 PartG besteht.
Aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 28. September 20113 ergibt sich lediglich, dass für den umgekehrten Fall, das heißt, den Namensschutz einer Wählervereinigung, eine auch analoge Anwendung nicht in Betracht kommt und Wählervereinigungen daher lediglich den Namensschutz des § 12 BGB beanspruchen können. Nach Auffassung des Senats kann umgekehrt jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Auftritt einer Wählervereinigung auf kommunaler Ebene die Wahrnehmung einer gleichnamigen oder zumindest im Namen verwechselbaren Partei auf Landes- oder Bundesebene zu beeinflussen vermag. Es könnte daher ein in der seit dem Inkrafttreten am 24. Juli 1967 unveränderten Fassung des § 4 PartG nicht berücksichtigtes Interesse einer Partei am Schutz ihres Namens und daraus folgend das Bedürfnis für eine analoge Anwendung auch zur Abwehr nicht unterscheidungskräftiger Namen von Wählervereinigungen und anderen lokalen politischen Gruppierungen im kommunalen Bereich ihres Auftretens bestehen.
Würde man § 4 PartG im Verhältnis einer politischen Partei zu einer kommunalen Wählervereinigung entsprechend anwenden, wäre allerdings zu berücksichtigen, dass eine kommunale Wählervereinigung anders als eine Partei nur einen begrenzten örtlichen Wirkungskreis hat. Eine Beeinflussung der Wahrnehmung einer Partei auf Bundes- oder Landesebene durch eine kommunale Wählervereinigung und damit das Interesse an einer entsprechenden Anwendung von § 4 PartG scheidet deshalb aus, wenn sich bezogen auf den örtlich begrenzten Tätigkeitsbereich der Wählervereinigung eine deutliche Unterscheidung ihres Namens zu dem der Partei ergibt.
Die beklagte Wählervereinigung hat einen Namen gewählt, welcher sich in ihrem Wirkungskreis deutlich vom Namen – auch der Kurzbezeichnung – der Klägerin – Bündnis 90/Die Grünen – unterscheidet, weshalb auch die analoge Anwendung von § 4 Abs. 1 PartG einen Unterlassungsanspruch der Klägerin nicht rechtfertigen würde und die – soweit ersichtlich bislang nicht höchstrichterlich entschiedene – Frage der analogen Anwendung auf den Abwehranspruch einer Partei gegenüber einer Wählervereinigung keiner Entscheidung bedarf.
Die Wählervereinigung hat sich mit ihrer Namensgebung ausreichend abgegrenzt. Der Name „Grüne Alternative Freiburg“ deutet nach allgemeinem Wortverständnis nicht auf eine Zugehörigkeit oder organisatorische Verbundenheit zur Klägerin, sondern – so überzeugend auch das Landgericht – gerade auf einen Gegenentwurf, eine „Alternative“ zur Klägerin im Freiburger Raum hin.
Die Bedeutung des Begriffes „Grüne“ oder „grün“ kann insoweit nicht auf einen implizierten Verweis auf die „Grünen“ als institutionalisierte Partei verengt werden, was letztlich auf eine Monopolisierung dieses Begriffes hinsichtlich seiner politischen Bedeutung hinausliefe. Die Vertretung von „grünen“ politischen Interessen im Sinn von Umwelt- und Nachhaltigkeitsanliegen ist jedoch keineswegs auf die Klägerin beschränkt; sie repräsentiert auch nicht das gesamte Spektrum der Umweltbewegung, aus welcher sie selbst hervorgegangen ist.
Für ein von der Programmatik der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ abweichendes Verständnis „grüner“ Politik steht erkennbar und unmissverständlich der Name „Grüne Alternative“ mit dem lokal beschreibenden Zusatz „Freiburg“, weshalb die Beklagte sich in ihrem örtlichen Wirkungskreis Freiburg im Sinn des § 4 Abs. 1 PartG von der Klägerin deutlich unterscheidet.
Folglich liegt auch keine der Namensfortführung mit Zusatz gem. § 4 Abs. 3 PartG vergleichbare Bezeichnung vor, die Einfügung des Substantivs „Alternative“ verweist vielmehr – wie dargelegt – auf die von der Klägerin abweichende politische Ausrichtung der Beklagten.
Kein Unterlassunganspruch aus dem Namensrecht
Auch einen Unterlassungsanspruch der Partei „Bündnis 90 / Die Grünen“ aus § 12 BGB verneint das Oberlandesgericht Karlsruhe:
Grundsätzlich erstreckt der Namensschutz des § 12 BGB sich nur auf Begriffe, welche entweder unterscheidungskräftig sind, das heißt, nicht nur beschreibende Bedeutung haben oder im Fall fehlender Unterscheidungskraft Verkehrsbedeutung erlangt haben4.
Hinsichtlich der Unterscheidungskraft ist auf die Verwendung im politischen Raum abzustellen, weshalb die allgemein beschreibende Verwendung des Wortes „grün“ als Farbe nicht entgegensteht5. Im Hinblick auf die dargelegte Verwendung des Begriffes „Grün“ im politischen Raum für Umweltanliegen und dafür engagierte Interessensvertreter auch außerhalb der Klägerpartei erscheint jedoch insoweit eine auch im politischen Raum beschreibende und nicht auf die Klägerin beschränkte Bedeutung üblich und verbreitet, welche der Qualifizierung dieses Namensbestandteiles der Klägerin als unterscheidungskräftig entgegenstehen könnte6.
Zweifelhaft erscheint jedoch, ob nicht angesichts der dominierenden Rolle der Klägerin bei der Vertretung von „Grünen“, d. h., umweltpolitischen Interessen im politischen Spektrum entgegen der Auffassungen der Vorinstanz und des Landgerichts Bielefeld von entsprechender Verkehrsbedeutung des Begriffes auszugehen ist7. An die Feststellung einer entsprechenden Verkehrsgeltung sind zwar aufgrund des Freihaltebedürfnisses des Verkehrs bei sprachüblichen Wortkombinationen erhöhte Anforderungen zu stellen8; ein Freihaltebedürfnis stellt jedoch kein absolutes Hindernis für den Namensschutz dar. Dabei kann von Verkehrsgeltung ab einem Bekanntheitsgrad von mindestens 50 % ausgegangen werden9, welcher für die Klägerin indessen mit Sicherheit weit höher liegt. Dies gilt insbesondere im Raum Freiburg mit einem der Klägerin angehörenden Oberbürgermeister, dessen Bezeichnung als „Grüner OB“ unzweifelhaft mit seiner Parteizugehörigkeit in Verbindung gebracht wird.
Entsprechend dem Tatbestandsmerkmal der Unterscheidbarkeit gemäß § 4 Abs. 1 PartG ist jedoch auch die Gefahr einer Zuordnungsverwirrung als Voraussetzung einer Interessensverletzung i.S.d. § 12 BGB zu verneinen. Eine Verletzung des Namensrechtes liegt nur vor, wenn der Namensgebrauch durch Dritte mit dem – auch nur abstrakten – Risiko einer Zuordnungsverwirrung einhergeht, d. h., wenn die Namensverwendung geeignet ist, in den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf den Namensrechtsinhaber verstanden zu werden10.
Wie ausgeführt, führt indessen die Verwendung des Begriffes „Grüne“ oder „grün“ im Kontext „Grüne Alternative Freiburg“ nicht zu einer Übereinstimmung in Klang, Schriftbild oder Sinngehalt11, aufgrund derer zu befürchten wäre, dass die beteiligten Verkehrskreise, d. h. die Wählerschaft in Freiburg, personelle oder organisatorische Zusammenhänge oder eine Zustimmung der Klägerin zur Namensnutzung vermuten.
Oberlandesgericht Karlsruhe – Urteil vom 18. Dezember 2013 – 13 U 162/12
- BGH NJW 1981, 914; Morlock, Beck online Kommentar PartG 2. Aufl. § 4 Rnr. 1; Schmitt-Gaedtke/Arz: Der Namenschutz politischer Parteien, NJW 2013, 2729 ff. m.w.N.[↩]
- im Anschluss an LG Bielefeld, NJW-RR 2004, 400[↩]
- BGH MDR 2012, 727[↩]
- MünchKomm-BGB/Bayreuther, BGB Band 1, 5. Aufl. § 12 Rnr. 45; Ehrmann/Koos, BGB Band 1, 2. Aufl. § 12 Rnr. 85 ff.[↩]
- BGH GRUR 2008, 1108; GRUR 2010, 1020 für an einen Tätigkeitsbereich angelehnten Sachbegriff im Verbandsnamen[↩]
- a. A. LG Stuttgart 7 O 393/89, K 6[↩]
- so MünchKomm-BGB/Bayreuther, a.a.O., LG Stuttgart a.a.O.[↩]
- Ehrmann/Koos a.a.O. Rnr. 90, 96; BGH NJW 2006, 3282[↩]
- Schmitt-Gaedtke/Arz a.a.O.; BGH NJW 2006 a.a.O. zur vergleichbaren Problematik im Markenrecht[↩]
- BGH NJW 2003, 2978; MünchKomm-BGB/Bayreuther a.a.O., Rnr. 152[↩]
- Staudinger/Habermann BGB 2013, § 12 Rnr. 311[↩]