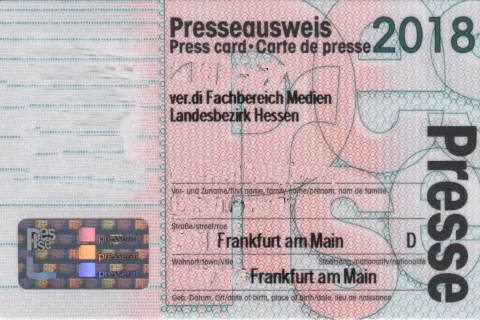Der Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften (Art. 28 Abs. 2 GG) verpflichtet den Landkreis, bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und ihn gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen. Dazu müssen die ermittelten Bedarfsansätze der Gemeinden dem für die Entscheidung über die Kreisumlage zuständigen Organ bei der Beschlussfassung vorliegen.

Der Landkreis ist bei ihrem Erlass seiner aus Art. 28 Abs. 2 GG folgenden verfahrensrechtlichen Pflicht zur Ermittlung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nicht hinreichend nachgekommen, wenn dem Kreistag nach den für das Bundesverwaltungsgericht bindenden Tatsachenfeststellungen des Berufungsgerichts (§ 137 Abs. 2 VwGO) keine Informationen über den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden vorlagen.
In Übereinstimmung mit revisiblem Recht nimmt das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt an, das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde gemäß Art. 28 Abs. 2 GG werde nicht nur verletzt, wenn die Erhebung einer Kreisumlage dazu führt, dass ihre finanzielle Mindestausstattung unterschritten wird1, sondern auch dann, wenn der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt und damit den Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfs der kommunalen Gebietskörperschaften verletzt2. Die Wahrung dieses Grundsatzes verpflichtet den Landkreis bei der Erhebung einer Kreisumlage, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form – etwa im Wege einer Begründung der Ansätze seiner Haushaltssatzung – offenzulegen, um den Gemeinden und gegebenenfalls den Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen3. In welcher Art und Weise die Landkreise den Finanzbedarf ihrer Gemeinden zu ermitteln und offenzulegen haben, ist Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG allerdings nicht zu entnehmen, weil die Institutsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung der gesetzlichen Ausgestaltung und Formung bedarf4. Es obliegt daher dem jeweiligen Landesgesetzgeber, das Verfahren der Erhebung von Kreisumlagen zu regeln. Soweit derartige Regelungen fehlen, haben die Landkreise die Befugnis zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise. Sie tragen damit die Verantwortung dafür, hierbei ein Verfahren zu beobachten, welches sicherstellt, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen gewahrt werden5. Art. 28 Abs. 2 GG gestattet insbesondere keinen vollständigen Verzicht auf eine inhaltliche Würdigung der finanziellen Belange der Gemeinden6.
Mit diesen Vorgaben steht das Berufungsurteil in Einklang. Seine Annahme, die maßgeblichen Daten über den Finanzbedarf der Gemeinden müssten dem Kreistag als dem landesrechtlich für die Festsetzung der Kreisumlage zuständigen Organ in geeigneter Weise zur Verfügung stehen, weil dabei andernfalls die Beachtung und Überprüfung des gemeindlichen Bedarfs nicht möglich sei, konkretisiert die aus Art. 28 Abs. 2 GG abzuleitende Ermittlungspflicht des Landkreises in bundesrechtlich nicht zu beanstandender Weise.
Durch welches Organ und auf welche Weise die für die Bewertung des Finanzbedarfs der Gemeinden erforderlichen Informationen innerhalb des Landkreises zusammengestellt werden, bestimmt sich nach landesrechtlichen Regelungen und unterliegt, sofern solche Regelungen fehlen, der Befugnis des Landkreises, das Verfahren im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen auszugestalten. Das Berufungsgericht ist ohne Verstoß gegen Bundesrecht davon ausgegangen, dass die Kreisverwaltung den gemeindlichen Finanzbedarf ermitteln und dazu auf vorhandene Daten zurückgreifen darf. Eine verfassungsrechtliche Pflicht, die Gemeinden anzuhören, besteht dabei nicht7. Die von ihr ermittelten Informationen über den gemeindlichen Finanzbedarf müssen dem Kreistag als dem für den Erlass der Haushaltssatzung zuständigen Organ (§ 45 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA) bei der Beschlussfassung über den Kreisumlagesatz vorliegen, damit er der Pflicht des Kreises nachkommen kann, diesen Finanzbedarf gemäß Art. 28 Abs. 2 GG gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen. Dazu muss dem Kreistag zumindest ein bezifferter Bedarfsansatz für jede kreisangehörige Gemeinde vorliegen. Wegen der ebenfalls aus Art. 28 Abs. 2 GG abzuleitenden Pflicht, die Entscheidung über die Umlagefestsetzung als Ergebnis der Gewichtung der finanziellen Belange offenzulegen, müssen die der Beschlussfassung zugrunde gelegten Bedarfsansätze in der Beschlussvorlage oder, falls die Festsetzung davon abweicht, in anderer geeigneter Weise dokumentiert werden. Dies dient neben der gerichtlichen Kontrolle insbesondere auch der Überprüfung durch die betroffenen Gemeinden, ob der Kreis bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes durch den Kreistag die verfassungsrechtliche Vorgabe beachtet hat, seinen Finanzbedarf nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber demjenigen der Gemeinden zu bevorzugen.
Ebenfalls zutreffend geht das Berufungsurteil davon aus, dass die Beachtung der aus Art. 28 Abs. 2 GG folgenden Ermittlungs- und Offenlegungspflicht des Kreises eine verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeitsvoraussetzung der Festsetzung des Kreisumlagesatzes darstellt, deren Verletzung von Verfassungs wegen zur Unwirksamkeit der Satzungsnorm führt. Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze in bundesrechtlich nicht zu beanstandender Weise angewandt. Nach seinen tatsächlichen Feststellungen lagen dem Kreistag bei seiner ursprünglichen Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 am 23.11.2016 keine Informationen über den gemeindlichen Finanzbedarf vor.
Das angegriffene Berufungsurteil hat eine Heilung der unwirksamen ursprünglichen Satzungsnorm durch den sie bestätigenden Beschluss des Kreistages vom 26.02.2020 in Auslegung irrevisiblen Landesrechts, an die das Revisionsgericht gebunden ist (§ 173 VwGO i.V.m. § 560 ZPO), verneint. Seine Erwägung, § 103 Abs. 1 KVG LSA habe in dem maßgeblichen Zeitpunkt des Kreistagsbeschlusses einer erneuten Sachentscheidung über die Haushaltssatzung nach Ablauf des Haushaltsjahres entgegengestanden, verstößt nicht gegen Bundesrecht. Art. 28 Abs. 2 GG gebietet nicht, nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres die Heilung eines unwirksamen Beschlusses über den Kreisumlagesatz zu ermöglichen. Vielmehr ist es Sache des Landesgesetzgebers, die dafür und dagegen sprechenden Gesichtspunkte zu würdigen und die zeitlichen Grenzen des Erlasses und der Änderung einer Haushaltssatzung festzulegen. Dass er die Finanzierung der Kreise gerade durch eine Ermächtigung zur zeitlich unbegrenzt rückwirkenden Erhebung der Kreisumlage sicherzustellen hätte, lässt sich der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht entnehmen. Die weitere Erwägung des Oberverwaltungsgerichts, eine Heilung scheide aus, wenn eine offene Entscheidung des Kreistages über die Höhe des Kreisumlagesatzes aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich sei und nur noch eine Bestätigung des ursprünglich festgesetzten Umlagesatzes in Betracht komme, steht ebenfalls in Einklang mit Bundesrecht. Der Grundsatz des Gleichranges des Finanzbedarfs der kommunalen Gebietskörperschaften aus Art. 28 Abs. 2 GG verpflichtet den Kreistag zu einer ergebnisoffenen Berücksichtigung und Gewichtung der finanziellen Belange der kreisangehörigen Gemeinden gegenüber denjenigen des Kreises; davon kann keine Rede sein, wenn dieser landesrechtlich darauf beschränkt ist, seinen zuvor gefassten Beschluss ohne die Möglichkeit einer inhaltlichen Änderung zu bestätigen.
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 27. September 2021 – 8 C 30.20
- OVG LSA, Urteil vom 17.03.2020 – OVG 4 L 14/19; vgl. BVerwG, Urteil vom 30.01.2013 – 8 C 1.12, BVerwGE 145, 378 Rn. 18 ff.[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 30.01.2013 – 8 C 1.12, BVerwGE 145, 378 Rn. 13 ff.[↩]
- BVerwG, Urteile vom 30.01.2013 – 8 C 1.12 – a.a.O. Rn. 14; vom 16.06.2015 – 10 C 13.14, BVerwGE 152, 188 Rn. 41; und vom 29.05.2019 – 10 C 6.18, Buchholz 415.1 AllgKommR Nr.198 Rn. 13[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 30.01.2013 – 8 C 1.12 – a.a.O. Rn. 13[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 29.05.2019 – 10 C 6.18 – a.a.O. Rn. 14[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 16.09.2020 – 8 B 22.20 – ZKF 2021, 89 <91>[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 29.05.2019 – 10 C 6.18, Buchholz 415.1 AllgKommR Nr.198 Rn. 14 ff.[↩]
Bildnachweis:
- Justizzentrum Magdeburg: Goodway | CC BY-SA 3.0 Unported