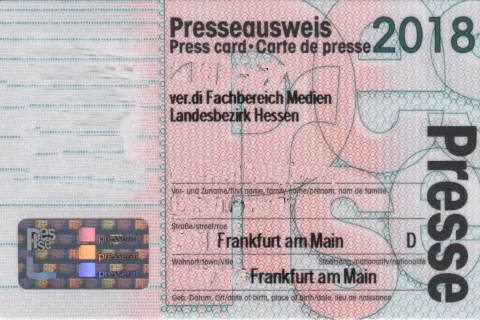Bestimmungen einer Abfallsatzung, die vorsehen, dass die Überlassungspflichtigen die Abfallbehältnisse unter bestimmten Voraussetzungen an einen grundstücksfernen Aufstellort verbringen müssen, sind rechtlich grundsätzlich unbedenklich. Dabei ist eine generalisierende Bestimmung der dem Überlassungspflichtigen noch zumutbaren Mitwirkung nicht möglich. Entscheidend ist vielmehr stets die konkrete örtliche Situation unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit1.

Rechtliche Hindernisse folgen dabei nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.03.20112 insbesondere aus straßenverkehrsrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen wie etwa § 9 Abs. 5 StVO und § 16 Nr. 1 der BGV C27, einer berufsgenossenschaftlichen Vorschrift zur (Arbeits-)Unfallverhütung, die nach der „Transferliste DGUV Regelwerk“ des Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) seit diesem Jahr die Bezeichnung „DGUV Vorschrift 43“ trägt.
Zur letztgenannten Vorschrift (heutige Bezeichnung: § 16 Nr. 1 DGUV Vorschrift 43), die insoweit eine vorrangige Spezialvorschrift zur „allgemeinen“ Regelung des Rückwärtsfahrens von Müllfahrzeugen nach § 7 DGUV Vorschrift 43 (vormals: BGV C27) darstellt, erläutert der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil vom 11.10.20103 Folgendes:
Schwierigkeiten bei der Anfahrt des Grundstücks können nicht nur in tatsächlicher, sondern auch in rechtlicher Hinsicht bestehen4. Auf diesen Gesichtspunkt gründet in nicht zu beanstandender Weise der Beklagte seine Verfügung vom 24.09.2009, indem er dabei auf das in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften – Müllbeseitigung (BGV C27) grundsätzlich angesprochene Rückwärtsfahrverbot für Entsorgungsfahrzeuge bei Abholung der Abfälle hinweist. Nach § 16 Nr. 1 BGV C27 darf Müll nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu den Müllbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist, wobei ein kurzes Zurückstoßen für den Ladevorgang als solchen von dem Verbot ausgenommen ist. Es mögen durchaus Zweifel angebracht sein, ob diese Vorschrift in der praktischen Handhabung besonders zweckmäßig ist. Hierüber hat der Senat nicht zu befinden. Sie erweist sich aber keinesfalls als so abwegig und zur Regelung des § 7 BGV C27 widersprüchlich, so dass ihre Wirksamkeit in Frage zu stellen wäre.
Die BGV C27 sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VII erlassen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und schreiben zu diesem Zweck den versicherten Beschäftigten bestimmte Verhaltenweisen vor. Dass das Rückwärtsfahren von Müllfahrzeugen im Zusammenhang mit der Müllabholung sachtypisch gesteigerte Gefahren für die Müllwerker mit sich bringt, ist offenkundig. Denn diese bewegen sich regelmäßig zum Heranschaffen, Entleeren und wieder Zurückstellen der Abfallbehälter zu bzw. von dem Entsorgungsfahrzeug in einem vom Fahrzeugführer teilweise nur schwer und weitgehend gar nicht einsehbaren Feld. Verfehlt mag es daher nicht erscheinen, ein generelles Rückwärtsfahrverbot mit Ausnahmen nur dann festzulegen, wenn der Ablauf des Ladevorgangs, also die Bewegung der Abfallbehälter unmittelbar zur Entleerung oder das entsprechende Absetzen danach eine kurze Rückwärtsbewegung erforderlich macht. Der Senat vermag keinen Widerspruch des speziell unter Abschnitt II der BGV C 27 den Abholvorgang als solchen regelnden § 16 Nr. 1 BGV C 27 zu der Vorschrift des § 7 Abs. 1 BGV C27 zu erkennen, wie das in einem obiter dictum des BayVGH a.a.O. – allerdings lediglich für die dort von einem Verfahrensbeteiligten vertretene Auslegung – anklingt. Denn der systematisch unter Abschnitt „I Allgemeines“ angesiedelte § 7 BGV C 27 ist darüber hinaus für ein weiteres Feld einschlägig als nur für die Fahrabläufe im nicht öffentlichen Verkehrsbereich im Umfeld von Deponien und Müllbehandlungsanlagen. Er betrifft jedenfalls auch den gesamten Vorgang der Müllsammelfahrt im Sinne des § 2 Nr. 4 BGV C27, während der nach § 13 BGV C27 Müllwerker auf den Standplätzen im hinteren Bereich der Entsorgungsfahrzeuge stehen können. Hierbei mag es durchaus vorkommen, dass das Fahrzeug ohne unmittelbaren Bezug zu einem Abholvorgang z. B. bei Wendemanövern oder auch bei schwierigen Verkehrssituationen rückwärts fahren muss. Ausnahmen vom Rückwärtsfahrverbot i.S.d. § 7 BGV C27 mit entsprechenden Verhaltensvorschriften für den Müllwerker sind daher nicht nur auf wenige theoretisch denkbare Lebenssachverhalte begrenzt.
Nicht weiterführend ist der Hinweis des Verwaltungsgerichts, dass die BGV C27 keine direkte Wirkung gegenüber den Klägern entfalten. Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob sie von jenen, an die die Unfallverhütungsvorschriften gerichtet sind, also von den Müllwerkern, beachtet werden müssen, was wiederum der Abfuhrunternehmer als Vertragspartner des Beklagten im Sinne eines rechtmäßig handelnden und damit zuverlässigen Unternehmers durchzusetzen hat. Es ist weder ihm noch seinen Bediensteten zuzumuten, die BGV C27 vorsätzlich außer Acht zu lassen und dabei das Risiko von ‚Straf- oder Zivilverfahren’ mit nicht abschätzbaren Folgen auf sich zu nehmen oder nachhaltig Ordnungswidrigkeiten zu begehen, die jeweils mit einem Bußgeld bis zu 10.000, – Euro belegt werden können (vgl. § 31 BGV C27 i.V.m. § 209 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 SGB VII)
Danach ist eine entsprechende Vorschrift der Hausmüllentsorgungssatzung tatbestandlich erfüllt, wenn das berufsgenossenschaftliche Verbot des Rückwärtsfahrens von Müllfahrzeugen bei der Abholung von Müll in Straßenbereichen ohne ausreichend große Wendemöglichkeit zu Recht besteht. Vorliegend wäre dann die Entleerung der Abfallbehälter nach weit über ein Jahrzehnt langer anderer Praxis nicht (mehr) ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich, Letzteres vor allem dann, wenn die Müllwerker stattdessen die Abfallbehälter aus den betroffenen öffentlichen Stichstraßen selbst zum nächstmöglichen Haltepunkt des Müllfahrzeugs bringen und nach der Entleerung wieder zurück auf ihren Platz stellen müssten. Auch das Legalbeispiel in Satz 2 dieser Norm wäre dann erfüllt, da die Zu- oder Abfahrt zu dem angeschlossenen Grundstück aufgrund des äußeren Zustandes der Zufahrtsstraße – kein hinreichend großer Wendehammer am Ende der Stichstraße, um vorwärts wieder herauszufahren – für die Müllfahrzeuge in unzumutbarer Weise erschwert ist und dieser Teil der öffentlichen Straße aus den genannten Gründen von ihnen nicht befahren werden kann. Insoweit ist zwischen den Beteiligten nicht streitig, dass der Platz am Ende der Stichstraße (höchstens ca. 12 m) im Hinblick auf den erforderlichen Wendekreis der Müllfahrzeuge von ca. 22 m zum Wenden ohne Rückwärtsfahrt nicht ausreicht.
Diese Gemengelage aus tatsächlich unzureichendem Platz zum gefahrlosen Wenden des Müllfahrzeugs am Ende der Stichstraße, um dann wie zuvor vorwärts diese Straße zu befahren, und dem rechtlichen Hindernis des berufsgenossenschaftlichen Verbots, bei der Müllabholung wegen der damit für die Müllwerker verbundenen Gefahren rückwärts zu fahren, könnte daher von der Landeshauptstadt und den von ihr beauftragten Abfallentsorgungsunternehmen zu beachten sein und zur hier streitigen Regelung führen.
Soweit ersichtlich, ist allerdings bislang in der Rechtsprechung noch nicht die Frage thematisiert worden, ob es rechtlich zulässig ist, die Vorschrift des § 16 Nr. 1 DGUV Vorschrift 43 (vormals BVG C27 vom 01.10.1979) in der Fassung vom 01.01.1997 auf die Müllabholung in vor dem 1.01.1991 gebauten öffentlichen Straßen nicht anzuwenden, sodass auf diesen „Altstraßen“ das Rückwärtsfahren im Rahmen der Müllabholung berufsgenossenschaftlich weiterhin erlaubt ist (vgl. § 32 DGUV Vorschrift 43).
In den neuen Bundesländern gelten die berufsgenossenschaftlichen Regeln zur Verhütung von Arbeitsunfällen entsprechend der Vorschrift in der Anlage I zum Einigungsvertrag Kapitel VIII Abschnitt III Nr. 1 lit. a zum Inkrafttreten der damals noch geltenden Rechtsnorm des § 537 der Reichsversicherungsordnung über die Aufgaben der Unfallversicherung, hier gemäß der Nr. 1 Arbeitsunfälle zu verhüten, welche auch das dafür gesetzte autonome Recht der jeweiligen Berufsgenossenschaften betraf, erst ab dem 1.01.1991. (Das Blatt „Entsorgung E5“ der BG Verkehr, das im „Info-Kästchen“ insoweit das Datum 01.01.1990 nennt, ist insoweit ebenso falsch wie die Übernahme dieser Fehlinformation im fraglichen Bescheid.)
„Einrichtungen“ i. S. des § 32 DGUV Vorschrift 43, die nach Inkrafttreten dieser Vorschrift errichtet werden, sind bei sinnhafter Auslegung dabei im Hinblick auf die ausdrücklich genannte Norm des § 16 Nr. 1 BVG C27 die nach dem jeweiligen Inkrafttretensdatum in der alten Bundesrepublik bzw. in den neuen Bundesländern errichteten öffentlichen Straßen.
Warum eine solche dauerhafte Perpetuierung bzw. Unterscheidung in zuvor bereits bestehende und danach errichtete öffentliche Straßen unter der Überschrift „Übergangsvorschrift“ erlassen worden ist, ist – anders als etwa bei der Regelung zur Beschaffenheit von (neu zu erwerbenden) Müllfahrzeugen, die inzwischen längst die zunächst weiter zulässigen Altmüllfahrzeuge ersetzt haben dürften – wenig nachvollziehbar, macht die Vorschrift aber noch nicht im Rechtssinne bedenklich.
Ob diese Vorschrift des autonomen Rechts auch den Anforderungen an Art. 3 Abs. 1 GG stand hält, wenn sie unter derselben Prämisse abstrakter Gefährlichkeit für die versicherten Müllwerker – Dritte werden allenfalls rechtsreflexartig geschützt – beim Rückwärtsfahren während der Müllabholung dennoch die Bestandsstraßen dauerhaft nicht erfasst, also dort offenbar weiterhin auch in unbegrenzter Zukunft keine berufsgenossenschaftlichen Bedenken gegen das Rückwärtsfahren im Rahmen der genannten Tätigkeit bestehen, ist zu hinterfragen: Ist das erforderliche Rückwärtsfahren des Müllfahrzeugs bei der Müllabholung in „alten“ öffentlichen Sackgassen bzw. Stichstraßen ohne ausreichende Wendemöglichkeit nicht ebenso unfallträchtig für die versicherten Müllwerker wie in den „neuen“ entsprechend gebauten Straßen? Worin soll der sachlich einleuchtende Grund für diese – dauerhafte und nicht nur „übergangsweise“ – Differenzierung liegen?
Der allgemeine Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG bindet und verpflichtet immerhin (ausnahmslos) alle Zweige der Staatsgewalt5. Er ist also auch von den gewerblichen Berufsgenossenschaften als Sozialversicherungsträger hier der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 SGB IV i. V. m. § 114 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII und – betreffend die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft – Nr. 8 der Anlage 1 dazu zu beachten, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltungsrecht nach § 29 Abs. 1 SGB IV verfasst sind. Mit anderen Worten sind auch die von dieser gewerblichen Berufsgenossenschaft als autonomes Recht erlassenen Unfallverhütungsvorschriften nach § 15 Abs. 1 SGB VII am Maßstab des Grundgesetzes und dabei vor allem am allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zu messen.
Diesen Bedenken kann nach Auffassung des Verwaltungsgerichts aber nicht im vorliegenden Rahmen der summarischen Prüfung in einem Eilverfahren abschließend nachgegangen werden; überdies käme wohl eine Beiladung der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft in Betracht.
Ebenso wenig kann aus diesem Grund der Frage näher nachgegangen werden, ob diese berufsgenossenschaftliche Vorschrift auch unter Beachtung des heutigen Stands der Technik, die im Bereich der Fahrraumüberwachung auch beim Rückwärtsfahren sowohl gegenüber dem Stand Anfang des Jahres 1991 als auch erst recht gegenüber demjenigen aus dem Jahre 1979 enorme Fortschritte gemacht hat, immer noch als solche aufrechterhalten werden kann bzw. muss, unabhängig oder auch gerade vor dem Hintergrund der offenbar seit Jahrzehnten unveränderten Regelung mit der genannten Differenzierung bei der Frage des „erlaubten“ Rückwärtsfahrens von Müllfahrzeugen je nach „Datum“ der öffentlichen Straßen.
Ein vom Träger der örtlichen Planungshoheit gewissermaßen defizitär geschaffener Erschließungszustand (im Sinne eines Fehlens des Heranfahrenkönnens an die Grundstücksgrenze mit Müllfahrzeugen, ohne dass diese rückwärts fahren müssen, ) muss dabei nicht stets zu Lasten des betroffenen Abfallbesitzers gehen mit der Folge, dass er seine Abfallbehälter stets an einen Sammelplatz zu verbringen hätte. Dazu hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Urteil vom 11.03.20056 Folgendes ausgeführt:
Kommt es zu deutlichen Erschließungs-/Entsorgungsmissständen – etwa infolge der Errichtung einer großen Wohnanlage am Ende einer schmalen Erschließungsanlage ohne Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge oder bei einer noch deutlich längeren Sackstraße ohne Wendemöglichkeit, muss der Entsorgungsträger durch eigene organisatorische Maßnahmen die ihm obliegende Abfallentsorgung in einem geordneten Rahmen sicherstellen (im soeben gebildeten Falle einer großen Wohnanlage müssten sonst gegebenenfalls eine Vielzahl von Bewohnern die einzelnen Müllbehältnisse oder große Sammelcontainer an den Beginn der Straße verbringen). Das heißt bei einem völlig unzureichenden Ausbau einer Erschließungsanlage durch die Gemeinde kann allein die Menge der an einen Sammelplatz zu verbringenden Abfälle, aber auch die Vielzahl betroffener Abfallbesitzer es unumgänglich machen, dass der Entsorgungsträger selbst tätig wird und von einer Mitwirkung der Abfallbesitzer bei der Verbringung der Abfälle absieht. Bei derartigen Erschließungsmissständen ist es Sache des Entsorgungsträgers, gegebenenfalls auf die Rechtsaufsichtsbehörde einzuwirken, damit der ausreichende Ausbau von Erschließungsanlagen (im Sinne deren Geeignetheit für das Befahren mit Müllfahrzeugen) sichergestellt wird. Unterlässt der Entsorgungsträger dies, hat er bei Entsorgungsmissständen durch eigene organisatorische Maßnahmen die Entsorgung der Grundstücke zu gewährleisten.
Erweist sich dagegen die konkrete Erschließungs- und Entsorgungssituation als städtebaulich noch vertretbar und damit als planbar (i.S.v. § 1 Abs. 6 und 7 BauGB), hat der Abfallbesitzer eine weitgehende Mitwirkungspflicht in Bezug auf das Verbringen der Abfälle zu einem Sammelplatz.
Ob die satzungsrechtliche Regelung dabei das Auswahlermessen, das „Wie“ des behördlichen Handelns, von vornherein mit Blick auf den Gestaltungsspielraum des Ortsgesetzgebers verengen darf auf die Frage eines anderen Abholorts zu Lasten der betroffenen Anlieger, bedarf auch einer näheren Untersuchung in einem Hauptsacheverfahren. Mit anderen Worten kann bei summarischer Prüfung nicht abschließend festgestellt werden, ob nicht auch stattdessen zu erwägen wäre, ob die Abholung der Abfallbehälter vor den jeweiligen Grundstücken, der Transport zur Bereitstellungsfläche und der Rücktransport zu den Grundstücken nicht auch durch eigenes Personal und Sachmittel des beauftragten Entsorgungsunternehmens, das sich überwiegend in städtischer Hand befindet, (wenngleich zeitlich und finanziell aufwändiger) in diesen fraglichen Stichstraßen möglich und zumutbar wäre. Dies gilt auch für die Frage, ob die bisherige Abholungspraxis durch Anschaffung von Müllfahrzeugen mit Front- oder Seitenladertechnik, die – wie etwa im Landkreis Ludwigslust-Parchim – im Ein-Mann-Betrieb (nur Fahrer ohne weitere Müllwerker) eingesetzt werden können, oder die Anschaffung kleinerer Müllfahrzeuge mit deutlich geringerem Wendekreis, die ein Rückwärtsfahren bei der Abfallentsorgung nicht erfordern, hätte beibehalten werden können. Zu der letztgenannten Erwägung hat die Antragsgegnerin im Rahmen des vorliegenden Eilverfahrens indessen vorgetragen, die Anschaffung kleiner Müllfahrzeuge sei in Erwägung gezogen worden, scheide aber wegen der damit verbundenen erheblichen Mehrkosten (Personal- und Sachkosten) aus7. Das Gericht verkennt nicht, dass bei der erstgenannten Variante ebenso Mehrkosten auf Seiten der Verwaltung entstehen, bei denen dann zu fragen wäre, ob sie, selbst wenn die Landeshauptstadt sich dazu entschließen würde, sie auf sich zu nehmen, über die Abfallgebühren zu refinanzieren sind oder nicht. Auch dürften dann zwar nicht berufgenossenschaftliche Regelungen (Müllwerker werden nicht bei ihrer Berufsausübung gefährdet), wohl aber straßenverkehrsordnungsrechtliche Gesichtspunkte gegen ein längeres Rückwärtsfahren eines Müllfahrzeugs mit Seiten- oder Frontladertechnik in den betroffenen Stich- bzw. Sackgassenbereichen der jeweiligen öffentlichen Straßen sprechen.
Dass dieses – hier unterstellte – rechtliche Hindernis dann wohl seit vielen Jahren in der Abfallentsorgungspraxis für den Stadtteil F. nicht beachtet worden ist, begründet für sich genommen weder einen Anspruch auf Fortsetzung des ggf. rechtswidrigen früheren Handelns der Antragsgegnerin für die Zukunft noch auf entsprechende Betätigung ihres Ermessens, alles beim alten Zustand zu belassen.
Soweit das Auswahlermessen allein die Frage beträfe, an welcher Stelle die Abfallbehälter (stattdessen) von den Überlassungspflichtigen bereitzustellen sind, sind bei summarischer Prüfung keine Rechtsfehler erkennbar.
Bei welcher Entfernung zwischen Grundstück und Aufstellungsort noch von einem „Überlassen“ i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 des (Bundes-)Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrW-/AbfG) vom 24.02.2012 ausgegangen werden kann, lässt sich nur nach der konkreten örtlichen Situation unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit entscheiden8. Bei summarischer Würdigung der Sach- und Rechtslage hat das Verwaltungsgericht aber keine Bedenken gegen den von der Antragsgegnerin jeweils ausgewählten Bereich der „Bereitstellungsfläche“ für die einzelnen Abfallbehälter in unmittelbarer Nähe bzw. am Anfang der betroffenen Stichstraße. Er liegt in zumutbarer Nähe zur (oder gar in der) Stichstraße von nicht mehr als maximal ca. 100 m, so auch im Falle der Antragstellerin, die davon am weitesten entfernt wohnt. Den betroffenen Bürgern werden bei summarischer Betrachtung hierbei keine unzumutbaren Wege zum Hin- und Hertransport der Abfallbehälter auferlegt, weder hinsichtlich der Entfernung noch hinsichtlich des jeweils befestigten Wegs. Dies gilt auch hinsichtlich der ggf. mehrfach zurück zu legenden Wege wegen der Anzahl der Behälter für die verschiedenen Abfallarten am jeweiligen Müllentsorgungstag.
Auch der Einwand fehlenden Winterdienstes der Landeshauptstadt selbst verfängt insoweit nicht. Die schon seit langem erfolgte Übertragung dieser Aufgabe nach § 3 der Straßenreinigungssatzung 1998 in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 03.08.2012 auf die Anlieger ist rechtlich nicht zu beanstanden. Soweit vorgetragen wird, dass das Verbringen der vollen und damit schweren Abfallbehälter auf die Bereitstellungsfläche im Winter durch Eis und Schnee extrem erschwert sei, ist auch dies, soweit solche Verhältnisse vorherrschen, grundsätzlich hinzunehmen, wobei den Anlieger die Schnee- und Glättebeseitigung obliegt und von ihnen gerade vor dem dargestellten Hintergrund umso gewissenhafter vorzunehmen ist.
Auch der Einwand „besorgniserrengende(r) hygienische(r) Verhältnisse“ durch Ungeziefer und Ratten an der Bereitstellungsfläche, angelockt vor allem durch die sog. gelben Säcke, erscheint bei summarischer Betrachtung nicht durchschlagend. Es ist derzeit noch ungewiss, ob eine solche Gefahr besteht. Selbst wenn sich im Entsorgungsbetrieb die befürchteten Gefahren verwirklichen sollten, wäre dem wohl auch nicht dadurch Rechnung zu tragen, dass der alte Zustand wiederhergestellt worden, sondern durch andere Maßnahmen an der Bereitstellungsfläche.
Offensichtlich rechtswidrig im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG wäre die hier streitige Anordnung schließlich dann, wenn sie nur die Abfallüberlassungspflichtigen der betroffenen Stichstraßen im Stadtteil F. betreffen sollte, obwohl es im übrigen Stadtgebiet identische Bereiche „neuer“ öffentlicher Straßen gibt. Willkür i. S. dieses Grundrechts liegt allerdings dann nicht vor, wenn die vorliegenden Fälle als Pilotprojekte bzw. Musterverfahren ausgewählt worden wären, um je nach gerichtlichem Ausgang dann auch die übrigen Abfallüberlassungspflichtigen im Stadtgebiet an nach dem 1.01.1991 gebauten öffentlichen Straßen bzw. Stichstraßen ohne hinreichende Wendemöglichkeit mit einer entsprechenden Anordnung zu belasten. Ebenso genügte dem allgemeinen Gleichheitssatz, wenn insoweit noch geprüft wird, ob es vergleichbare weitere öffentliche Straßen gibt, deren abfallüberlassungspflichtige Anlieger dann mit einer entsprechenden Verfügung belastet werden sollen; sollte dies aufgrund der faktischen Straßenverhältnisse im übrigen Stadtgebiet nicht der Fall sein, wäre der allgemeine Gleichheitssatz ohnehin schon nicht berührt.
Verwaltungsgericht Schwerin, Beschluss vom 22. Dezember 2014 – 4 B 810/14
- BVerwG, Beschluss vom 17.03.2011 – 7 B 4/11, m. w. N.[↩]
- BVerwG, a. a. O., Rn. 9[↩]
- BayVGH, Urteil vom 11.10.2010 – 20 B 10.1379[↩]
- BayVGH mit Urteil vom 11.03.2005 – 20 B 04.2741[↩]
- statt vieler: Krieger, in Hofmann/Henneke [Hrsg.], GG Kommentar zum Grundgesetz, 13. Aufl.2014, Art. 3 Rn. 18[↩]
- BayVGH, Urteil vom 11.03.2005 – 20 B 04.2741[↩]
- vgl. auch BayVGH, Urteil vom 11.03.2005 – 20 B 04.2741 – 18, wonach aus Kostengründen nicht speziell für solche Straße einsetzbare Entsorgungsfahrzeuge angeschafft werden müssen[↩]
- so zur insoweit identischen Vorgängerregelung des § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG in der Fassung bis Ende Mai 2012: BVerwG, Beschluss vom 30.09.2005 – 7 B 54/05 – 9 unter Hinweis auf BVerwG, Urteil vom 25.08.1999 – BVerwG 7 C 27.98, Buchholz 451.221 § 13 KrW-/AbfG Nr. 4[↩]