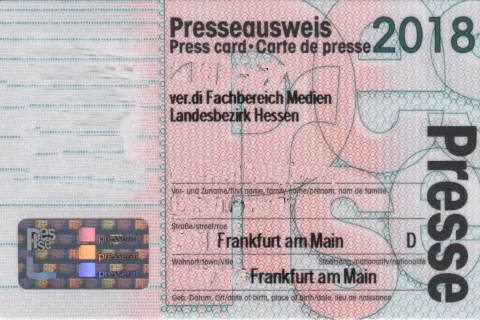§ 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO, nach der Angebote privater Bildungseinrichtungen weder für den unmittelbaren Publikumsverkehr geöffnet noch ihre Angebote dargebracht werden dürfen, beruht mit § 32 i.V.m. § 28 Abs. 1 IfSG auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage und verstößt aller Voraussicht nach nicht gegen höherrangiges Recht.

Mit dieser Begründung hat das Verwaltungsgericht Hamburg in dem hier vorliegenden Fall den Eilantrag einer Nachhilfeschule gegen die aus der Corona-Verordnung folgende Schließung für den Publikumsverkehr abgelehnt. Begründet hat die Nachhilfeschule ihr Begehren damit, dass der Anwendungsbereich des § 28 Abs. 1 IfSG nicht eröffnet sei, weil bislang in keinem Nachhilfeinstitut Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtigte oder Ausscheider festgestellt worden seien und deshalb ihr gegenüber nur Maßnahmen auf der Grundlage nach § 16 IfSG ergriffen werden dürften. Außerdem liege ein Verstoß gegen den Parlamentsvorbehalt vor.
Das sah das Verwaltungsgericht Hamburg anders: Nach seiner Auffassung dürfe § 5 Abs. 3 Nr.20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO aller Voraussicht nach auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen und nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen.
Das Verwaltungsgericht Hamburg vermag den von der Antragstellerin vorgebrachten Verstoß gegen den Parlamentsvorbehalt zumindest nach summarischer Prüfung nicht zu erkennen. Zwar können die Regelungen der §§ 32 i.V.m. § 28 Abs. 1 IfSG zu Grundrechtseingriffen mit erheblicher Intensität führen. Der parlamentarische Gesetzgeber hat sich aufgrund der Unvorhersehbarkeit der im Rahmen des Infektionsschutzes notwendigen Maßnahmen jedoch bewusst für eine generelle Ermächtigung entschieden1 und hat mit der letzten Änderung des § 28 Abs.1 IfSG2 zum Ausdruck gebracht, dass über punktuell wirkende Maßnahmen hinaus allgemeine oder gleichsam flächendeckende Verbote erlassen werden können3. Soweit Bedenken geäußert werden, dass die „notwendigen Schutzmaßnahmen“ nach § 28 Abs. 1 IfSG lediglich durch ihre „Erforderlichkeit“ begrenzt werden und man daher und angesichts der schwerwiegenden Grundrechtseingriffe der Ansicht sein könnte, die Grenzen des Eingriffs würden nicht hinreichend deutlich4 liegen darin – insbesondere bei längerer Dauer solcher Eingriffe – zwar beachtliche Argumente. Allerdings drängt sich im Rahmen der im Eilverfahren allein möglichen summarischen Prüfung die insoweit erforderliche weit überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des Parlamentsvorbehalts – und damit des Obsiegens in der Hauptsache – nicht auf. Die Verordnungsermächtigung nach § 32 Satz 1 i.V.m. § 28 Abs.1 IfSG ist demnach jedenfalls im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens nicht zu beanstanden5.
Außerdem weist das Verwaltungsgericht Hamburg darauf hin, dass selbst wenn man eine Verletzung des Parlamentsvorbehalts annehmen würde, viel dafür spricht, dass es im Rahmen der gegenwärtigen unvorhergesehenen Entwicklungen aus übergeordneten Gründen des Gemeinwohls geboten sein dürfte, nicht hinnehmbare gravierende Regelungslücken für einen Übergangszeitraum auf der Grundlage von Generalklauseln zu schließen und auf diese Weise selbst sehr eingriffsintensive Maßnahmen, die an sich einer besonderen Regelung bedürfen, vorübergehend zu ermöglichen6. Ein Verstoß gegen das Zitiergebot nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG liegt entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht vor, da der Gesetzgeber mit der Regelung des § 28 Abs.1 IfSG dem in Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG angelegten Ausgestaltungs- und Regelungsauftrag nachkommt7.
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Hamburg dürfte die Regelung des § 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO den Anforderungen der Ermächtigungsgrundlagen § 32 Satz 1 i.V.m. § 28 Abs. 1 IfSG genügen und verstößt aller Voraussicht nach nicht gegen höherrangiges Recht. Zwar dürfte darin ein erheblicher Eingriff in die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG der Antragstellerin liegen, dieser ist aller Voraussicht nach jedoch verhältnismäßig. Eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes vermag die Kammer ebenfalls nicht zu erkennen.
Das Verbot des § 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO verfolgt den legitimen Zweck, die weitere Ausbreitung der Corona-Infektion durch die Reduzierung sozialer Kontakte einzudämmen und dient damit dem Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit der Bevölkerung. Denn eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus gefährdet die Gesundheit und das Leben der Betroffenen. Nach der bei Erlass der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO und auch weiterhin fortgeltenden Risikobewertung des vom Gesetzgeber durch § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 IfSG hierzu vorrangig berufenen Robert Koch-Instituts vom 30. April 2020 wird die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen als sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. Jedoch kommen auch bei Personen ohne bekannte Vorerkrankungen, jüngeren Patienten oder Kindern schwere Verläufe vor. Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark, von symptomlosen Verläufen bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Am 30. April 2020 befanden sich 174 Personen mit Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon wurden 62 Personen intensivmedizinisch betreut. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte bereits bei 145 Personen die COVID-19 Infektion als todesursächlich festgestellt werden. Durch Schutzmaßnahmen wie nach § 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO soll die Zahl der gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich gehalten und Zeit gewonnen werden, um weitere Vorbereitungen zu treffen, wie Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, Belastungsspitzen im Gesundheitssystem zu vermeiden und die Entwicklung antiviraler Medikamente und von Impfstoffen zu ermöglichen.
Das Verbot von Dienstleistungen privater Bildungseinrichtungen für den Publikumsverkehr ist unter Berücksichtigung der Einschätzungsprärogative und des Gestaltungsspielraums des Verordnungsgebers geeignet und erforderlich, dieses Ziel zu erreichen.
Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts wird das SARS-CoV-2-Virus vor allem im direkten Kontakt zwischen Menschen durch Tröpfcheninfektion übertragen. Die hauptsächliche Übertragung erfolgt über Tröpfchen, die durch Husten und Niesen entstehen und beim Gegenüber über die Schleimhäute aufgenommen werden. Außerdem ergaben einige Studien Hinweise auf die Übertragung durch Aerosole. Aufgrund der aktuellen Erkenntnislage ist daher davon auszugehen, dass eine weitgehende Reduzierung menschlicher Kontakte die Ausbreitung des besonders leicht von Mensch zu Mensch übertragbaren neuartigen SARS-CoV-2-Virus verlangsamt und hierdurch die Infektionsdynamik verzögert wird. Die Untersagung der Darbringung von Dienstleistungen privater Bildungseinrichtungen im Rahmen des Publikumsverkehrs („Präsenzunterricht“) fördert die Eindämmung durch soziale Distanz. Denn der Aufenthalt mehrerer Personen – im Fall der Antragstellerin maximal sechs Personen – über einen längeren Zeitraum in einem typischerweise geschlossenen Schulungsraum scheint besonders geeignet, um Tröpfcheninfektionen zu begünstigen. In geschlossenen Räumen verwirbeln die Tröpfchen schlechter als unter freiem Himmel, zudem ist die fortlaufende verbale Interaktion wesentlicher Bestandteil eines Nachhilfeunterrichts. Je länger dieser Kontakt anhält, desto größer ist offenbar die Ansteckungsgefahr. Ein „hohes Ansteckungsrisiko“ besteht nach derzeitigen Erkenntnissen bei einem Kontakt zu einer erkrankten Person ab einer Dauer von 15 Minuten.
Soweit die Antragstellerin vorträgt, das Verbot nach §5 Abs. 3 HmbSARS-CoV-2-Eindäm-mungsVO sei nicht geeignet, den legitimen Zweck zu erreichen, weil eine Vielzahl anderer Einrichtungen – die Antragstellerin stellt insoweit auf den Einzelhandel ab – betrieben werden dürfte und dies (ohnehin) zu einem nicht unerheblichen Infektionsrisiko führe, greift dies nicht durch. Die Maßnahme ist aus genannten Gründen für sich betrachtet geeignet, das Infektionsrisiko zu reduzieren; dies bestreitet auch die Antragstellerin nicht. Soweit sie indes meint, die Maßnahme sei unter Berücksichtigung der erlaubten Tätigkeiten nicht geeignet, trifft dies nicht zu. Dies wäre nur der Fall, wenn das Verbot nach § 5 Abs. 3 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO aufgrund dieser erlaubten Tätigkeiten bei lebensnaher Betrachtung keinen Beitrag zur Reduzierung des Infektionsrisikos leisten könnte. Dafür liegen aber keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr dürfte die Durchführung privater Bildungsangebote aus den zuvor genannten Gründen besonders infektionsträchtig sein. Das Verbot des § 5 Abs. 3 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO ist zudem im Kontext der weiteren Verbote nach § 5 Abs. 3 Nr. 16, 17, 18 und 19 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO zu sehen, in denen Angebote, die denen der Antragstellerin strukturell ähneln, ebenfalls untersagt werden, so dass dadurch eine Vielzahl sozialer Kontakte verhindert werde. Davon abgesehen handelt es sich bei den im Einzelhandel auftretenden sozialen Kontakten – im Gegensatz zu dem von der Antragstellerin angebotenen Nachhilfeangebot – typischerweise um flüchtige Begegnungen mit geringerer sozialer bzw. verbaler Interaktion.
Die getroffene Regelung ist voraussichtlich auch erforderlich, um das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen. Unter Beachtung des dem Verordnungsgeber obliegenden Gestaltungs- und Einschätzungsspielraums ist es nicht zu beanstanden, dass er mildere Mittel wie die von der Antragstellerin vorgeschlagenen und in anderen Bereichen, wie etwa dem Einzelhandel, zum Teil bereits angeordneten Hygienemaßnahmen, beispielsweise die Einhaltung von Abstandsregelungen, das Anbringenschriftlicher und bildlicher Hinweise, den Erlass von Einlassbeschränkungen, die regelmäßige Desinfektion des Mobiliars sowie die Ausgabe von Desinfektionsmitteln oder das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, nicht für gleich geeignet hält. All diese Maßnahmen dürften gegenüber der vollständigen Schließung privater Bildungseinrichtungen zwar einen weniger einschneidenden Eingriff in die Grundrechte der Antragstellerin aus Art. 12 Abs. 1 GG beinhalten. Im Hinblick auf den Zweck des Infektionsschutzes dürften sie jedoch nicht die gleiche Wirksamkeit erreichen.
Zum einen gewährleisten diese Schutzmaßnahmen nicht mit derselben Sicherheit wie ein Verbot des Präsenzunterrichts die Eindämmung der Infektion. Denn nach den aktuellen Hinweisen des Robert Koch-Instituts vermindert ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen das Risiko einer Übertragung des Coronavirus zwar, gleichwohl kann angesichts der derzeit noch laufenden Forschung zu den Übertragungswegen der Krankheit nicht davon ausgegangen werden, dass durch Einhaltung des Mindestabstands die Verbreitung der Infektion zuverlässig verhindert wird. Gleiches gilt für das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Davon abgesehen ist auch eine Übertragung im Wege der Schmierinfektion, d.h. durch die Aufnahme von auf der Oberfläche von Gegenständen befindlichen Viren, oder eine Ansteckung über die Bindehaut der Augen nicht auszuschließen. DasVorhalten und Einsetzen von Desinfektionsmitteln vermag eine effektive Verhinderung von Virusübertragungen darüber hinaus schon deshalb nicht zu bewirken, da diese eine Tröpfcheninfektion nicht verhindern können. Demnach dürfte mit zunehmender Unterrichtsdauer die Gefahr einer Infektion tendenziell ansteigen, während das Verbot nach § 5 Abs. 3 Nr.20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO jedenfalls im Kontext des Präsenzunterrichts privater Bildungseinrichtungen diese vollständig auszuschließen vermag.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich eine lückenlose Einhaltung der Abstandsregeln und der weiteren Sicherheitsmaßnahmen kaum gewährleisten ließe. Denn entsprechende Maßnahmen setzen stets die konsequente Mitwirkung der Betroffenen – hier der Schüler und Eltern sowie der Mitarbeiter der Antragstellerin – voraus und erweisen sich bereits aus diesem Grund als fehleranfällig8. Die konsequente Einhaltung dürfte insbesondere bei Schülerinnen und Schülern, also Jugendlichen und Kindern, die die Tragweite der gegenwärtigen Situation und die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen möglicherweise nicht hinreichend erfassen oder diese für sich nicht als verbindlich empfinden – wie es durchaus im Alltag zu beobachten ist –, im Zweifel nicht zu gewährleisten sein. Davon abgesehen weist das Verwaltungsgericht Hamburg darauf hin, dass das von der Antragstellerin vorgelegte Hygienekonzept nicht den Anforderungen für den Einzelhandel nach § 8 Abs. 5, Abs. 6 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO genügen dürfte. Denn diesem Konzept kann nicht entnommen werden, dass Nachhilfeschüler, deren Eltern oder andere Personen des Publikumsverkehrs verpflichtet wären, in den Räumlichkeiten der Antragstellerin eine Schutzmaske zu tragen; dies wird in dem Konzept nach dem Verständnis des Verwaltungsgerichts lediglich empfohlen. Entsprechend enthält das Konzept keinen Hinweis darauf, dass Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, der Zugang verwehrt würde. Ebenso kann dem Hygienekonzept nicht entnommen werden, dass Oberflächen von Türen, Türgriffen oder anderen Gegenständen, die durch das Publikum oder das Personal häufig berührt werden – hier z.B. den Stühlen und Tischen –, mehrmals täglich zu reinigen wären. Das Hygienekonzept würde auch den Anforderungen des § 21 Abs. 3 Nr. 2 HmbSARS-CoV-2-Eindäm-mungsVO nicht genügen, da nicht sichergestellt wird, dass die Lerngruppen nicht durchmischt werden.
Die in § 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO geregelte Untersagung der Darbringung von Dienstleistungen privater Bildungseinrichtungen für den Publikumsverkehr ist aller Voraussicht nach auch angemessen. Dererheblichen Beeinträchtigung des aus Art.12 Abs. 1 GG folgenden Grundrechts der Antragstellerin steht das verfassungsrechtliche Schutzgut der Gesundheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gegenüber, welches die wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin überwiegt. Dem Grundrecht aus Art. 2 Abs.2 Satz 1 GG sowie dem öffentlichen Interesse am Schutz des Gesundheitssystems vor einer Überlastung aufgrund steigender Infektionszahlen ist besondere Bedeutung beizumessen9. Gerade in Hamburg ist die Anzahl der an COVID-19 Erkrankten mit aktuell 252 Fällen je 100.000 Einwohner dabei vergleichsweise hoch. Höhere Fallzahlen werden aktuell lediglich für Baden-Württemberg, Bayern und das Saarland gemeldet. Die nunmehr erreichte Verlangsamung der Ausbreitung des Virus zur Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystemsder Stadt und zur Gewährleistung, schwer Erkrankte behandeln zu können, erfordert auch aktuell noch einschneidende Maßnahmen, um einen erneuten starken Anstieg zu vermeiden (sog. „Zweite Welle“). Sollte es zu einer solchen „Zweiten Welle“ kommen, ist aufgrund der Erfahrungen in anderen EU-Mitgliedstaaten wie Italien, Frankreich und Spanien zu erwarten, dass eine sehr rasch zunehmende Zahl von Infizierten schwere Krankheitsverläufe erleiden und deshalb intensivmedizinische Behandlung benötigen werden. Darum ist es weiterhin von erheblicher Bedeutung, eine ausreichende Anzahl von Intensivbetten und Beatmungsgeräten für gleichzeitig behandlungsbedürftige Patienten zur Verfügung zu haben10.
Die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten primär wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin müssen dahinter zurückstehen, auch wenn die Antragstellerin durch die Schließung ihrer Nachhilfeschulen für den Präsenzunterricht voraussichtlich in einem hohen Maße wirtschaftlich beeinträchtigt ist. Denn die massiven Folgen, die die Regelung des § 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO mit sich bringt, sind dadurch abgemildert, dass die Antragstellerin nicht gehindert ist, ihre Dienstleistungen digital, d.h. online, anzubieten. Eine Internetrecherche auf der Webseite der Antragstellerin (https://www….)hat ergeben, dass die Antragstellerin derartige Online-Angebote vielfach anbietet und bewirbt. Aufgrund der durch die Schließung des Präsenzunterrichts freiwerdenden Kapazitäten der Lehrkräfte dürfte es der Antragstellerin auch möglich sein, Online-Nachhilfestunden verstärkt anzubieten. Das Verwaltungsgericht erachtet es als nicht fernliegend, dass mit der Untersagung des Präsenzunterrichts die Nachfrage nach Online-Nachhilfe gestiegen sein könnte und mit der schrittweisen Wiederöffnung der Schulen tendenziell weiter steigen könnte. Auch wenn dadurch der wirtschaftliche Verlust aufgrund des Ausfalls des Präsenzbetriebs nicht aufgefangen wird, mildert er diese diesen doch ab. Zur Milderung der finanziellen Verluste dürften ferner potenzielle Kompensationennach den Förderprogrammen von Bund und Ländern beitragen. Schließlich ist die Regelung des § 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO bis zum 6. Mai 2020 befristet, was die Eingriffsintensität zusätzlich abmildert.
Vor diesem Hintergrund ist jedenfalls nach summarischer Prüfung auch nicht zu beanstanden, dass § 5 Abs. 3 Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO keine Ausnahmen zulässt. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin führt das Fehlen einer Ausnahme nicht per se zu einer Unverhältnismäßigkeit einer gesetzlichen Regelung; ein solcher Schluss ergibt sich auch nicht aus der von der Antragstellerin angeführten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 202011. Vielmehr müsste insoweit die fehlende Ausnahmemöglichkeit eine Situation nach sich ziehen können, die eine derartige Eingriffsintensität in grundrechtlich geschützte Positionen begründet, dass sie angesichts der gesetzgeberischen Ziele als nicht mehr hinnehmbar anzusehen wäre. Dies ist aus den genannten Gründen nicht ersichtlich.
Die Vorschrift des § 5 Abs. 3Nr. 20 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO verstößt entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG.
Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verbietet einem Träger hoheitlicher Gewalt, im Wesentlichen gleiche Sachverhalte unterschiedlich zu behandeln. Für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Normen gibt der allgemeine Gleichheitssatz keinen einheitlichen Prüfungsmaßstab vor12. Je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen ergeben sich unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten,auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen können. Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind. Art. 3 Abs.1 GG gebietet nicht nur, dass die Ungleichbehandlung an ein der Art nach sachlich gerechtfertigtes Unterscheidungskriterium anknüpft, sondern verlangt auch für das Maß der Differenzierung einen inneren Zusammenhang zwischen den vorgefundenen Verschiedenheiten und der differenzierenden Regelung, der sich als sachlich vertretbarer Unterscheidungsgesichtspunkt von hinreichendem Gewicht erweist. Entscheidend ist, ob für eine am Gerechtigkeitsdenken orientierte Betrachtungsweise die tatsächlichen Ungleichheiten in dem jeweils in Betracht kommenden Zusammenhang so bedeutsam sind, dass sie beachtet werden müssen. Der Gleichheitssatz ist dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten oder Normbetroffenen im Vergleich zu einer anderen anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können. Dabei gilt ein stufenloser,am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen. Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere aus den jeweils betroffenen Freiheitsrechten ergeben13.
Hiernach sind die sich aus dem Gleichheitssatz ergebenden Grenzen für die Antragsgegnerin bei Regelungen eines dynamischen Infektionsgeschehens weniger streng14 und einestrikte Beachtung des Gebots innerer Folgerichtigkeit kann unter diesen Umständen nicht eingefordert werden15. Zudem ist die sachliche Rechtfertigung nicht allein anhand des infektionsschutzrechtlichen Gefahrengrades der betroffenen Tätigkeit zu beurteilen. Vielmehr sind auch alle sonstigen relevanten Belange zu berücksichtigen, etwa die Auswirkungen der Ge- und Verbote für die betroffenen Unternehmen und Dritte und auch öffentliche Interessen an der uneingeschränkten Aufrechterhaltung bestimmter unternehmerischer Tätigkeiten16.
Dies zugrunde gelegt, dürfte in der Systematik aus Regelversagung bzw. -beschränkung in §§5 Abs. 3 Nr. 20, 8 Abs. 3 Nr. 18, Abs. 5, Abs. 6, 21 Abs.3 HmbSARS-CoV-2-Eindäm-mungsVO derzeit kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz gesehen werden können.
Die Antragstellerin beruft sich auf eine Ungleichbehandlung gegenüber Einzelhandelsbetrieben mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 qm, gegenüber Dienstleistungsbetrieben im Allgemeinen und gegenüber Schulen, die jeweils öffnen dürften. Sie könne in ihren Nachhilfeschulen die für Verkaufsstellen geltenden gesetzlichen Hygieneschutzmaßnahmen ebenso gut einhalten. Pro Nachhilfeeinheit würden maximal fünf Personen teilnehmen. Diese würden zu festen Terminen stattfinden, Warteschlangen gebe es nicht. Wenn Schulen wieder ihren Unterricht aufnehmen dürften, sei auch kein Grund mehr ersichtlich, warum eine Schülernachhilfe weiterhin geschlossen bleiben müsse. Es fehle zudem eine erforderliche Ausnahmemöglichkeit im Rahmen des Verbots. Eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung liege auch darin, dass Dienstleistungen im Rahmen des § 8 Abs. 3 Nr. 18 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVOangeboten werden dürften.
Selbst unter Beschränkung auf den mit der Hamburgischen SARS-CoV-2-EindämmungsVO allein verfolgten Zweck des Infektionsschutzes dürfte es im Hinblick auf den Einzelhandel und die Dienstleistungsbetriebe im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 18 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO bereits an wesentlich gleichen Sachverhalten mangeln. Eine Vergleichbarkeit könnte sich hinsichtlich des Einzelhandels allenfalls mit Blick darauf ergeben, dass dort jeweils Personen in geschlossenen Räumen zusammenkommen, in denen sie sich für eine gewisse Zeit aufhalten, was die grundsätzliche Gefahrder Ansteckung mit sich bringt. Allerdings dürften die durchschnittliche Verweildauer sowie die verbale und soziale Interaktion eines Kunden im Einzelhandels deutlich geringer sein als in den Nachhilfestunden der Antragstellerin, in denen sich die Betroffenen sitzend über längere Zeit in einem Schulungsraum aufhalten, der zudem deutlich kleiner als ein durchschnittliches Ladengeschäft des Einzelhandels sein dürfte. Ferner ist ein Vergleich zu Dienstleistungsbetrieben im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 18 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO angesichts der großen Vielfalt darunter fallender Betriebe kaum sinnvoll möglich. Naheliegender ist vielmehr ein Vergleich zu Dienstleistungsangeboten, die denen der Antragstellerin strukturell ähneln, also solche, bei denen sich eine Mehrzahl von Menschen zu Schulungszwecken längere Zeit in einem Raum aufhält. Derartige Angebote hat der Verordnungsgeber im Rahmen des § 5 Abs. 3 Nr. 16, 17, 18 und 19 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO ebenso untersagt, eine Ungleichbehandlung ist insoweit nicht erkennbar.
Dies kann aber letztlich dahinstehen, da selbst bei Annahme von wesentlich Gleichem die durch den Verordnungsgeber getroffene Unterscheidung jedenfalls sachlich gerechtfertigt und daher nicht zu beanstanden sein dürfte.
Das von der Antragsgegnerin vorgebrachte Argument, durch die schrittweise Gestattung einer Wiedereröffnung von Betrieben einzelner Branchen und Schulen langsam zum Normalzustand zurückzukehren und die aufgrund des Infektionsschutzes weiterhin notwendige soziale Distanzierung gesellschaftlich vertretbar zu steuern, ist prinzipiell nachvollziehbar. Der allgemeine Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG gebietet nicht, dass die unter Infektionsschutzgesichtspunkten angesichts der derzeitigen Epidemie erlassenen Betriebsverbote bzw. -einschränkungen für die unterschiedlichen betroffenen Branchen gleichzeitig wieder aufgehoben werden müssen. Einen Automatismus im Sinne von „alle oder keine“ vermag der allgemeine Gleichheitssatz nicht zu begründen, zumal die Einschränkungen sozialer Kontakte durch die HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO – ebenso wie die entsprechenden Maßnahmen anderer Bundesländer – dem Ziel dienen, zumindest einer Überlastung des Gesundheitssystems durch eine unkontrollierte und dann gegebenenfalls bald unkontrollierbare Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus vorzubeugen; bei dieser Zielsetzung liegt ein schrittweises Vorgehen durchaus nahe und ist nicht zu beanstanden17.
Dies vor Augen geführt, hat der Verordnungsgeber im Rahmen seines weiten Entscheidungsspielraums18 die strukturelle Grundentscheidung getroffen, zur Bekämpfung der durch die Pandemie drohenden Gefahren fürs erste nur Lockerungen in bestimmten Bereichen (z.B. Einzelhandel, Schulen) vorzunehmen und private Bildungsangebote zunächst von den Lockerungen auszuklammern. Für das Verwaltungsgericht ist nicht ersichtlich, dass sich der Verordnungsgeber bei der getroffenen Entscheidung nicht an sachlichen Kriterien orientiert hätte. Soweit sich der Verordnungsgeber bei der Beurteilung der Frage der Lockerungen von der Vorstellung leiten ließ, dass die Bevölkerung auf private Bildungsangebote weniger dringend angewiesen ist, als auf das Angebot des Einzelhandels, sonstige Dienstleistungen und den Schulbetrieb, dürfte er sich jeweils auf ein sachlich gerechtfertigtes Unterscheidungskriterium gestützt haben.
So dient der Einzelhandel ebenso wie die Regelung des § 8 Abs. 3 Nr. 18 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO der allgemeinen Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Waren, Gütern und Dienstleistungen verschiedenster Art. Zugleich werden durch diese Lockerungen die wirtschaftlichen Folgen für die jeweiligen Geschäftsinhaber auf einer breiten Basis abgemildert, was zugleich die gesellschaftliche Akzeptanz der weiterhin bestehenden zahlreichen Beschränkungen des öffentlichen wie privaten Lebens fördern dürfte. Im Hinblick auf die – sehr beschränkte – Wiederöffnung der Schulen verweist die Antragsgegnerin zutreffend auf den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag nach Art. 7 Abs. 1 GG und die soziale Bedeutsamkeit der Schule – sowohl für die Schüler als auch mittelbar deren Eltern –, zumal sonstige wichtige soziale Orte für Kinder und Jugendliche weiterhin geschlossen bleiben. Die Antragsgegnerin verweist ebenso zutreffend darauf hin, dass die Antragstellerin als gewerbliche Bildungsanbieterin solche Belange für sich nicht ins Feld führen kann und, davon abgesehen, nur ein vergleichsweise geringer Anteil der Hamburger Schüler ihre Leistungen nachfragen dürfte. Zwar mag es wie von der Antragstellerin vorgetragen zutreffen, dass diese Schüler aus verschiedensten Gründen besonders förderwürdig seien. Dies führt aber nicht dazu, dass die vom Verordnungsgeber vorgenommene Differenzierung unsachlich wäre. Im Übrigen verweist das Verwaltungsgericht erneut auf die weiterhin bestehende und von der Antragstellerin auch angebotene digitale Erbringung ihrer Dienstleistungen, die diese als gewerbliche Anbieterin und im Rahmen ihrer Kleingruppen im Zweifel auch besser umsetzen können dürfte als dies in vielen Fällen den staatlichen Schulen möglich ist. Dies dürfte gerade für ältere Schüler, die vor ihrem Schulabschluss stehen und von denen der Antragstellerin zufolge zahlreiche unter ihren Schülern vertreten sind, auch eine akzeptable Möglichkeit sein.
Soweit sich der Verordnungsgeber darüber hinaus von der Vorstellung leiten ließ, dass es bei privaten Bildungsangeboten aufgrund der typischerweise damit verbundenen Aktivitäten – mehrere Menschen in einem typischerweise geschlossenen Raum über längere Zeit bei ständiger sozialer Interaktion und wechselnden Teilnehmern – eine tendenziell erhöhte Infektionsgefahr gebe, dürfte er sich ebenfalls auf ein sachlich gerechtfertigtes Unterscheidungskriterium gestützt haben.
Verwaltungsgericht Hamburg, Beschluss vom 4. Mai – 14 E 1805/20
- vgl. BT-Drs. 14/2530, S.74 f.[↩]
- vgl. BT-Drs. 19/18111, S. 10[↩]
- vgl. OVG Münster, Beschluss v. 06.04.2020 – 13 B 398/20.NE[↩]
- vgl. OVG Saarlouis, Beschluss v. 22.04.2020 – 2 B 128/20; VGH Mannheim, Beschluss v.09.04.2020 – 1 S 925/20 Rn. 43[↩]
- OVG Hamburg, Beschluss v. 30.04.2020 – 5 Bs 64/20; OVG Lüneburg, Beschluss v. 27.04.2020 – 13 MN 98/20; VGH Kassel, Beschluss v. 07.04.2020 – 8 B 892/20.N; OVG Münster, Beschluss v.06.04.2020 – 13 B 398/20.NE; VGH München, Beschluss v. 30.03.2020 – 20 NE 20.632[↩]
- vgl. dazu näher OVG Münster, Beschluss v. 06.04.2020 – 13 B 398/20.NE[↩]
- vgl. OVG Münster, Beschluss v. 06.04.2020 – 13 B 398/20.NE; VGH München, Beschluss v. 30.03.2020 – 20 CS 20.611; allg. dazu: BVerfG, Urteil v. 18.12.1968 – 1 BvR 638/64 u.a. und Beschluss vom 04.05.1983 – 1 BvL 46/80 u. a.[↩]
- vgl. VG Düsseldorf, Beschluss v. 20.03.2020 – 7 L 575/20; VG Hamburg, Beschluss v. 27.04.2020 – 2 E 1737/20[↩]
- vgl. OVG Hamburg, Beschluss v. 16.04.2020 – 5 Bs 58/20[↩]
- vgl. VG Hamburg, Beschluss v. 22.04.2020 – 13 E 1707/20; Beschluss v. 16.04.2020 – 2 E 1671/20[↩]
- 1 BvQ 44/20[↩]
- vgl. BVerfG, Beschl. v. 27.1.1998 – 1 BvL 15/87[↩]
- vgl. BVerfG, Beschl. v. 21.06.2011 – 1 BvR 2035/07; OVG Hamburg, Urt. v. 01.03.2019 – 1 Bf 216/18[↩]
- vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 17.04.2020 – OVG 11 S 22/20[↩]
- vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 26.03.2020 – 5 Bs 48/20[↩]
- vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 27.04.2020 – 13 MN 98/20; Beschl. v. 14.4.2020 – 13 MN 63/20[↩]
- vgl. OVG Weimar, Beschluss v. 09.04.2020 – 3 EN 238/20; VG Hamburg, Beschluss v. 27.04.2020 – 2 E 1737/20; Beschluss v. 27.04.2020 – 21 E 1736/20[↩]
- vgl. OVG Hamburg, Beschluss v. 30.04.2020 – 5 Bs 64/20[↩]
Bildnachweis:
- Schule: klimkin