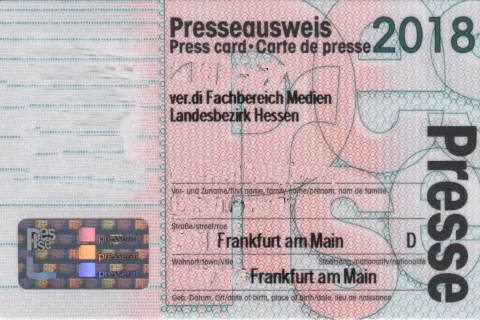§ 16 Abs. 5 BImSchG gilt auch für gemäß § 67 Abs. 2 BImSchG angezeigte Anlagen. Im Fall des Wiederaufbaus einer zerstörten Anlage entbindet § 16 Abs. 5 BImSchG lediglich von der Pflicht, ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen, nicht jedoch von der Beachtung anderer behördlicher Genehmigungserfordernisse. Die Vorschrift lässt die Pflicht, ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen, unberührt.

Nach dem Wortlaut des § 16 Abs. 5 BImSchG könnte unter „Genehmigung“ zwar auch eine baurechtliche Genehmigung zu verstehen sein. Bereits aus kompetenziellen Gründen liegt es nahe, dass § 16 Abs. 5 BImSchG entsprechend dem Regelungsgegenstand des BundesImmissionsschutzgesetzes lediglich die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit meint. Die Systematik bestätigt diesen Befund. § 16 Abs. 5 BImSchG entfaltet selbst keine Konzentrationswirkung. Die Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG ist auf immissionsschutzrechtliche Genehmigungen im Sinne der §§ 4, 19 BImSchG beschränkt. § 13 BImSchG unterscheidet seinerseits zwischen „Genehmigung“ und „anderen behördlichen Entscheidungen“. Zu den „anderen behördlichen Entscheidungen“ gehört nicht zuletzt die Baugenehmigung. Für das Entfallen auf anderer Rechtsgrundlage beruhender Genehmigungserfordernisse hätte es daher einer ausdrücklichen Regelung bedurft. Eine solche Regelung, mit der angeordnet wird, dass § 16 Abs. 5 BImSchG Konzentrationswirkung gemäß § 13 BImSchG entfalten solle, fehlt indes. Die fehlende Regelung stellt auch keine Regelungslücke dar, die im Wege einer entsprechenden Anwendung des § 13 BImSchG auf Fälle des § 16 Abs. 5 BImSchG zu schließen wäre. Das ergibt sich aus den Gesetzgebungsmaterialien und wird durch Sinn und Zweck des § 16 Abs. 5 BImSchG bestätigt.
Der Befund, dass die Bauaufsichtsbehörde im Fall des Wiederaufbaus einer zerstörten Anlage verpflichtet bleibt, die baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen, deckt sich mit dem Willen des Gesetzgebers. Im Gesetzgebungsverfahren wurde die Problematik erkannt und erörtert, dass sich im Fall der Ersetzung einer Anlage nicht nur die Frage der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbedürftigkeit, sondern auch die Frage anderer behördlicher Entscheidungen stellt. Im Zusammenhang mit dem in § 15 BImSchG geregelten Anzeigeverfahren hat der federführende Ausschuss den Konflikt zwischen dem gesetzgeberischen Ziel der Beschleunigung des Verfahrens und der Anpassungspflicht eines Betreibers ebenfalls erörtert und zusammenfassend darauf hingewiesen, dass das Anzeigeverfahren „wegen dem dann erforderlich werdenden (parallelen) Baugenehmigungsverfahren“ zu keiner Verfahrensvereinfachung führe1. Der Gesetzgeber ging also selbst davon aus, dass der von ihm mit der Änderung des BundesImmissionsschutzgesetzes gewünschte Beschleunigungseffekt, auf den auch § 16 Abs. 5 BImSchG zielt, in den wenigsten Fällen zum Tragen kommt. Gleichwohl hat er darauf verzichtet, eine Regelung aufzunehmen, die anordnet, dass beim Wiederaufbau einer zerstörten Anlage nicht nur das immissionsschutzrechtliche Verfahren, sondern auch die nach dem einschlägigen Fachrecht notwendigen anderen Genehmigungserfordernisse entfallen. Vor diesem Hintergrund verfängt der Einwand des Klägers nicht, Ziel der Änderung des BundesImmissionsschutzgesetzes sei eine Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens. Der Gesetzgeber hat es in Kenntnis der Problematik hingenommen, dass der Beschleunigungseffekt des § 16 Abs. 5 BImSchG beschränkt ist. Die Gesetzgebungsgeschichte enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber mit § 16 Abs. 5 BImSchG nicht nur das formelle Genehmigungserfordernis nach dem BundesImmissionsschutzgesetz entfallen lassen, sondern auch materiell Bestandsschutz vermitteln wollte2.
Sinn und Zweck des § 16 Abs. 5 BImSchG bestätigen, dass die Vorschrift lediglich von der Durchführung eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens, nicht jedoch von der Beachtung anderer behördlicher Genehmigungserfordernisse entbindet. § 16 Abs. 5 BImSchG zielt auf eine verfahrensrechtliche Beschleunigung, lässt jedoch die materiellrechtlichen Pflichten des Immissionsschutzrechts unberührt. Im Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG folgt die Anpassungspflicht an nachträgliche Rechtsänderungen schon aus der dynamischen Natur der Betreiberpflichten im Sinne des § 5 BImSchG. Durch sie wird sichergestellt, dass der materielle Standard des Immissionsschutzrechts gewahrt bleibt3. Die zuständige Behörde wird durch § 16 Abs. 5 BImSchG nicht gehindert, nachträgliche immissionsschutzrechtliche Anordnungen zu erlassen. Nicht nur die Betreiberpflichten nach dem BundesImmissionsschutzgesetz, sondern auch die Verpflichtungen, die sich aus öffentlichrechtlichen Vorschriften im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zusätzlich ergeben, können Änderungen unterworfen sein. Für Rechtsänderungen im Bereich der öffentlichrechtlichen Vorschriften im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG enthält das BundesImmissionsschutzgesetz weder eine ausdrückliche Anpassungspflicht noch spezielle Ermächtigungsgrundlagen für die Umsetzung nachträglicher Änderungen. Daraus folgt jedoch nicht, dass Anlagen im Bereich der öffentlichrechtlichen Vorschriften im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG einen größeren (Bestands-)Schutz genießen. Einen baurechtlichen Bestandsschutz vermag das BundesImmissionsschutzgesetz nicht zu vermitteln. Die Verpflichtung, eine Anlage an nachträgliche Änderungen anzupassen, beurteilt sich vielmehr nach dem jeweils einschlägigen Fachrecht4.
Die Pflicht, im Fall des Wiederaufbaus einer immissionsschutzrechtlich nach § 16 Abs. 5 BImSchG privilegierten Anlage ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen, verstößt nicht gegen Art. 14 Abs. 1 GG.
Aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG lässt sich kein Anspruch auf Zulassung eines Vorhabens außerhalb gesetzlicher Regelungen herleiten. Welche Befugnisse einem Eigentümer in einem bestimmten Zeitpunkt zustehen, ergibt sich aus der Zusammenschau aller in diesem Zeitpunkt geltenden, die Eigentümerstellung regelnden gesetzlichen Vorschriften. Ergibt sich hierbei, dass der Eigentümer eine bestimmte Befugnis nicht hat, so gehört diese nicht zu seinem Eigentumsrecht5. Auf Bestandsschutz kann sich der Kläger nicht berufen. § 16 Abs. 5 BImSchG vermittelt – wie dargelegt – keine gesicherte baurechtliche Position. An die auf der Auslegung der landesrechtlichen Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung beruhende Auffassung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, dass die im Jahr 1999 erteilte Baugenehmigung die Wiedererrichtung einer zerstörten Anlage nicht abdeckt, ist das Bundesverwaltungsgericht gebunden. Dass sich aus dem Baurecht ein Bestandsschutz für das durch Zerstörung untergegangene Eigentum ergibt, behauptet auch der Kläger nicht.
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21. Dezember 2011 – 4 C 12.10
- BR-Drucks 31/1/96 S. 18; BT-Drucks 13/5100 S. 15, 17; BT, 13. WP, Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Protokoll Nr. 31 S.20[↩]
- Storost, in: Ule/Laubinger, BImSchG, Stand April 2011, § 16 Rn. C 22; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. III, Stand April 2011, § 16 Rn. 150, 181; Böhm, in: Koch/Pache/Scheuing, GKBImSchG, Stand 2010, § 4 Rn. 24; Nöthlichs, Immissionsschutz, Band 1, Stand März 2011, § 16 BImSchG, Erl.01.06.2; Sellner, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. III, Stand Oktober 1998, § 16 BImSchG Rn. 167; Führ, in: Koch/Pache/Scheuing, GKBImSchG, Stand September 2006, § 16 Rn. 147; ders., ZUR 1997, 293, 296; Wasielewski, LKV 1997, 77, 80; Kahle, NVwZ 2011, 1159, 1163 f.; a.A. Dietlein, in: Landmann/Rhomer, Umweltrecht, Bd. III, Stand Juli 2011, § 4 Rn. 67; vgl. auch Kotulla, BImSchG, Stand 2007, § 4 Rn. 72[↩]
- BVerwG, Urteil vom 30.04.2009 – 7 C 14.08, NVwZ 2009, 1441 Rn. 24 sowie dazu BVerfG, Beschluss vom 14.01.2010 – 1 BvR 1627/09, NVwZ 2010, 771 Rn. 43[↩]
- BVerwG, Urteil vom 30.04.2009 a.a.O. Rn. 25; BVerfG, Beschluss vom 14.01.2010 a.a.O. Rn. 44[↩]
- BVerfG, Beschluss vom 14.01.2010 a.a.O. Rn. 26[↩]