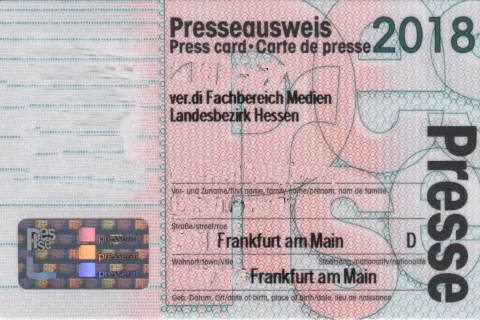Die Wiedernutzbarmachung einer Fläche als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB ist erst ausgeschlossen, wenn eine ehemals dem Siedlungsbereich angehörende, baulich in Anspruch genommene Fläche diese Zugehörigkeit wieder verloren hat. Ob eine tatsächlich vorbelastete Brachfläche weiterhin dem Siedlungsbereich angehört, bestimmt die Verkehrsauffassung.

Nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Dies gilt entsprechend für die Änderung und Ergänzung eines Bebauungsplans (§ 13a Abs. 4 BauGB).
Das Tatbestandsmerkmal der Innenentwicklung ist der Oberbegriff. Es ist Voraussetzung sowohl für die in § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB beispielhaft genannten Maßnahmen der Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung von Flächen als auch für andere, nicht konkretisierte Maßnahmen1. Mit diesem Tatbestandsmerkmal beschränkt § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB seinen räumlichen Anwendungsbereich. Der Gesetzgeber knüpft mit § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB an die ältere Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB an, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll und dabei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. Er grenzt Bebauungspläne der Innenentwicklung von Bebauungsplänen ab, die gezielt Flächen außerhalb der Ortslagen einer Bebauung zuführen, und will mit § 13a Abs. 1 BauGB Planungen fördern, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). Als Gebiete, die für Bebauungspläne der Innenentwicklung in Betracht kommen, nennt er beispielhaft die im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB, innerhalb des Siedlungsbereichs befindliche brachgefallene Flächen sowie innerhalb des Siedlungsbereichs befindliche Gebiete mit einem Bebauungsplan, der infolge notwendiger Anpassungsmaßnahmen geändert oder durch einen neuen Bebauungsplan abgelöst werden soll2. Mit dem beschleunigten Verfahren und den damit verbundenen Verfahrenserleichterungen will der Gesetzgeber einen Anreiz dafür schaffen, dass die Gemeinden von einer Neuinanspruchnahme von Flächen durch Überplanung und Zersiedlung des Außenbereichs absehen und darauf verzichten, den äußeren Umgriff vorhandener Siedlungsbereiche zu erweitern3. Innenentwicklung ist daher nur innerhalb des Siedlungsbereichs zulässig; das gilt ausweislich der Gesetzesbegründung auch für die Änderung oder Anpassung von Bebauungsplänen4. Dabei richtet sich die Abgrenzung von Innen- und Außenentwicklung grundsätzlich nach den tatsächlichen Verhältnissen und nicht nach dem planungsrechtlichen Status der Flächen5.
Nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB ist die Wiedernutzbarmachung von Flächen eine Maßnahme der Innenentwicklung.
Im vorliegenden Fall hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg6 eine fortdauernde Zugehörigkeit der Fläche zum Siedlungsbereich verneint, weil die aufstehende Bebauung beseitigt worden sei, zumindest deutlich wahrnehmbare oberflächliche Reste einer vormaligen Nutzung fehlten und die Verkehrsauffassung nicht mit einer erneuten Bebauung gerechnet habe. Mit dieser Sichtweise überspannt es die Voraussetzungen für die Wiedernutzbarmachung einer Fläche. Es hat sich ersichtlich an den strengen Maßstäben orientiert, die das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 04.11.20157 zu der Frage aufgestellt hat, ob ein Bebauungsplan der Innenentwicklung auf – seit jeher unbebaute – Flächen des Außenbereichs zugreifen darf. Diese Maßstäbe können aber nicht ohne Weiteres beantworten, ob eine einmal dem Siedlungsbereich zugehörige Fläche noch im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB wiedernutzbar gemacht werden kann.
Der durch § 13a BauGB vorgenommenen Abgrenzung zwischen Innen- und Außenentwicklung liegt die gesetzliche Wertung zu Grunde, dass Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs aufgrund der baulichen Inanspruchnahme und der damit einhergehenden Versiegelung bodenrechtlich weniger schutzwürdig sind als „unberührte“ Flächen außerhalb des Siedlungsbereichs. So knüpfen die beiden in § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB ausdrücklich genannten Fälle der Innenentwicklung, die Wiedernutzbarmachung von Flächen und die Nachverdichtung, jeweils an eine bauliche Inanspruchnahme an8. Nach § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu nutzen. § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB verlangt vor der Umwandlung von landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flächen, dass Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung angestellt werden, zu denen insbesondere Brachflächen zählen können.
Die Wiedernutzbarmachung einer Fläche als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB ist erst ausgeschlossen, wenn eine ehemals dem Siedlungsbereich angehörende, baulich in Anspruch genommene Fläche diese Zugehörigkeit wieder verloren hat. Hierzu genügt es nicht, dass die Fläche von aufstehender Bebauung beräumt und oberflächlich entsiegelt wird. Solange die Fläche aufgrund unterirdisch verbleibender Gebäudereste, sonstiger Versiegelungen oder nachhaltiger Veränderungen der Bodenstruktur einer natürlichen Vegetationsentwicklung nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht, wirkt die ehemalige bauliche Inanspruchnahme fort. Greift ein Bebauungsplan auf solche Flächen zu, kann dies dem Anliegen des § 13a BauGB Rechnung tragen, die gezielte erstmalige Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungszwecke zu verringern und Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden9.
iese Auslegung ist nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auch mit Unionsrecht vereinbar. Mit § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB hat der nationale Gesetzgeber von der zweiten Variante des Art. 3 Abs. 5 Satz 1 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme10 Gebrauch gemacht und abstrakt-generell festgelegt, dass bestimmte Pläne ausnahmsweise im beschleunigten Verfahren und damit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erlassen werden können11. Eine solche abstrakte Regelung ist zulässig, weil es denkbar ist, dass eine besondere Art von Plan, die bestimmte qualitative Voraussetzungen erfüllt, a priori voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, da die Voraussetzungen gewährleisten, dass ein solcher Plan den einschlägigen Kriterien des Anhangs II der Richtlinie entspricht12. Das trifft im Zusammenwirken mit den weiteren Vorgaben in § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Satz 4 und 5 BauGB insbesondere auf solche Bebauungspläne zu, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen dienen, deren vormalige bauliche Inanspruchnahme noch fortwirkt, und so einen zusätzlichen Flächenverbrauch sowie weitere Eingriffe in Natur und Landschaft vermeiden. Mit diesem Ziel leistet der Bebauungsplan der Innenentwicklung zugleich einen Beitrag zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung im Sinne des Anhangs II Nr. 1 Spiegelstrich 3 der SUP-Richtlinie13.
Ob eine tatsächlich vorbelastete Brachfläche weiterhin dem Siedlungsbereich angehört, bestimmt die Verkehrsauffassung. Dies erkennt auch die Vorinstanz, ihrer tatrichterlichen Würdigung liegen aber fehlerhafte rechtliche Maßstäbe zugrunde.
Die Verkehrsauffassung, ob eine Fläche weiterhin dem Siedlungsbereich angehört, wird von Planungen der Gemeinde beeinflusst.
Beabsichtigt die Gemeinde die Renaturierung von Flächen, wird sich recht bald die Verkehrsauffassung bilden können, die Grenze des Siedlungsbereichs habe sich zurückgebildet. Stellt die Gemeinde dagegen im Zusammenhang mit dem Rückbau von Gebäuden einen Bebauungsplan für die Wiedernutzung auf, ist dies ein starkes Indiz, dass sich die Grenzen des Siedlungsbereichs nicht verschieben. Dieses Indiz mag mit der Zeit an Gewicht verlieren. Das ist aber nicht schon dann der Fall, wenn sich eine konkrete Planung oder ein bestimmtes städtebauliches Konzept nicht umsetzen lässt.
Anders als das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg annimmt, kann zur Bestimmung der Verkehrsauffassung nicht an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Erhalt des Bebauungszusammenhangs im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB14 angeknüpft werden, wonach eine bereits beseitigte Bebauung bzw. eine eingestellte Nutzung den Charakter eines Gebiets fortwirkend prägen kann, solange mit einer erneuten Bebauung bzw. der Wiederaufnahme der Nutzung gerechnet werden kann. Denn die Reichweite des Siedlungsbereichs des § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann nicht nach den Maßstäben beantwortet werden, welche die Bebaubarkeit einzelner Grundstücke zum Gegenstand haben.
Entscheidend ist demgegenüber, ob sich eine Verkehrsauffassung dahingehend gebildet hat, dass der jeweilige Siedlungsbereich dauerhaft überhaupt keiner Bebauung mehr zugänglich sein wird. Erst in einem solchen Fall verliert eine gemeindliche Planung ihre indizielle Wirkung.
Für die Frage, ob eine Fläche nach der Verkehrsauffassung weiterhin dem Siedlungsbereich zugehört, können auch tatsächliche Umstände Bedeutung erlangen. So mag eine dauerhafte, hinreichend wehrhafte Einzäunung für eine Zugehörigkeit zum Siedlungsbereich sprechen. Von Bedeutung können auch das äußere Erscheinungsbild der Flächen sowie Art, Dauer und Intensität der bisherigen Nutzung sein, sofern diese Rückschlüsse auf den Grad der verbliebenen baulichen Belastung zulassen. Dabei wird die Verkehrsauffassung berücksichtigen, dass gerade die Wiedernutzbarmachung industriell genutzter Flächen erhebliche Zeiträume in Anspruch nehmen kann.
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 27. August 2020 – 4 CN 4.19
- BVerwG, Urteile vom 04.11.2015 – 4 CN 9.14, BVerwGE 153, 174 Rn. 21; und vom 25.06.2020 – 4 CN 5.18 27; Beschluss vom 20.06.2017 – 4 BN 30.16, Buchholz 406.11 § 13a BauGB Nr. 4 Rn. 4[↩]
- BT-Drs. 16/2496 S. 12 zu Nr. 8 und Absatz 1[↩]
- BVerwG, Urteile vom 04.11.2015 – 4 CN 9.14, BVerwGE 153, 174 Rn. 24; und vom 25.06.2020 – 4 CN 5.18 26[↩]
- BT-Drs. 16/2496 S. 12; BVerwG, Urteile vom 04.11.2015 – 4 CN 9.14, BVerwGE 153, 174 Rn. 22 ff.; und vom 25.06.2020 – 4 CN 5.18 28[↩]
- BVerwG, Urteil vom 25.06.2020 – 4 CN 5.18 24 ff.[↩]
- OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 21.03.2019 – OVG 2 A 8.16[↩]
- BVerwG, Urteil vom 04.11.2015 – 4 CN 9.14, BVerwGE 153, 174[↩]
- BVerwG, Urteil vom 25.06.2020 – 4 CN 5.18 28[↩]
- BT-Drs. 16/2496 S. 1, 9 und 15[↩]
- ABl. L 197 S. 30; im Folgenden „SUP-Richtlinie“[↩]
- BT-Drs. 16/2496 S. 13[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 25.06.2020 – 4 CN 5.18 30 und Beschluss vom 31.07.2014 – 4 BN 12.14, Buchholz 406.11 § 13a BauGB Nr. 1 Rn. 10; EuGH, Urteil vom 18.04.2013 – C-463/11 [ECLI:?EU:?C:?2013:?247], Rn. 39[↩]
- BVerwG, Urteile vom 04.11.2015 – 4 CN 9.14, BVerwGE 153, 174 Rn. 24; und vom 25.06.2020 – 4 CN 5.18 30[↩]
- BVerwG, Urteile vom 12.09.1980 – 4 C 75.77, Buchholz 406.11 § 34 BBauG Nr. 75 S. 79 f.; und vom 14.09.1992 – 4 C 15.90, Buchholz 406.11 § 34 BauGB Nr. 152 S. 68 f.[↩]