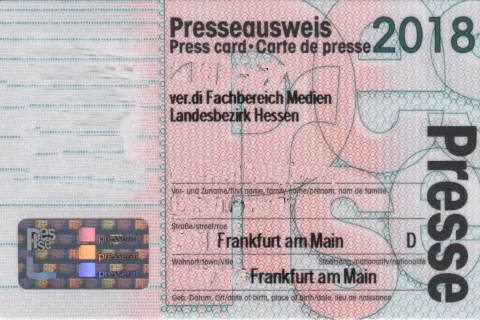Mit der Frage, welches Organ der Hochschule für die Entziehung des Doktorgrades zuständig ist, wenn dies in der Promotionsordnung nicht ausdrücklich geregelt ist, hatte sich das Verwaltungsgericht Karlsruhe zu befassen:

Die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Entziehung des Doktorgrades liegt nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Karlsruhe nicht beim Rektorat der Hochschule, sondern vielmehr beim Prüfungsausschuss. Dieser ist zur Entscheidung über die Entziehung des Doktorgrades berufen.
Im vorliegenden Fall finden das Landeshochschulgesetz in der Fassung vom 01.01.2005, zuletzt geändert durch Art. 2 des Verfasste-Studierenden-Gesetzes vom 10.07.2012, GBl. S. 457 (im Folgenden: LHG a.F.), sowie die Promotionsordnung der Universität vom 28.06.2007, Amtliche Bekanntmachung vom 29.06.2007, Nr. 25/2007, in der am 01.06.2012 in Kraft getretenen Fassung der Fünften Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der
vom 20.06.2012, Amtliche Bekanntmachung vom 21.06.2012 Nr. 60/2012 (im Folgenden: PromO) Anwendung. Dies folgt daraus, dass sich die Rechtmäßigkeit der Entziehung eines Doktorgrades – und damit auch die Zuständigkeit des zur Entscheidung berufenen Gremiums – mangels anderweitiger Bestimmungen im Hochschulrecht als dem einschlägigen Fachrecht nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids richtet1.
Danach liegt die Zuständigkeit für die Entziehung des Doktorgrades bei der Hochschule, die den Grad verliehen hat. Dies gilt über den in § 35 Abs. 7 Satz 2 LHG a.F. (neu: § 36 Abs. 7 Satz 2 LHG) geregelten Fall der Entziehung des Doktorgrades wegen unwürdigen Verhaltens hinaus für alle Fälle der Entziehung des Doktorgrades2. Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 LHG a.F. handeln in Angelegenheiten, die Hochschulprüfungen betreffen, für die Hochschule die nach den Prüfungsordnungen zuständigen Stellen. Diese Zuständigkeit für Hochschulprüfungen erfasst auch Promotionen und damit die Verleihung wie auch – als „actus contrarius“ – die Entziehung des Doktorgrades. Auch bei der Rücknahme eines verliehenen Doktorgrades handelt es sich somit um eine Hochschulprüfungen betreffende Angelegenheit3.
Die Promotionsordnung der Universität als die hier einschlägige Prüfungsordnung regelt in § 14 Abs. 3 PromO, dass der Doktorgrad nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entzogen werden kann. Da diese Regelung keine ausdrückliche Zuständigkeitsbestimmung enthält, ist das für die Entziehung des Doktorgrades zuständige Organ im Wege der Auslegung ermitteln.
Die systematische Auslegung, die die sonstigen Regelungen der Promotionsordnung in den Blick nimmt, spricht dafür, dass der Prüfungsausschuss nach § 3a PromO für die Entziehung des Doktorgrades zuständig ist. Nach § 14 Abs. 1 PromO kann der Prüfungsausschuss die Promotionsleistungen für ungültig erklären, wenn sich vor Aushändigung der Promotionsurkunde ergibt, dass der Bewerber oder die Bewerberin sich bei den Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht oder die Zulassung zum Promotionsverfahren durch Täuschung erlangt hat. Es erscheint sachgerecht, dass die Zuständigkeit für die Entscheidung über Sanktionen wegen eines Verstoßes gegen die Promotionsordnung beim Prüfungsausschuss liegt – unabhängig davon, ob die Urkunde bereits übergeben ist oder nicht, da in der Sache im Wesentlichen dieselben Sachverhalte, insbesondere die Schwere des Verstoßes, zu beurteilen sind.
Jedenfalls folgt die Zuständigkeit des Prüfungsausschusses für die Entziehung des Doktorgrades aus dem Umstand, dass es sich bei der Entziehung des Doktorgrades um den actus contrarius zur Verleihung handelt und der Prüfungsausschuss nach den im vorliegenden Fall anwendbaren Regelungen die eigentliche Sachentscheidung über die Verleihung des Doktorgrades trifft. Die Zuständigkeit des Prüfungsausschusses für die Verleihung des Doktorgrades folgt zum einen aus § 3 PromO, wonach der Prüfungsausschuss für den organisatorischen Ablauf des Promotionsverfahrens zuständig ist, soweit keine anderen Zuständigkeiten festgelegt sind. Diese Zuständigkeit für die Organisation des Verfahrens wird in § 3a Abs. 1 PromO dahingehend erweitert, dass „für die Durchführung des Promotionsverfahrens und die Erfüllung der sonstigen durch diese Promotionsordnung zugewiesenen Aufgaben“ ein Prüfungsausschuss zu bilden ist. Daraus lässt sich ersehen, dass dem Prüfungsausschuss die tragende Rolle bei der Durchführung des Promotionsverfahrens zukommt. Insbesondere entscheidet er auch gemäß § 8 Abs. 6 Satz 4 PromO auf der Grundlage der Gutachten und auf der Grundlage vorliegender Stellungnahmen über die Annahme oder die Ablehnung der Dissertation und legt bei Annahme eine Bewertung der Dissertation gemäß § 10 Abs. 1 PromO fest. Nachdem die Dissertation angenommen und die mündliche Prüfung absolviert worden ist, beschränkt sich die Entscheidung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auf die bloße Feststellung, dass alle Promotionsleistungen außer der Veröffentlichung der Doktorarbeit erbracht sind, § 11 Abs. 3 PromO. Auch der Professorenversammlung kommen – anders als dem Prüfungsausschuss – nur singuläre Entscheidungsbefugnisse im Rahmen des Promotionsverfahrens zu, die in der Promotionsordnung aufgezählt sind. So entscheidet sie etwa gemäß § 5 Abs. 3 PromO über die Annahme als Doktorand und weist die beiden betreuenden Professoren zu.
In der Ausfertigung der Promotionsurkunde mit den Unterschriften des Rektors und des Dekans der zuständigen Fakultät liegt dagegen keine inhaltliche Sachentscheidung über die Verleihung des Doktorgrades, sondern damit wird lediglich der durch das erfolgreiche Absolvieren des Promotionsverfahren erworbene Anspruch auf Verleihung des Doktorgrades vollzogen. Insbesondere können weder der Dekan noch der Rektor die Verleihung des Doktorgrades aus eigenem Recht verhindern, sofern der Bewerber die Anforderungen der Promotionsordnung erfüllt, sprich der Prüfungsausschuss die Dissertation angenommen hat, die mündliche Prüfung bestanden und die Veröffentlichung der Arbeit erfolgt ist. Der Umstand, dass ein Mitglied des Rektorats, welches zugleich Mitglied der für die betreffende Promotion zuständigen Fakultät ist und als solches beispielsweise eine gutachterliche Stellungnahme im Rahmen der Auslegung der Dissertation gemäß § 8 Abs. 5 Satz 4 PromO abgeben kann, ändert nichts daran, dass das Rektorat oder einzelne Rektoratsmitglieder keine Sachentscheidung im Rahmen des Promotionsverfahrens treffen.
Diese Zuständigkeitsverteilung entspricht auch der gesetzgeberischen Funktionsverteilung zwischen den Fakultäten auf der einen und dem Rektorat als dem Zentralorgan der Hochschule auf der anderen Seite.
Gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 LHG a.F. ist das Rektorat für alle Angelegenheiten zuständig, für die in diesem Gesetz oder in der Grundordnung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Nach § 22 Abs. 1 LHG a.F. ist die Fakultät die organisatorische Grundeinheit der Hochschule; sie erfüllt unbeschadet der Gesamtverantwortung und der Zuständigkeiten der Hochschulorgane in ihrem Bereich die Aufgaben der Hochschule. Die Verleihung eines Doktorgrades ist eine klassische Aufgabe der Fakultäten, da die innerhalb eines Fachbereichs erbrachten wissenschaftlichen Leistungen mit dem Doktortitel ausgezeichnet werden. Im Bereich des Promotionswesens handelt es sich bei den Fakultäten somit keineswegs um „nachgeordnete Behörden“ der zentralen Universitätsverwaltung, sondern um die originär zuständigen Rechtsträger. Dass dies beispielsweise bei der Ernennung von Professoren gemäß § 48 Abs. 3 Satz 1 LHG a.F. (neu: § 48 Abs. 2 Satz 1 LHG) oder bei der Entscheidung über die Verteilung der für die Hochschule verfügbaren Stellen und Mittel gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 LHG a.F. (neu: § 16 Abs. 3 Satz 2 Nr. 7 LHG) nach den gesetzlichen Regelungen anders ist, hat keine Bedeutung für die vorliegend in Rede stehende Frage des Promotionsrechts. Aus diesem Grund ist im Übrigen auch eine eindeutige Zuordnung des Promotionsvorhabens zu einer Fakultät geboten, was durch das Erfordernis der Antragstellung zur Annahme als Doktorand bei einer Fakultät gemäß § 5 Abs. 1 PromO und durch den entsprechenden Annahmebeschluss des Professorenkollegiums dieser Fakultät sichergestellt wird.
Inwieweit eine Übertragung der Aufgaben der Fakultäten auf die zentralen Organe der Hochschule durch die Grundordnung möglich wäre4, bedarf hier keiner weiteren Klärung, da die Grundordnung der Universität hiervon keinen Gebrauch gemacht hat. Insbesondere handelt es sich bei dem Prüfungsausschuss, der sich nach § 3a Abs. 2 PromO aus den Dekanen der
Fakultäten sowie je einem weiteren Professor aus jeder Fakultät sowie dem Leiter des Akademischen Prüfungsamts zusammensetzt, nicht um ein zentrales Organ der Universität. Ein derart zusammengesetztes Gremium konnte vielmehr zulässigerweise auf der Grundlage des § 15 Abs. 6 LHG a.F. als gemeinsame Kommission der Fakultäten gebildet werden und damit stellvertretend für diese handeln. Nach § 15 Abs. 6 Satz 1 LHG a.F. können für Aufgaben, die eine Zusammenarbeit mehrerer Fakultäten einer Hochschule oder mehrerer Studienakademien erfordern, gemeinsame Einrichtungen und gemeinsame Kommissionen gebildet und zugleich deren Bezeichnung festgelegt werden. Einer solchen gemeinsamen Kommission können nach § 15 Abs. 6 Satz 2 LHG a.F. unter anderem Entscheidungsbefugnisse über Habilitations, Promotions- und andere Prüfungsangelegenheiten eingeräumt werden, wobei die Vorgaben des § 10 Abs. 3 LHG hinsichtlich der Stimmengewichtungen einzuhalten sind. Von dieser Möglichkeit der Einräumung von Entscheidungsbefugnissen haben die Fakultäten der Universität mit der Übertragung der Zuständigkeit für das Promotionsverfahren auf den Prüfungsausschuss gemäß § 3a PromO in rechtlich nicht zu beanstandender Weise Gebrauch gemacht.
Ebenfalls nur mit der Zuständigkeit der Fakultäten bzw. der für ihre Aufgabenerfüllung geschaffenen gemeinsamen Kommissionen – hier des Prüfungsausschusses – für die Fragen der Promotion und des sonstigen Prüfungswesens, ist zu erklären, dass das Landeshochschulgesetz in § 8 Abs. 2 Satz 3 LHG a.F. anordnet, dass das für die Lehre zuständige Mitglied des Rektorats über Widersprüche in Angelegenheiten, die Hochschulprüfungen betreffen, entscheidet. Diese dem für die Lehre zuständigen Mitglied des Rektorats zugewiesenen Befugnisse einer Widerspruchsbehörde, stellen sicher, dass die einzelnen Fakultäten der Universität in prüfungsrechtlichen Fragen einheitliche rechtliche Maßstäbe anlegen. Allerdings ist nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg bei der Entscheidung über den Widerspruch auf den besonderen Beurteilungsspielraum des Prüfungsgremiums, hier des Prüfungsausschusses, Rücksicht zu nehmen5.
Diese Einschränkung der Widerspruchsbefugnis setzt voraus, dass nicht das Rektorat als zentrales Organ der Hochschule, sondern vielmehr das zuständige Prüfungsgremium die Ausgangsentscheidung getroffen hat, wobei dieses im Falle der Entziehung eines Doktorgrades neben der Beurteilung des Umfangs oder des Gewichts des Plagiats und des Ausmaßes der damit verbundenen Schädigung der öffentlichen Interessen im Rahmen des Ermessens auch über die Bedeutung der persönlichen Belange des Betroffenen zu entscheiden hat. Nur wenn das Prüfungsgremium eine abschließende Entscheidung einschließlich der erforderlichen Ermessensausübung getroffen hat und der Betroffene dagegen einen Widerspruch einlegt, wird die Widerspruchsbefugnis des Prorektors für Lehre begründet. Entgegen der Rechtsauffassung der Universität findet eine Aufspaltung der Entscheidungskompetenzen zwischen dem Prüfungsgremium, das über das Gewicht des Verstoßes entscheidet, und dem zentralen Organ, das die Ermessensentscheidung trifft, auf der Ebene des Ausgangsbescheides nicht statt. Dementsprechend würde sich bei richtiger Rechtsanwendung das von der Klägerin zu Recht aufgeworfene Problem, dass ein Mitglied des Rektorats zur Entscheidung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 LHG über den Widerspruch gegen den Bescheid des gesamten Gremiums berufen wäre, nicht stellen.
Der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses steht auch nicht entgegen, dass nach § 1 Satz 1 PromO die Universität den Doktorgrad verleiht. Damit wird lediglich das in § 38 Abs. 1 Satz 2 LHG a.F. geregelte Promotionsrecht der Hochschulen im Rahmen ihrer Aufgabenstellung ausgefüllt. Ebenso wie die sonstigen akademischen Titel erwirbt der Doktorand den Titel an der Universität, in der Sache wird die Prüfung und die Durchführung des Verfahrens jedoch, wie bereits ausgeführt, von den Fakultäten bzw. den von ihnen gebildeten Kommissionen erfüllt. Dementsprechend legt auch nicht etwa die Hochschule, sondern vielmehr die zuständige Fakultät jeweils bei der Annahme als Doktorand fest, welcher Doktorgrad verliehen wird, § 1 Satz 2 PromO.
Nichts anderes folgt aus dem Umstand, dass es sich vorliegend nicht um eine Promotionsordnung der Fakultät, sondern um eine solche der gesamten Hochschule handelt. Ebenso wie es im Organisationsermessen der Hochschule liegt, gemeinsame Gremien bzw. Kommissionen der Fakultäten gemäß § 16 Abs. 5 LHG a.F. zu schaffen, können die Fakultäten ihr Prüfungswesen auch nach einer gemeinsamen Promotionsordnung oder nach sonstigen gemeinsamen Prüfungsordnungen ausrichten, denn diesbezügliche Vorgaben lassen sich § 38 Abs. 4 LHG a.F., der die Satzungsermächtigung für die Promotionsordnungen der Hochschulen enthält, nicht entnehmen. Dies begründet jedoch nicht die Zuständigkeit des Rektorats entgegen der gesetzlichen Aufgabenverteilung. Eine solche könnte – wenn überhaupt – nur durch die Grundordnung der Universität erfolgen, was hier jedoch, wie bereits ausgeführt, nicht geschehen ist.
Schließlich begründet auch der Umstand, dass ein Prüfungsausschuss gemäß § 3a PromO nach den Angaben der Universität zum Zeitpunkt des Erlasses des Entziehungsbescheids nicht eingesetzt war, sondern dessen Aufgaben regelmäßig durch die Professorenversammlung der jeweiligen Fakultät wahrgenommen wurden, nicht die Zuständigkeit des Rektorats. Ungeachtet des Umstandes, dass die Universität jedenfalls für den Erlass belastender Verfügungen, um die es sich bei der Entziehung des Doktorgrades handelt, gegebenenfalls einen Prüfungsausschuss hätte einrichten müssen und dies nach den Vorgaben des § 3a PromO auch möglich gewesen wäre, führt eine ständige Praxis der Universität, die nicht im Einklang mit den Satzungsregelungen steht, nicht zu einer Zuständigkeitsbegründung. Dass im Normalfall der reibungslosen Durchführung eines Promotionsverfahren, das mit der Verleihung der Doktorwürde und damit einem begünstigenden Verwaltungsakt endet, das Fehlen des zuständigen Prüfungsausschusses nicht relevant wird, hat keine Bedeutung für die rechtlich maßgebenden Regelungen im vorliegenden Fall.
Der formelle Fehler ist auch nicht nach § 46 LVwVfG unbeachtlich. Nach § 46 LVwVfG kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 44 LVwVfG nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Zwar liegt hier entgegen der Auffassung der Klägerin kein Fall der Nichtigkeit des Verwaltungsaktes nach § 44 LVwVfG vor, da weder einer der Nichtigkeitsgründe des § 44 Abs. 2 LVwVfG gegeben ist, noch der Fehler, an dem der Verwaltungsakt leidet, bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offenkundig im Sinne des § 44 Abs. 1 LVwVfG ist. Soweit das Rektorat über die Entziehung des Doktorgrades entschieden hat, liegt jedoch kein bloßer Verfahrensfehler, sondern ein Verstoß gegen die sachliche Zuständigkeit vor. Ein solcher wird von der Unbeachtlichkeitsregelung des § 46 LVwVfG von vornherein nicht erfasst6. Darüber hinaus handelt es sich bei der Entscheidung über die Entziehung des Doktorgrades nach § 48 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG um eine Ermessensentscheidung, bei der angesichts des Umstandes, dass ein anderes Gremium gegebenenfalls andere Ermessenserwägungen anstellen kann, es nicht offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat7.
Verwaltungsgericht Karlsruhe, Urteil vom 21. Januar 2015 – 7 K 761/11
- VG Düsseldorf, Urteil vom 20.03.2014 – 15 K 2271/13 39; Urteil des Verwaltungsgerichts vom 04.03.2013 – 7 K 3335/11 28; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 19.04.2000 – 9 S 2435/99, KMK-HschR/NF 21A Nr.19[↩]
- VG Karlsruhe, Urteil vom 04.03.2013 – 7 K 3335/11 26; ebenso unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts: VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 19.04.2000 – 9 S 2435/99, KMK-HschR/NF 21A Nr.19[↩]
- zuletzt VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 03.02.2014 – 9 S 885/13 8 m.w.N.; Urteil des Verwaltungsgerichts vom 04.03.2013 – 7 K 3335/11 63[↩]
- vgl. zur Regelung des § 26 Abs. 5 Satz 1 HG NRW OVG NRW, Urteile vom 22.01.2013 – 6 A 839/11; und vom 27.02.2014 – 6 A 274/12[↩]
- VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 19.04.2000 – 9 S 2435/99 34 m.w.N.[↩]
- VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 18.12.2012 – 10 S 2058/11, ESVGH 63, 154; Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 14. Aufl., § 46 Rdnr. 14[↩]
- BVerwG, Urteil vom 07.10.1980 – 6 C 39.80, BVerwGE 61, 45; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 14. Aufl., § 46 Rdnr. 32 m.w.N.[↩]