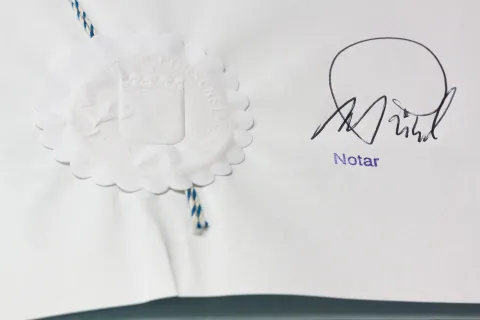Bei der Beurteilung der Frage, ob gegen die Schuldnerin eine deren Insolvenzreife mit begründende Forderung bestanden hat, erstreckt sich die Rechtskraftwirkung einer späteren Feststellung dieser Forderung zur Insolvenztabelle nach § 178 Abs. 3 InsO nicht auf den Geschäftsführer der Schuldnerin; dessen Verhalten im Anmeldeverfahren kann aber eine im Rahmen der Tatsachenfeststellung (§ 286 Abs. 1 ZPO) zu berücksichtigende Indizwirkung haben.

Im Ausgangspunkt ist zur Darlegung der Zahlungsunfähigkeit die Aufstellung einer Liquiditätsbilanz entbehrlich, wenn eine Zahlungseinstellung (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO) die gesetzliche Vermutung der Zahlungsunfähigkeit begründet1. Zahlungseinstellung ist dasjenige nach außen hervortretende Verhalten des Schuldners, in dem sich typischerweise ausdrückt, dass er nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Die tatsächliche Nichtzahlung eines erheblichen Teils der fälligen Verbindlichkeiten reicht für eine Zahlungseinstellung aus, auch wenn noch geleistete Zahlungen beträchtlich sind, aber im Verhältnis zu den fälligen Gesamtschulden nicht den wesentlichen Teil ausmachen. Sogar die Nichtzahlung einer einzigen Verbindlichkeit kann eine Zahlungseinstellung begründen, wenn die Forderung von insgesamt nicht unbeträchtlicher Höhe ist. Haben im fraglichen Zeitpunkt fällige Verbindlichkeiten erheblichen Umfangs bestanden, die bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht beglichen worden sind, ist regelmäßig von einer Zahlungseinstellung auszugehen2.
Bei der Würdigung des Vorbringens des Geschäftsführers, eine Forderung noch nicht fällig gewesen und eine zweite bereits durch Verrechnung erloschen, kann der unterbliebene Widerspruch der Schuldnerin nach Anmeldung der Forderung zur Insolvenztabelle zwar im Ergebnis berücksichtigt werden. Denn wenngleich sich die nach § 178 Abs. 3 InsO bestehende Rechtskraftwirkung der Feststellung zur Insolvenztabelle nicht auf Dritte wie den Geschäftsführer der Schuldnerin erstreckt3, kann das Verhalten des Geschäftsführers im Anmeldeverfahren doch eine indizielle Bedeutung haben. Diese (mögliche) Indizwirkung ist jedoch erst im Rahmen der Tatsachenfeststellung (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) nach Durchführung einer gebotenen Beweiserhebung zu würdigen.
Ein unbeachtlicher Vortrag „ins Blaue hinein“, wie ihn das Oberlandesgericht München4 hier in Betracht zieht, kann anzunehmen sein, wenn eine Partei, gestützt auf bloße Vermutungen, ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich Behauptungen aufstellt5. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Der Geschäftsführer hat aufgrund eigener (behaupteter) Kenntnis konkreten Vortrag gehalten. In der auf entgegenstehende Indizien gestützten Bewertung dieses Vortrags als unerheblich ohne Erhebung der angebotenen Beweise läge eine unzulässige vorweggenommene Beweiswürdigung.
Im Übrigen kann die Annahme einer Zahlungseinstellung auf die unterbliebene Begleichung bestehender Verbindlichkeiten erheblichen Umfangs nicht gestützt werden, wenn der Schuldner die Zahlungen verweigert hat, weil er die Forderungen für unbegründet hielt6.
Hinsichtlich der zweiten Forderung hat der Geschäftsführer vorliegend eingewandt, dass die Forderungen nicht gemäß § 17 Abs. 2 InsO fällig gewesen seien, und er hat hierzu behauptet, die Schuldnerin (GmbH) habe (u.a.) mit der Gläubigerin Absprachen getroffen, nach denen die Schuldnerin deren Forderungen erst dann habe bezahlen müssen, wenn sie ihrerseits Geld von ihren Kunden erhalten habe. Für diese Behauptung hat der Geschäftsführer Zeugenbeweis u.a. durch Benennung der für den jeweiligen Vertragspartner handelnden Personen angetreten.
Diesen Beweisangeboten hätte das Gericht nachgehen müssen. Soweit das Oberlandesgericht München7 dem Geschäftsführer entgegengehalten hat, er habe keine konkreten Stundungsabreden vorzutragen vermocht, hat es entweder das Vorbringen des Geschäftsführers nicht vollständig zur Kenntnis genommen oder überzogene Substantiierungsanforderungen gestellt. Nach ständiger Rechtsprechung ist der Vortrag einer Partei bereits dann hinreichend substantiiert, wenn sie Tatsachen anführt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen. Der Pflicht zur Substantiierung ist nur dann nicht genügt, wenn das Gericht aufgrund der Darstellung nicht beurteilen kann, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der an eine Behauptung geknüpften Rechtsfolgen erfüllt sind8. Danach genügte hier die Darlegung der Vereinbarungen und ihres Inhalts; weitere Einzelheiten zum Abschluss der Vereinbarungen musste der Geschäftsführer nicht vortragen.
Das Oberlandesgericht München hat den Vortrag des Geschäftsführers zu den mit den Lieferanten getroffenen Absprachen übergangen, indem es seinem Vorbringen nur entnommen hat, dass die Gläubiger mit der gerichtlichen Geltendmachung ihrer Ansprüche in der Regel zugewartet hätten, bis die Schuldnerin Einnahmen erzielte. Der Geschäftsführer hat zwar auch auf das tatsächliche Verhalten der Lieferanten in der Vergangenheit verwiesen, die über längere Zeit offenstehende Forderungen nicht zum Anlass für Mahnungen oder Liefereinschränkungen genommen hätten. Wenn das Berufungsgericht daraus kein überzeugendes Indiz für die vom Geschäftsführer behaupteten Fälligkeitsabsprachen entnehmen wollte, so war es damit aber nicht der Verpflichtung enthoben, die für die Absprachen unmittelbar angebotenen Beweise zu erheben.
Erwiese sich der Vortrag des Geschäftsführers als zutreffend, könnte die Annahme einer Zahlungseinstellung ab dem 12.01.2009 nicht auf die unterbliebene Bezahlung dieser Forderungen gestützt werden, da diese Forderungen dann noch nicht fällig (§ 17 Abs. 2 InsO) gewesen wären9. Es handelte sich hier auch nicht um eine „erzwungene Stundung“10, sondern um eine unabhängig von konkreten Liquiditätsproblemen für die Auftragsabwicklung allgemein getroffene Fälligkeitsvereinbarung.
Wenn auf der Grundlage der noch zu treffenden Feststellungen anzunehmen ist, dass die Schuldnerin im fraglichen Zeitpunkt fällige Verbindlichkeiten erheblichen Umfangs hatte, die bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht beglichen worden sind, wird sich das Berufungsgericht vor Feststellung der Insolvenzreife gegebenenfalls noch mit dem Vorbringen des Geschäftsführers zu einer damals in Aussicht stehenden Verbesserung der Liquiditätslage zu befassen haben. Dieses Vorbringen erweist sich nicht jedenfalls nicht in vollem Umfang für den hier insgesamt betroffenen Zeitraum – schon deshalb ohne weiteres als unerheblich, weil sich entsprechende Erwartungen später „als Trugschluss erwiesen“ haben. Zwar führt die bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens fortdauernde Nichtbegleichung erheblicher Verbindlichkeiten regelmäßig zur Annahme der Zahlungseinstellung und daraus folgend der Zahlungsunfähigkeit. Etwas anderes gilt aber dann, wenn zum fraglichen Zeitpunkt aufgrund konkreter Umstände, die sich nachträglich geändert haben, angenommen werden konnte, der Schuldner werde rechtzeitig in der Lage sein, die Verbindlichkeiten zu erfüllen11.
Ist von einer Zahlungseinstellung auszugehen, bleibt dem Geschäftsführer die Möglichkeit, die nach § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO bestehende Vermutung der Zahlungsunfähigkeit zu widerlegen, indem er konkret vorträgt und gegebenenfalls beweist, dass eine Liquiditätsbilanz im maßgebenden Zeitraum für die Schuldnerin eine Deckungslücke von weniger als 10 % ausweist12. Die bloße, unter Sachverständigenbeweis gestellte Behauptung genügt insoweit allerdings nicht, wie das Berufungsgericht zutreffend sieht. Der Geschäftsführer, der mit den finanziellen Verhältnissen der insolvent gewordenen GmbH aufgrund seiner Tätigkeit vertraut ist, ist vielmehr gehalten, zu einer Liquiditätsbilanz, die Zahlungsfähigkeit belegen soll, konkret vorzutragen.
In eine etwaige Liquiditätsbilanz sind auf der Aktivseite neben den verfügbaren Zahlungsmitteln auch die innerhalb von drei Wochen flüssig zu machenden Mittel einzubeziehen13, wobei auch kurzfristig verfügbare Kreditmittel zu berücksichtigen sind14. Auch mit Hilfe einer Zahlungszusage der Gesellschafter, die sich gegenüber ihrer GmbH verpflichten, die zur Erfüllung der jeweils fälligen Verbindlichkeiten benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen, kann die Zahlungsunfähigkeit der GmbH vermieden werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der GmbH ein ungehinderter Zugriff auf die Mittel eröffnet wird oder die Gesellschafter ihrer Ausstattungsverpflichtung tatsächlich nachkommen15. Ergibt die Liquiditätsbilanz eine innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Unterdeckung von 10 % oder mehr, ist regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit des Schuldners auszugehen. Das gilt nur dann nicht, wenn ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Liquiditätslücke zwar erst mehr als drei Wochen später, aber in absehbarer Zeit vollständig oder fast vollständig beseitigt werden wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist16.
War die Schuldnerin im fraglichen Zeitraum zahlungsunfähig und damit insolvenzreif, haftet der Geschäftsführer für die von ihm veranlassten Zahlungen, sofern er die gegen ihn streitende Vermutung, er habe schuldhaft gehandelt, nicht widerlegt.
Von dem Geschäftsführer einer GmbH wird erwartet, dass er sich über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft stets vergewissert. Hierzu gehört insbesondere die Prüfung der Insolvenzreife. Wenn der Geschäftsführer erkennt, dass die GmbH zu einem bestimmten Stichtag nicht in der Lage ist, ihre fälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten vollständig zu bedienen, hat er die Zahlungsfähigkeit der GmbH anhand einer Liquiditätsbilanz zu überprüfen. Erweisen sich hierbei angestellte Prognosen trotz Aufwendung der gebotenen Sorgfalt nach Ablauf des maßgebenden Zeitraums von drei Wochen als unzutreffend mit dem Ergebnis, dass statt einer angenommenen Zahlungsstockung bereits Zahlungsunfähigkeit besteht, können zwischenzeitlich in der vertretbaren Annahme fortbestehender Zahlungsfähigkeit geleistete Zahlungen unverschuldet sein17.
Der Geschäftsführer handelt fahrlässig, wenn er sich nicht rechtzeitig die erforderlichen Informationen und die Kenntnisse verschafft, die er für die Prüfung benötigt, ob er pflichtgemäß Insolvenzantrag stellen muss. Dabei muss er sich, sofern er nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse verfügt, gegebenenfalls fachkundig beraten lassen18. Der selbst nicht hinreichend sachkundige Geschäftsführer ist nur dann entschuldigt, wenn er sich unter umfassender Darstellung der Verhältnisse der Gesellschaft und Offenlegung der erforderlichen Unterlagen von einer unabhängigen, für die zu klärenden Fragestellungen fachlich qualifizierten Person hat beraten lassen und danach keine Insolvenzreife festzustellen war. Die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters gebietet es zudem, das Prüfergebnis einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen19.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 26. Januar 2016 – II ZR 394/13
- BGH, Beschluss vom 26.02.2013 – II ZR 54/12, GmbHR 2013, 482 Rn. 6; Urteil vom 12.02.2015 – IX ZR 180/12, ZIP 2015 Rn. 18, jew. mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 19.11.2013 – II ZR 229/11, ZIP 2014, 168 Rn. 21; Urteil vom 20.11.2001 – IX ZR 48/01, BGHZ 149, 178, 185; Urteil vom 30.06.2011 – IX ZR 134/10, ZIP 2011, 1416 Rn. 12; Urteil vom 18.07.2013 – IX ZR 143/12, ZIP 2013, 2015 Rn. 9[↩]
- vgl. MünchKomm-InsO/Schumacher, 3. Aufl., § 178 Rn. 72[↩]
- OLG München, GmbHR 2014, 139[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 04.03.1991 – II ZR 90/90, WM 1991, 942, 946 f.; Urteil vom 29.07.2014 – II ZR 353/12, BGHZ 202, 180 Rn. 60; Urteil vom 09.12 2015 – IV ZR 272/15, VersR 2016, 177 Rn. 24; Urteil vom 22.12 2015 – VI ZR 101/14 41; Urteil vom 22.01.2016 – V ZR 27/14 48[↩]
- BGH, Urteil vom 17.05.2001 – IX ZR 188/98, ZIP 2001, 1155, 1156; Urteil vom 11.02.2010 – IX ZR 104/07, ZIP 2010, 682 Rn. 42[↩]
- OLG München, a.a.O.[↩]
- BGH, Beschluss vom 10.07.2012 – II ZR 212/10, ZIP 2012, 1857 Rn. 4 mwN[↩]
- vgl. nur BGH, Urteil vom 20.12 2007 – IX ZR 93/06, ZIP 2008, 420 Rn. 25 mwN[↩]
- vgl. dazu BGH, Urteil vom 14.02.2008 – IX ZR 38/04, ZIP 2008, 706 Rn.20 ff.; Urteil vom 08.01.2015 – IX ZR 203/12, ZIP 2015, 437 Rn.20[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 12.10.2006 – IX ZR 228/03, ZIP 2006, 2222 Rn. 28; MünchKomm-InsO/Eilenberger, 3. Aufl., § 17 Rn. 27b[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 26.02.2013 – II ZR 54/12, GmbHR 2013, 482 Rn. 12 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 24.05.2005 – IX ZR 123/04, BGHZ 163, 134, 138; Urteil vom 12.02.2015 – IX ZR 180/12, ZIP 2015, 585 Rn. 18[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 20.01.2011 – IX ZR 32/10 4; Haas in Baumbach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl., § 64 Rn. 38[↩]
- BGH, Urteil vom 19.05.2011 – IX ZR 9/10, ZIP 2011, 1111 Rn. 21; Beschluss vom 19.09.2013 – IX ZR 232/12, WM 2013, 1995 Rn. 7[↩]
- BGH, Urteil vom 24.05.2005 – IX ZR 123/04, BGHZ 163, 134, 145 f.; Urteil vom 12.10.2006 – IX ZR 228/03, ZIP 2006, 2222 Rn. 27; Urteil vom 27.03.2012 – II ZR 171/10, ZIP 2012, 1174 Rn. 10; Urteil vom 09.10.2012 – II ZR 298/11, BGHZ 195, 42 Rn. 8 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 24.05.2005 – IX ZR 123/04, BGHZ 163, 134, 141[↩]
- BGH, Urteil vom 27.03.2012 – II ZR 171/10, ZIP 2012, 1174 Rn. 15; Urteil vom 19.06.2012 – II ZR 243/11, ZIP 2012, 1557 Rn. 11 ff., jew. mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 27.03.2012 – II ZR 171/10, ZIP 2012, 1174 Rn. 16 ff. mwN[↩]