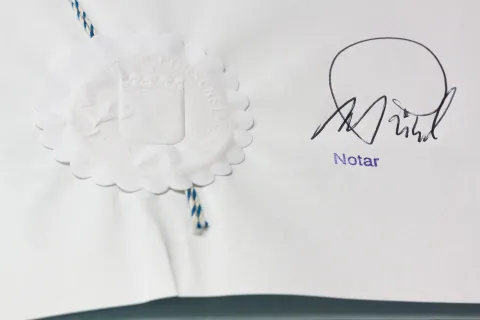Bei Franchiseverträgen, die ein im Wesentlichen anonymes Massengeschäft betreffen, rechtfertigt eine bloß faktische Kontinuität des Kundenstamms nach Vertragsbeendigung eine entsprechende Anwendung der auf Handelsvertreter zugeschnittenen Bestimmung des § 89b HGB nicht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Vorschriften des Handelsvertreterrechts auf einen Franchisevertrag entsprechend anwendbar, wenn der hinter einer Einzelbestimmung stehende Grundgedanke wegen der Gleichheit der Interessenlage auch auf das Verhältnis zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer zutrifft1.
Grundsätzlich kann § 89b HGB auf andere im Vertrieb tätige Personen entsprechend anwendbar sein2. Dies gilt insbesondere für Vertragshändler. Die auf Handelsvertreter zugeschnittene Bestimmung des § 89b HGB ist auf Vertragshändler entsprechend anzuwenden, wenn sich das Rechtsverhältnis zwischen dem Vertragshändler und dem Hersteller oder Lieferanten nicht in einer bloßen Käufer-Verkäufer-Beziehung erschöpft, sondern der Vertragshändler in der Weise in die Absatzorganisation des Herstellers oder Lieferanten eingegliedert war, dass er wirtschaftlich in erheblichem Umfang dem Handelsvertreter vergleichbare Aufgaben zu erfüllen hatte, und der Vertragshändler außerdem verpflichtet ist, dem Hersteller oder Lieferanten seinen Kundenstamm zu übertragen, so dass sich dieser bei Vertragsende die Vorteile des Kundenstamms sofort und ohne weiteres nutzbar machen kann3. Dabei muss sich die Verpflichtung des Vertragshändlers zur Übertragung des Kundenstamms nicht ausdrücklich und unmittelbar aus dem schriftlichen Händlervertrag ergeben; sie kann sich auch aus anderen, dem Vertragshändler auferlegten Pflichten ergeben4. Bei anderen im Vertrieb tätigen Personen gilt grundsätzlich Entsprechendes5.
Eine bloß faktische Kontinuität des Kundenstamms rechtfertigt, wie der Bundesgerichtshof in Auseinandersetzung mit einer im Schrifttum6 verbreiteten Ansicht entschieden hat, eine entsprechende Anwendung des § 89b HGB im Vertragshändlerverhältnis nicht7.
Der Bundesgerichtshof8 hat bisher allerdings offengelassen, ob § 89b HGB überhaupt im Franchiseverhältnis ebenso wie im Vertragshändlerverhältnis analog anwendbar ist. Er hat dort des Weiteren offengelassen, ob beim Franchising anders als im Vertragshändlerverhältnis anstelle einer rechtlichen Verpflichtung zur Übertragung des Kundenstamms das tatsächliche Verbleiben des vom Franchisenehmer geworbenen Kundenstamms beim Franchisegeber9 die entsprechende Anwendung des § 89b HGB rechtfertigen könnte.
Auch im Streitfall braucht nicht entschieden werden, ob § 89b HGB überhaupt im Franchiseverhältnis ebenso wie im Vertragshändlerverhältnis analog anwendbar ist, da die erforderlichen Analogievoraussetzungen nicht erfüllt sind. Bei Franchiseverträgen, die ein im Wesentlichen anonymes Massengeschäft wie im Streitfall betreffen, rechtfertigt eine bloß faktische Kontinuität des Kundenstamms eine entsprechende Anwendung der auf Handelsvertreter zugeschnittenen Bestimmung des § 89b HGB nicht. Insoweit besteht keine hinreichende Ähnlichkeit der Interessenlage.
Der Franchisenehmer, der im eigenen Namen und für eigene Rechnung handelt, besorgt – anders als der Handelsvertreter – mit der Werbung eines Kundenstamms primär ein eigenes, kein fremdes Geschäft10. Daran ändert nichts, dass Franchisenehmer im Außenverhältnis gegenüber den Kunden meist nicht unter eigenem Kennzeichen, sondern unter dem des Franchisesystems in Erscheinung treten11. Ein vom Franchisenehmer geworbener, im Wesentlichen anonymer Kundenstamm ist nach Vertragsbeendigung nicht ohne weiteres für den Franchisegeber nutzbar. Die tatsächliche Möglichkeit für den Franchisegeber, einen solchen Kundenstamm nach Vertragsende zu nutzen, ist insbesondere dann eingeschränkt, wenn der Franchisenehmer am selben Standort12 – beispielsweise unter eigenem Kennzeichen – weiterhin ein Geschäft betreiben kann und von dieser Möglichkeit Gebrauch macht.
Soweit der Franchisenehmer wie der Schuldner im Streitfall verpflichtet ist, die Geschäftsräume nach Vertragsbeendigung an den Franchisegeber oder einen Dritten herauszugeben, rechtfertigt die sich daraus für den Franchisegeber etwa ergebende tatsächliche Möglichkeit, diese Räume an einen neuen Franchisenehmer zu übergeben oder dort selbst ein entsprechendes Geschäft zu betreiben, eine entsprechende Anwendung des § 89b HGB nicht. Nach der gesetzlichen Wertung kommt bei der Rückgabe eines Pachtgegenstands ein etwaiger Wertzuwachs dem Verpächter zu; für einen solchen Wertzuwachs kann der Pächter keinen Ausgleich verlangen13. Durch die den Franchisenehmer etwa treffende Pflicht, die Geschäftsräume nach Vertragsbeendigung herauszugeben, wird der Schutzbereich des § 89b HGB dementsprechend nicht berührt14.
Die entsprechende Anwendung des § 89b HGB bei Franchiseverträgen, die ein anonymes Massengeschäft betreffen, kann auch nicht mit der Erwägung gerechtfertigt werden, dass das Erfordernis einer Verpflichtung zur Übertragung des Kundenstamms bei solchem Geschäft sinnlos wäre15. Auch wenn dies zutreffen sollte, ändert sich nichts daran, dass bei bloß faktischer Kontinuität des Kundenstamms keine hinreichende Ähnlichkeit der Interessenlage mit derjenigen des Handelsvertreters besteht.
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze steht dem Franchisenehmer im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall kein Ausgleich entsprechend § 89b HGB zu. Die beendeten Franchiseverträge – der Betrieb von zwei Backshop-Filialen – betreffen ein im Wesentlichen anonymes Massengeschäft.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 5. Februar 2015 – VII ZR 109/13
- vgl. BGH, Urteil vom 17.07.2002 – VIII ZR 59/01, NJW-RR 2002, 1554, 1555, zur entsprechenden Anwendbarkeit von § 89 HGB; Urteil vom 12.11.1986 – I ZR 209/84, WM 1987, 512, 513, zur entsprechenden Anwendbarkeit von § 90a Abs. 1 HGB[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 29.04.2010 – I ZR 3/09, GRUR 2010, 1107 Rn. 24 – JOOP![↩]
- st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 06.10.2010 – VIII ZR 209/07, NJW 2011, 848 Rn. 17; Urteil vom 06.10.2010 – VIII ZR 210/07, NJW-RR 2011, 389 Rn. 18; Urteil vom 29.04.2010 – I ZR 3/09, GRUR 2010, 1107 Rn. 24 – JOOP!; Urteil vom 13.01.2010 – VIII ZR 25/08, NJW-RR 2010, 1263 Rn. 15 m.w.N.[↩]
- BGH, Urteil vom 26.02.1997 – VIII ZR 272/95, BGHZ 135, 14, 17 m.w.N.; Urteil vom 12.01.2000 – VIII ZR 19/99, NJW 2000, 1413[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 29.04.2010 – I ZR 3/09, GRUR 2010, 1107 Rn. 24 – JOOP!; Urteil vom 12.03.2003 – VIII ZR 221/02, NJW-RR 2003, 894, 895[↩]
- vgl. die Nachweise im Urteil vom 17.04.1996 – VIII ZR 5/95, NJW 1996, 2159, 2160[↩]
- BGH, Urteil vom 17.04.1996 – VIII ZR 5/95, NJW 1996, 2159, 2160; Urteil vom 26.11.1997 – VIII ZR 283/96, NJW-RR 1998, 390, 391; vgl. ferner BGH, Urteil vom 16.02.1961 – VII ZR 244/59, VersR 1961, 401, 402[↩]
- BGH, Urteil vom 23.07.1997 – VIII ZR 130/96, NJW 1997, 3304, 3308 f. – Benetton, insoweit in BGHZ 130, 295 nicht abgedruckt[↩]
- vgl. Martinek, Franchising, S. 363 f., 366 f.; ders., Moderne Vertragstypen II, S. 154, 156 f.; Eckert, WM 1991, 1237, 1243 f.; Köhler, NJW 1990, 1689, 1691, 1693 f.[↩]
- vgl. Rauser in Metzlaff, Praxishandbuch Franchising, § 16 Rn. 212; Thume in Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, 9. Aufl., Band 2, Kap. – II Rn. 91; Giesler in Röhricht/Graf von Westphalen/Haas, HGB, 4. Aufl., Franchising Rn. 122a; Canaris, Handelsrecht, 24. Aufl., § 17 Rn. 25, zum Vertragshändler[↩]
- a.M. Bodewig, BB 1997, 637, 639; Penners, Die Bemessung des Ausgleichsanspruchs im Handelsvertreter- und Franchiserecht, S.204 ff.[↩]
- vgl. Kroll, ZVertriebsR 2014, 290, 293[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 12.05.1986 – II ZR 11/86, NJW 1986, 2306, 2307; Urteil vom 12.03.2003 – VIII ZR 221/02, NJW-RR 2003, 894, 895[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 12.05.1986 – II ZR 11/86, aaO, S. 2307; Urteil vom 12.03.2003 – VIII ZR 221/02, aaO, S. 895[↩]
- a.M. Penners, aaO, S.209[↩]