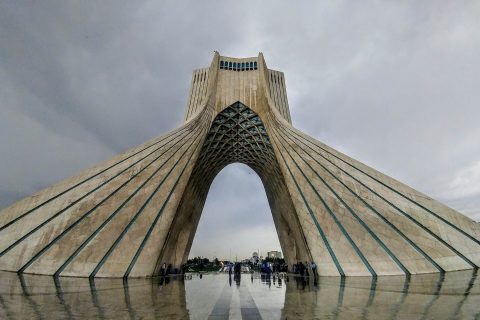Im Rahmen der Rückabwicklung des Darlehensvertrags steht dem Darlehensgeber vor Rückgabe des finanzierten Fahrzeugs ein Leistungsverweigerungsrecht aus § 358 Abs. 4, § 357 Abs. 4 BGB sowohl hinsichtlich der vor als auch hinsichtlich der nach Widerruf durch den Darlehensnehmer erbrachten Zahlungen zu.

Die bis zum Widerruf erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen
Einem entsprechenden Anspruch des Käufers auf Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen sowie der von ihm geleisteten Anzahlung aus § 355 Abs. 3 BGB steht seine Vorleistungspflicht aus § 358 Abs. 4 S. 1 BGB i.V.m. § 357 Abs. 4 S. 1 BGB entgegen.
Die Rechtsfolgen des Widerrufs, insbesondere im Hinblick auf die Vorleistungspflicht des Darlehensnehmers bei der Rückgabe des finanzierten Fahrzeugs und seine diesbezügliche Wertersatzpflicht, ergeben sich aus dem nationalen Recht, dessen Auslegung nach dem Wortlaut der einschlägigen Vorschriften, der Gesetzgebungsgeschichte und der Systematik der aufeinander bezogenen Normen eindeutig ist1.
Eine andere Auslegung käme daher selbst dann nicht in Betracht, wenn der nationale Gesetzgeber mit seinem Regelungskonzept zulasten des Darlehensnehmers hinter den Anforderungen der Verbraucherkreditrichtlinie, die allerdings keine konkreten Vorgaben zu den Rechtsfolgen des Widerrufs eines mit einem Kaufvertrag verbundenen Darlehensvertrags enthält2, zurückgeblieben wäre. Die Entscheidung darüber, ob im Rahmen des nationalen Rechts ein Spielraum für eine richtlinienkonforme Auslegung oder Rechtsfortbildung besteht, obliegt den nationalen Gerichten3. Eine richtlinienkonforme Auslegung darf nicht dazu führen, dass einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Norm ein entgegengesetzter Sinn gegeben oder der normative Gehalt der Norm grundlegend neu bestimmt wird. Richterliche Rechtsfortbildung berechtigt den Richter nicht dazu, seine eigene materielle Gerechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers zu setzen. Demgemäß kommt eine richtlinienkonforme Auslegung nur in Frage, wenn eine Norm tatsächlich unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten im Rahmen dessen zulässt, was der gesetzgeberischen Zweck- und Zielsetzung entspricht. Der Grundsatz gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung und Rechtsfortbildung darf nicht zu einer Auslegung des nationalen Rechts contra legem führen4. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs5. Die Pflicht zur Verwirklichung des Richtlinienziels im Auslegungswege findet ihre Grenzen an dem nach der innerstaatlichen Rechtstradition methodisch Erlaubten6.
Nach § 358 Abs. 4 S. 1 BGB sind auf die Rückabwicklung des verbundenen Vertrags unabhängig von der Vertriebsform § 355 Abs. 3 BGB und, je nach Art des verbundenen Vertrags, die §§ 357 bis 357b BGB entsprechend anzuwenden. Danach gelten für alle Verträge („unabhängig von der Vertriebsform“) § 355 Abs. 3 BGB und ergänzend die Vorschriften entsprechend, die nach der „Art des verbundenen Vertrags“ hypothetisch anwendbar wären, wenn dieser selbst widerrufen worden wäre, ohne dass es darauf ankommt, ob insoweit ein Widerrufsrecht bestanden hat. Dies ist bei einem – wie hier – Vertrag über die Lieferung einer Ware die Vorschrift des § 357 BGB7.
Aufgrund dessen ist der Käufer nach § 358 Abs. 4 S. 1 i.V.m. § 357 Abs. 4 S. 1 BGB im Hinblick auf die Rückgabe des finanzierten Fahrzeugs vorleistungspflichtig. Der Darlehensgeberin steht nach § 357 Abs. 4 S. 1 BGB – was sie im vorliegenden Fall jedenfalls konkludent geltend gemacht hat – gegenüber dem Käufer ein Leistungsverweigerungsrecht zu, bis sie das finanzierte Fahrzeug zurückerhalten hat, der Käufer den Nachweis erbracht hat, dass er das Fahrzeug abgesandt hat oder die Darlehensgeberin mit der Rücknahme des Fahrzeugs in Annahmeverzug geraten ist.
Die Rückgabepflicht des Käufers ist mangels anderweitiger Vereinbarung eine Bring- oder Schickschuld, die der Schuldner dem Gläubiger an dessen Wohnsitz anbieten oder an ihn absenden muss. Der Käufer hat der Darlehensgeberin das Fahrzeug nicht in einer den Annahmeverzug begründenden Weise nach §§ 293 bis 297 BGB angeboten. Dass der Käufer der Darlehensgeberin das Fahrzeug an deren Wohnsitz tatsächlich angeboten oder an sie nachweisbar abgesandt hat (§ 294 BGB), hat er nicht vorgetragen. Seine wörtlichen Angebote waren zur Herbeiführung eines Annahmeverzugs der Darlehensgeberin unzureichend, weil diese seine Vorleistungspflicht nicht berücksichtigten. Zwar hat der Käufer der Darlehensgeberin das Fahrzeug mit dem Schriftsatz vom 29.10.2021 (erstmals) unbedingt und unter Berücksichtigung der Charakteristik der Rückgabeverpflichtung als Bring- bzw. Schickschuld in hinreichender Form wörtlich angeboten. Allerdings liegen die weiteren Voraussetzungen des § 295 BGB, die ein tatsächliches Angebot entbehrlich machen würden, nicht vor.
Die Erklärung des Gläubigers, er werde die Leistung nicht annehmen, muss eindeutig und bestimmt sein. Sie muss sich insbesondere auch auf die konkrete Leistung beziehen. Hierzu genügt es nicht, wenn die Darlehensgeberin vorliegend die Wirksamkeit des Widerrufs und damit das Entstehen eines Rückgewährschuldverhältnisses in Abrede nimmt. Denn damit verhält sie sich nicht zu der konkreten Leistung, mithin der Rückgabe des Fahrzeugs. Eine Rücknahmeverweigerung ergibt sich auch nicht konkludent aus der Zurückweisung des Widerrufs. Denn die Darlehensgeberin kann trotz Zurückweisung des Widerrufs ein Interesse an der (vorläufigen) Rücknahme des Fahrzeugs bis zur Klärung der Rechtslage haben, nämlich um die Rechtsfolgen des Annahmeverzugs nach den §§ 300 ff. BGB auszuschließen.
Folge der fehlenden Erfüllung der Vorleistungspflicht ist insoweit die Abweisung der Klage als derzeit unbegründet8.
Die nach dem Widerruf erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen
Auch dem Anspruch auf Rückgewähr der nach Widerruf erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 3.058, 08 € aus § 812 Abs. 1 S. 1, Alt. 1 BGB steht die Vorleistungspflicht des Käufers entgegen.
Die Voraussetzungen einer Leistungskondiktion liegen grundsätzlich vor, nachdem durch den wirksamen Widerruf des Käufers der Rechtsgrund für dessen Zins- und Tilgungsleistungen im Zeitpunkt ihrer Erbringung entfallen war.
Der Kondiktionsausschluss des § 814 BGB steht dem klägerischen Anspruch nicht entgegen, da der Käufer bereits in dem Widerrufsschreiben vom 17.09.2020 mitgeteilt hat, dass die Zahlung weiterer Raten unter dem Vorbehalt der Rückforderung erfolge. Ein bei der Leistung gemachter Vorbehalt schließt die Anwendung des § 814 BGB regelmäßig aus9.
Das Leistungsverweigerungsrecht nach § 358 Abs. 4 S. 1 i.V.m. § 357 Abs. 4 S. 1 BGB steht der Darlehensgeberin jedoch auch in Bezug auf die von dem Käufer nach der Widerrufserklärung auf das Darlehen erbrachten Zahlungen zu.
Bei dem Wertersatzanspruch des Unternehmers nach § 357 Abs. 7 BGB handelt es sich um einen auf den Zeitraum zwischen Übergabe der Ware an den Käufer und Rückgabe der Ware an den Unternehmer bezogenen einheitlichen Anspruch, der durch den Widerruf des Darlehensvertrags keinen zeitlichen Einschnitt erfährt. Aufgrund dessen ist es im Hinblick auf die Vorleistungspflicht des Käufers, die auch dazu dient, dem Unternehmer die Bemessung seines Wertersatzanspruchs zu ermöglichen, sachgerecht und in dessen berechtigtem Interesse, dass dem Unternehmer oder – im Fall des Verbundgeschäfts – dem Darlehensgeber das Leistungsverweigerungsrecht aus § 357 Abs. 4 S. 1 BGB entsprechend auch gegenüber dem Bereicherungsanspruch des Käufers und Darlehensnehmers auf Rückzahlung der nach Widerruf geleisteten Zins- und Tilgungsraten zusteht10.
Die mit der hier entschiedenen Klage verfolgte Feststellung des Annahmeverzugs kann der Käufer nach den vorstehenden Ausführungen ebenfalls nicht verlangen, da die Voraussetzungen eines Annahmeverzugs nicht vorliegen.
Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 25. März 2022 – 3 U 130/21
- vgl. BGH, Urteil vom 27.10.2020 – XI ZR 498/19, Rn. 22 ff., 29 ff. juris; Urteil vom 26.10.2021 – XI ZR 608/20, Rn.19[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 27.10.2020, a.a.O., Rn. 39[↩]
- vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 17.11.2017 – 2 BvR 1131/16, Rn. 37[↩]
- vgl. BVerfG, a.a.O.[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 24.01.2012 – C-282/1, Rn. 25[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 28.06.2017 – IV ZR 440/14, Rn. 24, juris; BGH, Urteil vom 26.10.2021 a.a.O. Rn.20; BVerfG a.a.O.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 27.10.2020 a.a.O. Rn. 22[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 26.10.2021, a.a.O., Rn. 14, 16[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 20.07.2010 – EnZR 23/09, Rn. 29, juris; BGH, Urteil vom 17.02.1982 – IVb ZR 657/80, BGHZ 83, 278-283 Rn. 10[↩]
- BGH, Urteil vom 25.01.2022 – XI ZR 559/20, Rn. 17[↩]