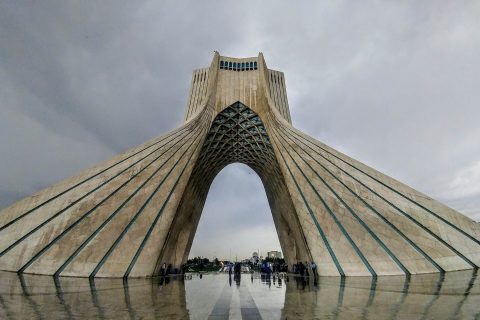Der Geschädigte ist nicht ohne Weiteres an eine von ihm ursprünglich gewählte Art der Schadensberechnung gebunden. Der (atypische) stille Gesellschafter kann sein Klagevorbringen vielmehr grundsätzlich umstellen und Schadensersatz unter Anrechnung seines Abfindungsguthabens verlangen. Die hierfür notwendige Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses kann üblicherweise in der Erhebung der Klage auf Rückabwicklung gesehen werden, da der Gesellschafter mit der Erklärung, seinen Beitritt mit rückwirkender Kraft beseitigen zu wollen, in der Regel seinen Willen zum Ausdruck bringt, die Bindung an die Gesellschaft und die Mitgesellschafter jedenfalls mit sofortiger Wirkung zu beenden1.

Da im vorliegenden Fall die Klage aber nicht vom Anleger/Gesellschafter selbst erhoben wurde, sondern von seiner Ehefrau, an die er etwaige Schadensersatzansprüche aus der Beteiligung abgetreten hat, kommt die Annahme einer solchen Umstellung des Klagebegehrens schon auf der Grundlage der Klagerhebung als solcher nicht in Betracht. Die Abtretung der Schadensersatzansprüche berechtigt die Klägerin als Zessionarin nicht zur Beendigung der Beteiligung. Ihr Klagebegehren kann daher nicht dahin verstanden werden, dass hilfsweise stillschweigend die Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses erklärt werden solle. Dass sie vom Zedenten zur Kündigung seines Gesellschaftsverhältnisses ermächtigt worden ist, hat die Klägerin ebenso wenig vorgetragen wie eine Kündigung durch den Zedenten selbst.
Rechtsfehler des Berufungsgerichts im Rahmen seiner tatrichterlichen Würdigung, dass eine Umdeutung der Widerrufserklärung des Zedenten in eine Kündigung aus wichtigem Grund ausgeschlossen sei, sind nicht zu erkennen. Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf abgestellt, dass eine Umdeutung nach § 140 BGB nur in Betracht kommt, wenn der Kündigungswille in der umzudeutenden Willenserklärung erkennbar zum Ausdruck kommt2. Dies hat das Berufungsgericht nicht feststellen können, da die umzudeutende Widerrufserklärung ausdrücklich und ausschließlich darauf gestützt worden ist, dass dem Zedenten aufgrund einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung ein gesetzliches oder vertragliches Widerrufsrecht (noch) zustehe. Ein für den Empfänger der Widerrufserklärung erkennbarer sachlicher Zusammenhang mit einer Aufklärungspflichtverletzung als Kündigungsgrund bestehe nicht. Diese tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts ist aus Rechtsgründen zu beanstanden. Insbesondere legt die Bezugnahme auf ein „vertragliches“ Widerrufsrecht nicht nahe, dass damit eine vertragliche Pflichtverletzung geltend gemacht werden solle, sondern bringt lediglich die Auffassung des Zedenten zum Ausdruck, ihm sei durch den Abdruck einer Widerrufsbelehrung auf dem Zeichnungsschein unabhängig von den gesetzlichen Voraussetzungen jedenfalls vertraglich ein nicht an bestimmte Gründe gebundenes Widerrufsrecht eingeräumt worden.
Die Frage, ob das Berufungsgericht die Klägerin gem. § 139 ZPO darauf hätte hinweisen müssen, dass eine Umdeutung der Widerrufserklärung des Zedenten in eine Kündigung aus wichtigem Grund nicht in Betracht komme, kann dahinstehen. Eine etwaige Verletzung des Verfahrensgrundrechts der Klägerin auf rechtliches Gehör ist jedenfalls nicht entscheidungserheblich, weil die Revision nur geltend macht, dass im Falle eines Hinweises (lediglich) die Klägerin eine Kündigungserklärung abgegeben hätte. Eine solche Erklärung der Klägerin wäre aus den oben genannten Gründen jedoch wirkungslos gewesen.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 23. September 2014 – II ZR 373/13