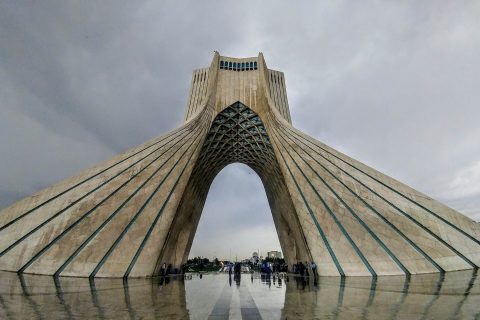Eine Klausel im Darlehensvertrag über eine einmalige, sofort fällige, nicht laufzeitabhängige Bearbeitungsgebühr benachteiligt den Darlehensnehmer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dies gilt auch für mit Unternehmern geschlossenen Darlehensverträge.

Der Darlehensnehmer hat daher gegen die Darlehensgeberin einen Anspruch auf Erstattung der als „einmalige Bearbeitungsgebühr“ erbrachten Leistung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB.
Dies bekräftigte der Bundesgerichtshof nun nochmals1 in einem Fall, in dem es sich bei der vom Darlehensnehmer beanstandeten Klausel um eine Allgemeine Geschäftsbedingung handelt, die nicht nach § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB ausgehandelt wurde.
Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt (§ 305 Abs. 1 Satz 1 BGB). Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.
Vorformuliert sind Vertragsbedingungen, wenn sie für eine mehrfache Verwendung schriftlich aufgezeichnet oder in sonstiger Weise fixiert sind. Dabei ist unerheblich, ob bei Abschluss von Darlehensverträgen regelmäßig ein Bearbeitungsentgelt in Höhe festgelegter Prozentsätze verlangt oder das Entgelt im Einzelfall anhand der Daten des konkreten Darlehensvertrages nach bestimmten Vorgaben errechnet wird2.
Die im vorliegenden Fall angegriffene Klausel findet sich in einem von der Bank verwendeten Formular und wurde in sich lediglich hinsichtlich des Betrags unterscheidenden Fassungen in acht Darlehensverträgen verwendet. Sie wurde auch nicht individuell ausgehandelt:
Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind (§ 305 Abs. 1 Satz 3 BGB). Aushandeln bedeutet mehr als bloßes Verhandeln. Von einem Aushandeln in diesem Sinne kann nur dann gesprochen werden, wenn der Verwender zunächst den in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen gesetzesfremden Kerngehalt, also die den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelung ändernden oder ergänzenden Bestimmungen, inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellt und dem Verhandlungspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen einräumt mit zumindest der effektiven Möglichkeit, die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsbedingungen zu beeinflussen. Er muss sich also deutlich und ernsthaft zur gewünschten Änderung einzelner Klauseln bereit erklären. Die entsprechenden Umstände hat der Verwender darzulegen3. In der Regel schlägt sich das Aushandeln in Änderungen des vorformulierten Textes nieder. Die allgemein geäußerte Bereitschaft, belastende Klauseln abzuändern, genügt nicht4. Diese Anforderungen gelten auch im Rechtsverkehr zwischen Unternehmern5.
Diese Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall schon nach dem Vortrag der Bank nicht erfüllt waren. Denn hieraus lässt sich nicht entnehmen, dass die Bank die Bearbeitungsgebühr als solche zur Disposition gestellt hat. Zwar hat die Bank behauptet, die Erhebung der Gebühr sei insgesamt verhandelbar gewesen und es sei nur der persönlichen Verhandlungsführung sowie den wirtschaftlichen Interessen des Darlehensnehmers geschuldet gewesen, dass er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht habe. Damit ist aber nicht dargetan, dass die Bank deutlich und ernsthaft ihre Verhandlungsbereitschaft erklärt hat. Dem entspricht, dass nach dem Vortrag der Bank die entsprechende Bearbeitungsgebühr in keinem der von beiden Parteien abgeschlossenen Darlehensverträge abbedungen worden ist6. Dass die Bearbeitungsgebühr nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht in allen dort vorliegenden Verfahren gleich hoch war, deutet allenfalls auf eine Verhandlungsbereitschaft der Bank zur Höhe der Gebühr, nicht aber hinsichtlich deren Anfalls hin.
Auch im Hinblick darauf, dass der Darlehensnehmer im vorliegenden Fall bei dem Abschluss des vorliegenden Darlehensvertrags als Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelte, wollte der Bundesgerichtshof die Wirksamkeit der verwendeten Klausel nicht bejahen:
Die streitige Vereinbarung stellt eine Preisnebenabrede dar. Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, unterliegt eine in einer Darlehensurkunde eines Kreditinstituts für den Abschluss von Kreditverträgen mit Unternehmern enthaltene formularmäßige Klausel über die Erhebung eines Bearbeitungsentgelts nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der richterlichen Inhaltskontrolle7.
§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB beschränkt die Inhaltskontrolle auf solche Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Hierunter fallen weder Bestimmungen über den Preis der vertraglichen Hauptleistung noch Klauseln über das Entgelt für eine rechtlich nicht geregelte zusätzlich angebotene Sonderleistung. Preisnebenabreden, die keine echte (Gegen)Leistung zum Gegenstand haben, sondern mit denen der Klauselverwender allgemeine Betriebskosten, Aufwand für die Erfüllung gesetzlich oder nebenvertraglich begründeter eigener Pflichten oder für sonstige Tätigkeiten auf den Kunden abwälzt, die der Verwender im eigenen Interesse erbringt, sind hingegen der Inhaltskontrolle unterworfen8.
Ob eine Klausel nach diesen Grundsätzen eine kontrollfähige Preisnebenabrede oder eine kontrollfreie Preisabrede enthält, ist durch Auslegung zu ermitteln. Diese hat sich nach dem objektiven Inhalt und typischen Sinn der in Rede stehenden Klausel einheitlich danach zu richten, wie ihr Wortlaut von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der regelmäßig beteiligten Verkehrskreise verstanden wird9. Zweifel bei der Auslegung gehen nach der Vorschrift des § 305c Abs. 2 BGB, die auch im unternehmerischen Geschäftsverkehr gilt10, zulasten des Klauselverwenders. Außer Betracht bleiben solche Auslegungsmöglichkeiten, die zwar theoretisch denkbar, praktisch aber fernliegend und daher nicht ernstlich in Betracht zu ziehen sind11.
Nach diesen Maßstäben war hier die von der Bank verwendete Klausel, die der Bundesgerichtshof selbstständig auslegen kann12, als kontrollfähige Preisnebenabrede einzuordnen.
Die mit dem streitgegenständlichen Bearbeitungsentgelt bezahlten Leistungen werden in dem Darlehensvertrag nicht genannt. Nach der verwendeten Bezeichnung „Bearbeitungsgebühr“ handelt es sich um Entgelt für die Bearbeitung des Darlehensantrages einschließlich der Vorbereitung des Vertragsschlusses sowie für Verwaltungsaufwand der Bank bei Kreditbearbeitung und auszahlung13. Die von der Bank auch im vorliegenden Verfahren gegen diese Auslegung vorgebrachten Einwände greifen nicht durch14.
Die damit als Preisnebenabrede einzuordnende Klausel hält entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung der Inhaltskontrolle nicht stand. Wie der Bundesgerichtshof nach Erlass des Berufungsurteils entschieden hat, sind formularmäßige Klauseln über die Erhebung eines Bearbeitungsentgelts in Darlehensverträgen gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB auch im Verhältnis zu Unternehmern unwirksam. Die Erhebung eines laufzeitunabhängigen Entgelts ist auch für die Bearbeitung eines Unternehmerdarlehens mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung unvereinbar und benachteiligt den Darlehensnehmer hier den Darlehensnehmer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen15. Der vorliegende Fall gibt keinen Anlass zu einer abweichenden Beurteilung.
Der Bundesgerichtshof hat auch bereits entschieden, dass die kenntnisabhängige Verjährungsfrist des § 199 Abs. 1 BGB für früher entstandene Rückforderungsansprüche wegen unwirksam formularmäßig vereinbarter Bearbeitungsentgelte auch bei Darlehensverträgen mit Unternehmern nicht vor dem Schluss des Jahres 2011 zu laufen begann16.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 17. April 2018 – XI ZR 213/16 –
- vgl. BGH, Urteil vom 04.07.2017 – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 7 ff.[↩]
- BGH, Urteil vom 04.07.2017 – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn.20 mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 20.03.2014 – VII ZR 248/13, BGHZ 200, 326 Rn. 27 mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 28.07.2015 – XI ZR 434/14, BGHZ 206, 305 Rn. 23[↩]
- BGH, Urteil vom 04.07.2017 – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 24 mwN[↩]
- so bereits BGH, Urteil vom 04.07.2017 – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 25[↩]
- BGH, Urteile vom 04.07.2017 – XI ZR 562/15, WM 2017, 1643 Rn. 23 ff. und – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 32 ff.[↩]
- BGH, Urteile vom 04.07.2017 – XI ZR 562/15, WM 2017, 1643 Rn. 24 und – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 33, jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 13.05.2014 – XI ZR 405/12, BGHZ 201, 168 Rn. 25 mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 28.07.2015 – XI ZR 434/14, BGHZ 206, 305 Rn. 31[↩]
- BGH, Urteil vom 13.05.2014, aaO Rn. 25 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 13.05.2014 – XI ZR 405/12, BGHZ 201, 168 Rn. 26[↩]
- so bereits BGH, Urteil vom 04.07.2017 – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 36[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 04.07.2017 – XI ZR 233/16, aaO[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 04.07.2017 – XI ZR 562/15, WM 2017, 1643 Rn. 37 ff. und – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 45 ff.[↩]
- BGH, Urteile vom 04.07.2017 – XI ZR 562/15, WM 2017, 1643 Rn. 85 ff. und – XI ZR 233/16, WM 2017, 1652 Rn. 93 ff.[↩]