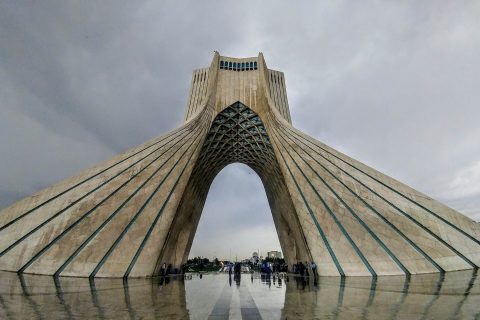Dem Transparenzgebot ist nicht genügt, wenn bei Ausgabe einer Namensschuldverschreibung eine Klausel ohne jede Beschränkung Beschlussfassungen der Gläubiger über Rechte und Pflichten der Anleger gestattet.

In dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hat der Anleger ausweislich des Zeichnungsscheins jeweils eine „Namensschuldverschreibung im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 5 VermAnlG ohne Verbriefung“ übernommen. Infolge der Verweisung auf § 1 Abs. 2 Nr. 5 VermAnlG in der maßgeblichen Fassung vom 06.12 2011 handelt es sich um eine Vermögensanlage in der Form einer Schuldverschreibung, nicht etwa um ein Nachrangdarlehen. Die Rückzahlungsvoraussetzungen waren nach Beendigung der Laufzeit für drei Namensschuldverschreibungen erfüllt.
Der Anspruch des Anlegers auf Rückzahlung des Kapitals wurde im vorliegenden Streitfall nicht durch den Beschluss der Anlegerversammlung wirksam dahin abbedungen, dass die Emittentin vorzeitig Anleihekapital und Zinsen durch Übertragung bestimmter Aktien tilgen kann.
Die Vorschrift des § 5 SchVG bildet keine Rechtsgrundlage für die in § 18 der Anleihebedingungen vorgesehene Befugnis, Rechte und Pflichten der Anleger durch Beschluss der Anlegerversammlung zu modifizieren. Das Schuldverschreibungsgesetz ist mangels einer Verbriefung nicht anwendbar.
Gemäß § 1 Abs. 1 SchVG gilt das Schuldverschreibungsgesetz für nach deutschem Recht begebene inhaltsgleiche Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen. Hierbei muss es sich um Schuldverschreibungen im Sinne der §§ 793 ff BGB handeln. Erforderlich ist also stets eine vom Verpflichteten ausgestellte Urkunde, in der er dem Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht (§ 793 Abs. 1 Satz 1 BGB). Wie § 2 SchVG zeigt, kommt ohne Verbriefung der Forderung keine Anwendung des Schuldverschreibungsgesetzes in Betracht. Entscheidend ist daher die Verbriefung; gleichgültig ist lediglich die Art der Verbriefung etwa in einer Sammelurkunde oder in Einzelurkunden1.
Im hier entschiedenen Streitfall fehlt es hinsichtlich der von dem Anleger erworbenen Schuldverschreibungen an der notwendigen Verbriefung. Die Forderungen ergeben sich ausschließlich aus den persönlichen Ansprüchen des Anlegers2. Eine entsprechende Anwendung des Schuldverschreibungsgesetzes scheidet aus, weil die Regelungen auf der hier fehlenden Verkehrsfähigkeit der Beteiligung beruhen3.
Eine Verweisung der Anleihebedingungen auf das Schuldverschreibungsgesetz ist im vorliegenden Fall nicht erfolgt. Bei dieser Sachlage kann für den Bundesgerichtshof dahingestellt bleiben, ob die Bestimmungen des Schuldverschreibungsgesetzes mit Hilfe einer Verweisung für anwendbar erklärt werden könnten.
Anleihebedingungen sind als allgemeine Geschäftsbedingungen anzusehen. Sie unterliegen einer Inhaltskontrolle. Zwar findet gemäß § 310 Abs. 4 BGB eine Prüfung nach Maßgabe der §§ 305 ff BGB bei Verträgen auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts nicht statt. Davon werden jedoch Verträge über die Gewährung von Schuldverschreibungen nicht umfasst, weil sie keine gesellschaftsrechtlich geprägten Mitgliedschaftsrechte sind, sondern sich in einem bestimmten geldwerten Anspruch erschöpfen und darin ihr Charakter als schuldrechtliches Gläubigerrecht zum Ausdruck kommt4.
Die Bedingungen der Namensschuldverschreibungen unterliegen als Allgemeine Geschäftsbedingungen einer gerichtlichen Inhaltskontrolle5. § 18 der Anleihebedingungen verstößt jedenfalls gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB.
Nach dieser Vorschrift kann sich eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners, die gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB die Unwirksamkeit der betreffenden Bestimmung zur Folge hat, auch daraus ergeben, dass diese nicht klar und verständlich ist. Das Transparenzgebot verpflichtet den Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen, Rechte und Pflichten seiner Vertragspartner möglichst klar und durchschaubar darzustellen. Der Verwender muss folglich einerseits die tatbestandlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen so genau beschreiben, dass für ihn keine ungerechtfertigten Beurteilungsspielräume entstehen. Der Vertragspartner soll andererseits ohne fremde Hilfe möglichst klar und einfach seine Rechte feststellen können, damit er nicht von deren Durchsetzung abgehalten wird. Dies gilt auch für die Bestimmungen zu den Hauptleistungspflichten (§ 307 Abs. 3 Satz 2 BGB; BGH, Urteil vom 06.12 2018 – IX ZR 143/17, BGHZ 220, 280 Rn. 35 mwN). Die Klausel muss zudem die wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen für einen durchschnittlichen Vertragspartner soweit erkennen lassen, wie dies nach den Umständen gefordert werden kann. Abzustellen ist dabei auf die Erwartungen und Erkenntnismöglichkeiten eines typischen Vertragspartners bei Verträgen der geregelten Art6.
Diesen Anforderungen wird eine Klausel Anleihebedingungen nicht gerecht, die lediglich vorsieht, dass die Anlegerversammlung Beschlüsse „um Rechte und Pflichten“ der Anleger treffen kann. Der Begriff der Rechte und Pflichten entbehrt jeder Konkretisierung. Der Anleger muss sich wenigstens ein grobes Bild davon machen können, welche Belastungen auf ihn zukommen7. Daran fehlt es im Streitfall. Würde die Regelung des § 18 der Anleihebedingungen gebilligt, könnte durch Beschluss der Anlegerversammlung nach Belieben in die Rechtsposition der Anleihegläubiger eingegriffen werden. Eine Änderung des Äquivalenzverhältnisses zwischen den beiderseitigen Leistungen muss für den Anleger erkennbar und kalkulierbar sein. Ein mehr oder weniger schrankenloses Ermessen ist mit dem Transparenzgebot unvereinbar8. Dabei fällt zusätzlich ins Gewicht, dass nicht erschienene Anleger in der Anlegerversammlung durch die von der Emittentin bestimmte und nur kraft der vorformulierten Anleihebedingungen bevollmächtigte Treuhänderin vertreten werden.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 16. Januar 2020 – IX ZR 351/18
- BGH, Urteil vom 22.03.2018 – IX ZR 99/17, BGHZ 218, 183 Rn. 15[↩]
- vgl. BGH, aaO Rn. 16[↩]
- vgl. BGH, aaO Rn. 17 f[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 05.10.1992 – II ZR 172/91, BGHZ 119, 305, 312[↩]
- vgl. BGH, aaO; Urteil vom 30.06.2009 – XI ZR 364/08, WM 2009, 1500 Rn. 23[↩]
- BGH, Urteil vom 26.03.2019 – II ZR 413/18, WM 2019, 915 Rn. 12 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 06.04.2005 XII ZR 158/01, WM 2005, 2153, 2155[↩]
- MünchKomm-BGB/Wurmnest, BGB, 8. Aufl., § 307 Rn. 61[↩]
Bildnachweis:
- Schuldverschreibung: Wikipedia