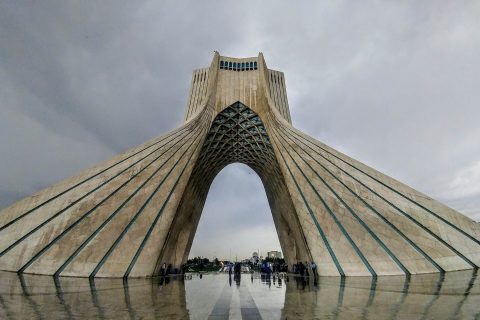Das Leistungsverweigerungsrecht aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB, mit dem der Schuldner eine Forderung des Gläubigers abwehrt, die der Gläubiger durch eine zum Schadenersatz verpflichtende Pflichtverletzung erlangt hat, verjährt außerhalb des Anwendungsbereichs des § 853 BGB mit dem zugrundeliegenden Anspruch auf Aufhebung der Forderung aus § 280 Abs. 1 BGB.

Die Kundin, die der Inanspruchnahme durch die Bank ein Leistungsverweigerungsrecht aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB entgegenhält, beruft sich auf eine unselbständige Einwendung, die mit dem Anspruch verjährt, aus dem sie abgeleitet wird1. Dieser Anspruch lautet auf Vertragsaufhebung nach Maßgabe der § 280 Abs. 1, § 249 Abs. 1 BGB2. Ist Grund des Leistungsverweigerungsrechts der Kundin der Umstand, dass der Bank ein schutzwürdiges Interesse an der Leistung auf die Verpflichtung aus den Zinssatz-Swap-Verträgen fehlt, weil sie zur alsbaldigen Rückgewähr verpflichtet ist3, steht hinter dem Einwand aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB also der Gedanke der Prozessökonomie4, entfällt die Rechtfertigung der Einwendung, wenn ein zweiter Prozess auf Rückgewähr im Hinblick auf § 214 Abs. 1 BGB erfolgreich nicht mehr geführt werden könnte.
Eine Regelung, die den Einwand aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB über den Ablauf der Verjährung des zugrunde liegenden Anspruchs aufrechterhielte, existiert nicht. § 215 BGB ist nach seinem Wortlaut nicht anwendbar, weil der Einwand der Kundin, die Bank habe sie aufgrund der von ihr behaupteten Beratungspflichtverletzung so zu stellen, als seien die Zinssatz-Swap-Verträge nicht zustande gekommen, keine Aufrechnung mit einem gleichartigen Gegenanspruch beinhaltet. In der Einwendung der Kundin liegt auch nicht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts im Sinne des § 215 BGB, weil Leistungen aus den Zinssatz-Swap-Verträgen das Bestehen eines Anspruchs der Kundin auf Vertragsaufhebung nach Maßgabe der § 280 Abs. 1, § 249 Abs. 1 BGB unterstellt gerade nicht Zug um Zug gegen die Vertragsaufhebung zu erfüllen wären5. Ebenfalls zugunsten der Kundin nicht anwendbar sind die §§ 821, 853 BGB.
Eine analoge Anwendung der §§ 215, 821, 853 BGB kommt mangels planwidriger Regelungslücke nicht in Betracht6. Der Gesetzgeber hat den Erhalt der Einrede der unzulässigen Rechtsausübung über die Verjährung des zugrundeliegenden Anspruchs hinaus für den Sonderfall der deliktischen Schädigung ausdrücklich geregelt. Damit hat er zugleich zu erkennen gegeben, in anderen Fällen bleibe es bei § 214 Abs. 1 BGB. Dass die Interessenlage bei der Geltendmachung der §§ 242, 249 Abs. 1 BGB der bei der Aufrechnung entspricht7, genügt zur Begründung einer Analogie nicht.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf8 hat aber rechtsfehlerhaft angenommen, der von ihm der Sache nach geprüfte Einwand aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB beruhe auf einem „einheitlichen“ Schadenersatzanspruch, dessen Verjährung erst mit dem letzten haftungsbegründenden Ereignis angelaufen sei. Das trifft nicht zu:
Die Annahme des OLG Düsseldorf als richtig unterstellt, die Beklagte habe durch das Verschweigen des anfänglichen negativen Marktwerts der streitgegenständlichen Zinssatz-Swap-Verträge wenn auch wiederholt gegen dieselbe vertragliche Beratungspflicht aus einem Dauerberatungsvertrag verstoßen, wäre dieser Umstand für sich doch nicht geeignet, einen „einheitlichen“ Schadenersatzanspruch zur Entstehung zu bringen. Denn dadurch änderte sich nichts an dem allein maßgeblichen Gesichtspunkt, dass die hier unterstellte Schädigung der Kundin auf unterschiedlichen haftungsbegründenden Ereignissen beruhte, die bei der Anspruchsentstehung je für sich zu betrachten sind9. Die Gleichförmigkeit der vertragswidrigen Unterlassung verknüpfte die wiederholten Pflichtverletzungen nicht zu einer einheitlichen Schädigungshandlung, die sich lediglich im Bereich der haftungsausfüllenden Kausalität weiterentwickelte. Vielmehr entstanden mit jeder unterstellten Schädigung der Klägerin durch den zeitlich gestaffelten Abschluss der Swap-Geschäfte selbständige Schadenersatzansprüche, die verjährungsrechtlich getrennt zu betrachten waren10.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 28. April 2015 – XI ZR 378/13
- zur Anwendung des § 194 BGB auf unselbständige Einreden vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 74. Aufl., § 194 Rn. 6[↩]
- BGH, Urteile vom 20.02.1967 – III ZR 134/65, BGHZ 47, 207, 214; und vom 17.03.1994 – IX ZR 174/93, WM 1994, 1064, 1066[↩]
- vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 74. Aufl., § 242 Rn. 52[↩]
- Wacke, JA 1982, 477[↩]
- OLG Nürnberg, WM 2014, 2364, 2366[↩]
- OLG Nürnberg, WM 2014, 2364, 2366 f.; aA OLG Hamm, Urteil vom 31.03.2011 28 U 63/10 81, 162 f.; in diese Richtung auch OLG Bremen, WM 2006, 758, 768; offen BGH, Beschluss vom 26.01.2012 – IX ZR 69/11 11[↩]
- vgl. Staudinger/Looschelders/Olzen, BGB, Neubearb.2015, § 242 Rn. 281; Wacke, JA 1982, 477 f.[↩]
- OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.10.2013 – I9 U 101/12[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 15.01.2013 – II ZR 90/11, WM 2013, 456 Rn. 27[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 24.03.2015 – XI ZR 278/14, Umdruck Rn. 26; BGH, Urteile vom 14.02.1978 – X ZR 19/76, BGHZ 71, 86, 93 f.; vom 15.10.1992 – IX ZR 43/92, WM 1993, 251, 255; vom 12.02.1998 – IX ZR 190/97, WM 1998, 786, 788; vom 14.07.2005 – IX ZR 284/01, WM 2005, 2106, 2107; und vom 01.12 2005 – IX ZR 115/01, WM 2006, 148, 150; Clouth, WuB 2015, 63, 65[↩]