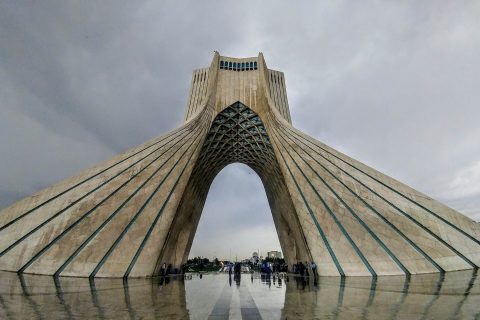Steht der Preis für die Wohnung in einem auffälligen Missverhältnis zu deren Wert, begründet dies bei Hinzutreten einer verwerflichen Gesinnung des Begünstigten einen Verstoß gegen die guten Sitten und führt zur Nichtigkeit des Vertrags nach § 138 Abs. 1 BGB1.

Für die verwerfliche Gesinnung spricht eine tatsächliche Vermutung, wenn das Missverhältnis besonders grob ist. Das wiederum ist anzunehmen, wenn – bei einer Benachteiligung des Käufers – die Verkehrswertüberschreitung oder – bei einer Benachteiligung des Verkäufers – die Verkehrswertunterschreitung 90% oder mehr beträgt2.
Bei den Anforderungen an die Darlegung eines besonders groben Missverhältnisses verfolgen die Zivilsenate des Bundesgerichtshofs keinen einheitlichen Ansatz. Im Ausgangspunkt noch einheitlich wird ein Vortrag als schlüssig und ausreichend substantiiert angesehen, wenn die vorgetragenen Tatsachen in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht zu begründen3. Kommt es auf den Verkehrswert einer Sache an, ist es nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich ausreichend, wenn die darlegungspflichtige Partei einen bestimmten Wert behauptet und durch Sachverständigengutachten unter Beweis stellt4. Etwas anderes gilt nur, wenn eine solche Behauptung ins Blaue hinein erfolgt, wobei der Bundesgerichtshof bei der Annahme eines Rechtsmissbrauchs Zurückhaltung übt5. Demgegenüber erfordert ein den Substantiierungsanforderungen genügender Vortrag zu einem entsprechenden Minderwert einer erworbenen Immobilie nach der Rechtsprechung des XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs die Darlegung konkreter, dem Beweis zugänglicher Angaben zu den wertbildenden Faktoren der erworbenen Wohnung6. Inwieweit diese unterschiedlichen Ansätze zu abweichenden Ergebnissen im Einzelfall führen, kann hier dahinstehen. Die Sache ist deshalb auch nicht dem Großen Senat für Zivilsachen vorzulegen.
Der Vortrag der Käuferin genügt nämlich auch den erhöhten Anforderungen der Rechtsprechung des XI. Zivilsenats. Die Käuferin hat sich nicht nur auf die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ausreichende Behauptung, der Verkehrswert der Wohnung betrage 48.000 €, und den Antritt von Sachverständigenbeweis beschränkt. Sie hat vielmehr in der Klageschrift näher erläutert, dass und auf welcher Grundlage sie den Betrag errechnet hat. Dieser Vortrag hängt keineswegs „im luftleeren Raum“. Die Käuferin hat den ihr bei der Beratung nach ihrem Vortrag mitgeteilten und in der Rentabilitätsberechnung der Anlagevermittlerin angesetzten Mietertrag von monatlich 277 € zugrunde gelegt und den Wert der Wohnung nach der Ertragswertmethode mit näher bezeichneten Einsatzwerten berechnet. Dass und warum die Ertragswertmethode, deren Wahl bei einer Kapitalanlage naheliegt, und dass und warum die anderen gewählten Einsatzwerte sachlich richtig sind, musste sie nicht darlegen. Das ist im Rahmen der Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten zu klären.
Angesichts dieser Angaben liegt die Annahme fern, die Käuferin habe das besonders grobe Missverhältnis von Kaufpreis und Wert ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich aufs Geratewohl, gleichsam „ins Blaue hinein“ behauptet7.
Die Käuferin hat auch das Vorliegen einer verwerflichen Gesinnung behauptet. Sie hat sich in der Klageschrift auf die aus dem dargelegten besonders groben Missverhältnis folgende tatsächliche Vermutung berufen. Mehr musste sie nicht tun8.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 19. Dezember 2014 – V ZR 194/13
- vgl. BGH, Urteil vom 19.01.2001 – V ZR 437/99, BGHZ 146, 298, 301 f.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 24.01.2014 – V ZR 249/12, NJW 2014, 1652 Rn. 8 sowie Herrler, ZNotP 2014, 252, 253 f.[↩]
- BGH, Beschlüsse vom 12.06.2008 – V ZR 221/07, WM 2008, 2068 Rn. 6; vom 02.04.2009 – V ZR 177/08, NJW-RR 2009, 1236 Rn. 10; und vom 20.03.2014 – V ZR 149/13, ZfIR [Ls] 5[↩]
- BGH, Urteile vom 05.10.2001 – V ZR 237/00, NJW 2002, 429, 431, r. Sp.; und vom 13.12 2002 – V ZR 359/01, NJW-RR 2003, 491 f., r. Sp. sowie Beschlüsse vom 02.04.2009 – V ZR 177/08, NJW-RR 2009, 1236 Rn. 10; und vom 20.03.2014 – V ZR 149/13, ZfIR 2014, 349 [Ls] 6[↩]
- vgl. etwa Beschluss vom 20.03.2014 – V ZR 149/13, ZfIR 2014, 349 [Ls] 6[↩]
- Urteile vom 12.11.2002 – XI ZR 3/01, WM 2003, 61, 62; und vom 19.09.2006 – XI ZR 204/04, WM 2006, 2343, Rn.20, insoweit nicht in BGHZ 169, 109 abgedruckt; BVerfG NJW 2009, 1585 Rn. 25[↩]
- dazu BGH, Urteil vom 13.12 2002 – V ZR 359/01, NJW-RR 2003, 491 und Beschluss vom 02.04.2009 – V ZR 177/08, NJW-RR 2009, 1236 Rn. 11[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 09.10.2009 – V ZR 178/08, NJW 2010, 363 Rn.19; und vom 10.02.2012 – V ZR 51/11, NJW 2012, 1570 Rn. 9[↩]