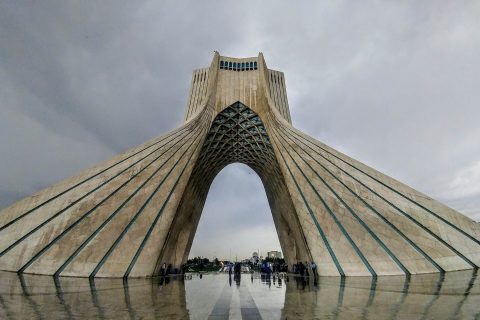Mit der Verwirkung des Widerrufsrechts bei Verbraucherdarlehensverträgen hatte sich aktuell der Bundesgerichtshof zu befassen:

Die Verwirkung als Unterfall der unzulässigen Rechtsausübung wegen der illoyal verspäteten Geltendmachung von Rechten setzt neben einem Zeitmoment ein Umstandsmoment voraus.
Ein Recht ist verwirkt, wenn sich der Schuldner wegen der Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin bei objektiver Beurteilung darauf einrichten darf und eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, so dass die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt.
Zeitund Umstandsmoment können nicht voneinander unabhängig betrachtet werden, sondern stehen in einer Wechselwirkung. Je länger der Inhaber des Rechts untätig bleibt, desto mehr wird der Gegner in seinem Vertrauen schutzwürdig, das Recht werde nicht mehr ausgeübt werden1. Zu dem Zeitablauf müssen besondere, auf dem Verhalten des Berechtigten beruhende Umstände hinzutreten, die das Vertrauen des Verpflichteten rechtfertigen, der Berechtigte werde sein Recht nicht mehr geltend machen. Ob eine Verwirkung vorliegt, richtet sich letztlich nach den vom Tatrichter festzustellenden und zu würdigenden Umständen des Einzelfalles, ohne dass insofern auf Vermutungen zurückgegriffen werden kann2. Die Bewertung des Tatrichters kann in der Revisionsinstanz nur daraufhin überprüft werden, ob sie auf einer tragfähigen Tatsachengrundlage beruht, alle erheblichen Gesichtspunkte berücksichtigt und nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt oder von einem falschen Wertungsmaßstab ausgeht3.
Dass die Bank mit Leistungen der Darlehensnehmer nach Beendigung des Darlehensvertrags gearbeitet hat, ist ein Umstand, der bei der Entscheidung über die Verwirkung des Widerrufsrechts veranschlagt werden kann4. Das Oberlandesgerichts Karlsruhe, das gemeint hat, die „Weiterverwendung der zurückgeflossenen Gelder“ sei generell „kein vertrauensbegründender Umstand, der zur einvernehmlichen Darlehensablösung“ hinzutrete, hat ihn bei der Prüfung der Verwirkung des Widerrufsrechts nicht wie geboten mit in den Blick genommen5.
Entgegen der Rechtsmeinung des Oberlandesgerichts Karlsruhe, das die Würdigung dieses Umstands bei der Prüfung der Verwirkung kategorisch ausgeschlossen hat, ist überdies die Tatsache, dass der Darlehensgeber Sicherheiten freigegeben hat, ein Aspekt, den der Tatrichter bei der Prüfung des Umstandsmoments berücksichtigen kann. Dem steht nicht entgegen, dass der Darlehensgeber nach Beendigung des Darlehensvertrags und vollständiger Erfüllung der aus dem unwiderrufenen Darlehensvertrag resultierenden Pflichten des Darlehensnehmers die Sicherheiten ohnehin freizugeben hätte. Vom Darlehensgeber bestellte Sicherheiten sichern regelmäßig auch Ansprüche aus einem Rückgewährschuldverhältnis nach § 357 Abs. 1 Satz 1 BGB aF in Verbindung mit §§ 346 ff. BGB. Dem Rückgewähranspruch des Darlehensnehmers aus der Sicherungsabrede haftet die für den Fall des Widerrufs auflösende Rechtsbedingung einer Revalutierung an. Beendet der Darlehensgeber trotz der Möglichkeit der Revalutierung durch Rückgewähr der Sicherheit den Sicherungsvertrag, kann darin die Ausübung beachtlichen Vertrauens im Sinne des § 242 BGB liegen6.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 16. Oktober 2018 – XI ZR 45/18
- BGH, Urteil vom 10.10.2017 – XI ZR 393/16, WM 2017, 2247 Rn. 9; BGH, Beschluss vom 23.01.2018 – XI ZR 298/17, WM 2018, 614 Rn. 9[↩]
- BGH, Urteile vom 12.07.2016 – XI ZR 501/15, BGHZ 211, 105 Rn. 40 und – XI ZR 564/15, BGHZ 211, 123 Rn. 37; vom 11.10.2016 – XI ZR 482/15, BGHZ 212, 207 Rn. 30; vom 21.02.2017 – XI ZR 185/16, BGHZ 214, 94 Rn. 33 sowie vom 14.03.2017 – XI ZR 442/16, WM 2017, 849 Rn. 27; BGH, Beschluss vom 23.01.2018, aaO[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 12.07.2016 – XI ZR 501/15, aaO, Rn. 18 und – XI ZR 564/15, aaO, Rn. 43; BGH, Beschluss vom 23.01.2018, aaO[↩]
- BGH, Beschluss vom 05.06.2018 – XI ZR 577/16 4[↩]
- OLG Karlsruhe, Urteil vom 09.01.2018 – 17 U 183/16[↩]
- BGH, Urteil vom 11.09.2018 – XI ZR 125/17, Rn. 34; BGH, Beschlüsse vom 23.01.2018 – XI ZR 298/17, WM 2018, 614 Rn.20; und vom 07.03.2018 – XI ZR 298/17[↩]