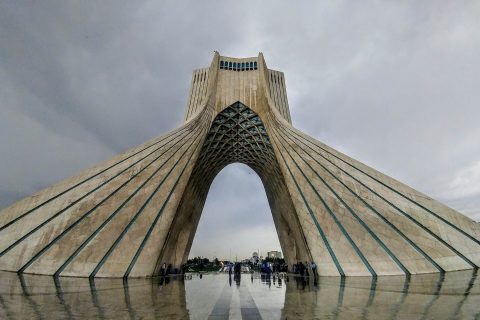In Fällen, in denen der Darlehensnehmer das Fahrzeug nach Widerruf nicht an den Darlehensgeber zurückgibt, sondern es weiter nutzt, aber gleichzeitig seine Pflicht zur Leistung von Wertersatz dem Grunde nach anerkennt, kommt eine Verwirkung des Widerrufsrechts nicht in Betracht.

Dies gilt nach dem vorliegenden Urteil des Oberlandesgerichts Celle insbesondere auch in Fällen, in denen die Widerrufsfrist mangels hinreichender Belehrung nicht zu laufen begonnen hat, sodass der Widerruf auch nach noch Jahren erfolgen konnte.
Die Ausübung des Widerrufsrechts durch den Autokäufer ist in einem solchen Fall auch nicht rechtsmissbräuchlich. Insbesondere ergibt sich eine unzulässige Rechtsausübung des Autokäufers in Gestalt der Verwirkung entgegen der Auffassung der Darlehensgeberin nicht daraus, dass der Autokäufer das Fahrzeug im täglichen Gebrauch nutzt.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sieht die Verbraucherkreditrichtlinie keine zeitliche Beschränkung der Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher für den Fall vor, dass ihm diese Informationen nicht erteilt wurden, sodass eine solche Beschränkung mithin auch nicht in einem Mitgliedstaat durch die nationalen Rechtsvorschriften auferlegt werden1. Es ist dem Kreditgeber daher verwehrt, sich gegenüber der Ausübung des Widerrufsrechts gemäß Art. 14 der Verbraucherkreditrichtlinie durch den Verbraucher auf den Einwand der Verwirkung zu berufen, wenn eine der in Art. 10 Abs. 2 dieser Richtlinie vorgesehenen zwingenden Angaben weder im Kreditvertrag enthalten noch nachträglich ordnungsgemäß mitgeteilt worden ist, unabhängig davon, ob der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Kenntnis hatte, ohne dass er diese Unkenntnis zu vertreten hat2.
Zwar hat der Bundesgerichtshof durch Beschluss vom 31.01.20223 dem Gerichtshof der Europäischen Union erneut die Frage vorgelegt, ob Art. 14 Abs. 1 der Verbraucherkreditrichtlinie dahin auszulegen ist, dass es den nationalen Gerichten nicht verwehrt ist, im Einzelfall bei Vorliegen besonderer, über den bloßen Zeitablauf hinausgehender Umstände die Berufung des Verbrauchers auf sein wirksam ausgeübtes Widerrufsrecht als missbräuchlich oder betrügerisch zu bewerten mit der Folge, dass ihm die vorteilhaften Rechtsfolgen des Widerrufs versagt werden können. In seiner Begründung hat der Bundesgerichtshof allerdings aufgeführt, dass ein rechtsmissbräuchliches Verhalten (nur) dann in Betracht kommt, wenn es dem Darlehensnehmer nicht um die Rückabwicklung des Vertrages, sondern darum geht, das finanzierte Fahrzeug nach längerer bestimmungsgemäßer Nutzung kostenfrei zurückgeben zu können4, mithin neben die Weiternutzung des Fahrzeugs kumulativ noch die Negierung eines Wertersatzanspruchs der Bank tritt.
Dies ergibt sich auch draus, dass sämtlichen unter dem Aktenzeichen XI ZR 113/21 durch den Bundesgerichtshof zusammengeführten Fällen gemein ist, dass die Berufungsgerichte einen Rechtsmissbrauch nur bejaht haben, wenn der jeweilige Autokäufer das Fahrzeug nach dem Widerruf weiter nutzt und gleichzeitig seine Pflicht zum Wertersatz negiert.
Hier steht der Annahme eines Rechtsmissbrauchs jedoch entgegen, dass der Autokäufer seine Pflicht zur Leistung von Wertersatz dem Grunde nach ausdrücklich anerkannt hat. Unerheblich ist insoweit, dass er selbst lediglich einen geringen Wertersatzanspruch der Darlehensgeberin von seinen eigenen Ansprüchen in Abzug gebracht hat. Denn durch das Anerkenntnis hat er deutlich gemacht, dass er nicht gewillt ist, das Fahrzeug kostenfrei zu nutzen, sondern die Darlehensgeberin für die weitere Nutzung zu kompensieren, auch wenn die Höhe der Kompensation im Einzelnen streitig ist. Eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens kam demzufolge nicht in Betracht.
Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 25. März 2022 – 3 U 130/21