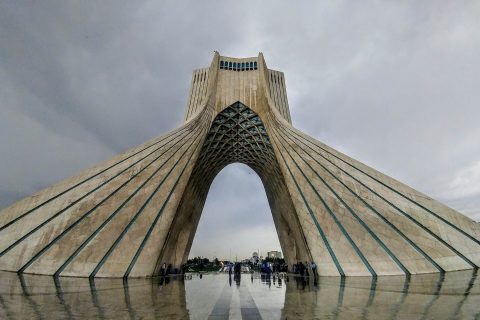Aktuell hatte sich der Bundesgerichtshof – in Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung aus den Jahren 2011 und 20151 – mit den Voraussetzungen der Konnexität von Grundgeschäft und Gegengeschäft bei Abschluss von Zinssatz-Swap-Verträgen zu befassen:

In dem hier entschiedenen Fall waren im Zusammenhang mit dem Abschluss der drei streitgegenständlichen Zinssatz-Swap-Verträge durch die Aufnahme von Beratungsgesprächen zwischen der Bank und ihrer Kundin, einer kleinen nordrheinwestfälischen Gemeinde, stillschweigend Kapitalanlageberatungsverträge geschlossen worden2. Dabei hatte die Bank, wie der Bundesgerichtshof bestätigte, ihre Pflicht verletzt, die Kundin über das Einpreisen eines anfänglichen negativen Marktwerts als solches und dessen Höhe aufzuklären.
Unrichtig ist allerdings die auf seiner unzutreffenden Umschreibung des anfänglichen negativen Marktwerts gründende Annahme des in der Vorinstanz tätigen Oberlandesgerichts Köln3, eine Bank, die auf den anfänglichen negativen Marktwert eines mit ihr selbst geschlossenen Swap-Geschäfts nicht hinweise, verstoße gegen das Gebot der objektgerechten Beratung. Das Einpreisen einer Bruttomarge ist kein Umstand, über den die beratende Bank im Rahmen der objektgerechten Beratung informieren müsste4. Der anfängliche negative Marktwert spiegelt nicht den voraussichtlichen Erfolg und Misserfolg des Geschäfts wider, sondern den Marktwert bei Abschluss des Vertrags, der zu diesem Zeitpunkt durch Glattstellung des Vertrags realisierbar wäre. Eine überwiegende Verlustwahrscheinlichkeit indiziert der anfängliche stichtagsbezogene negative Marktwert dagegen nicht. Der Erfolg des Swaps hängt letztlich allein von der Zins- und/oder Währungskursentwicklung und gegebenenfalls der Entwicklung des „Spreads“ während der Vertragslaufzeit ab. Die Empfehlung eines Swap-Vertrags kann daher trotz des anfänglichen negativen Marktwerts objektgerecht sein.
Die Verpflichtung, bei Swap-Verträgen im Zweipersonenverhältnis anlässlich einer vertraglich geschuldeten Beratung das Einpreisen einer Bruttomarge zu offenbaren, sofern es wie hier an konnexen Grundgeschäften fehlt, folgt vielmehr aus dem Gesichtspunkt eines schwerwiegenden Interessenkonflikts5. Das Einstrukturieren der Bruttomarge in die Risikostruktur des Swap-Vertrags kann der Kunde, der davon ausgeht, die beratende Bank verdiene ausschließlich bei ihr günstigem Verlauf der Zinswette in Höhe der Zinsdifferenz, bei der gebotenen normativobjektiven Betrachtungsweise unabhängig von den Bedingungen des Swap-Geschäfts nicht erkennen.
Trotz seines unzutreffenden Ausgangspunkts ist das Oberlandesgericht Köln6 indessen zu einem richtigen Ergebnis gelangt. Dabei hat es entgegen der gemäß § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b ZPO ausgeführten Rüge der Bank entscheidungserhebliches Vorbringen der Bank nicht übergangen. Die Bank hat nicht vorgebracht, sie habe der Kundin jeweils auch die Höhe des anfänglichen negativen Marktwerts mitgeteilt. Vielmehr ist das Gegenteil unstreitig. Die Bank hat damit die Erfüllung ihrer Aufklärungspflicht nicht behauptet.
Die Pflicht der Bank, über die Einpreisung des anfänglichen negativen Marktwerts aufzuklären, entfiel, wie das Oberlandesgericht Köln6 im Ergebnis ebenfalls richtig gesehen hat, auch nicht unter dem Aspekt einer konnexen Verknüpfung der Zinssatz-Swap-Verträge mit Darlehen als Grundgeschäften.
Ist die zu einem Zinssatz-Swap-Vertrag mit ihr selbst ratende Bank zugleich Darlehensgeberin des Kunden, muss sie nicht offenbaren, dass sie in einen Zinssatz-Swap-Vertrag eine Bruttomarge eingepreist hat, sofern Zinssatz-Swap-Vertrag und Darlehensvertrag konnex sind. In diesem Fall und unter den unter bb)) näher ausgeführten Voraussetzungen verändern Bank und Kunde durch die Vereinbarung eines Zinssatz-Swap-Vertrags wirtschaftlich lediglich die Konditionen des Darlehensvertrags. Ist die beratende Bank zugleich Vertragspartner des Darlehensvertrags, muss der Kunde bei normativobjektiver Betrachtung damit rechnen, dass die Bank als Darlehensgeberin nicht nur mit dem Darlehensgeschäft, sondern auch mit dem wirtschaftlich einer Änderung der Bedingungen des Darlehensvertrags gleichkommenden Zinssatz-Swap-Geschäft eigennützige Interessen verfolgt.
Daraus folgt, dass über den in der Einpreisung des anfänglichen negativen Marktwerts liegenden schwerwiegenden Interessenkonflikt ausnahmsweise nicht aufzuklären ist, wenn es bei wirtschaftlicher Betrachtung ausschließlich darum geht, die Parameter eines konkreten Kreditverhältnisses abzuändern. Ausgangs- und Bezugspunkt müssen ein bei der beratenden Bank unterhaltener, bestehender oder zeitgleich abgeschlossener7 Darlehensvertrag und dessen Bedingungen sein. Der Bezugsbetrag des Zinssatz-Swap-Vertrags muss der zur Rückzahlung ausstehenden Valuta dieses Darlehensvertrags als konnexem Grundgeschäft entsprechen oder darf sie jedenfalls nicht übersteigen. Bei variabel verzinslichen Darlehen muss die Laufzeit des Zinssatz-Swap-Vertrags der des Darlehensvertrags und bei Festzinsdarlehen die Laufzeit des Zinssatz-Swap-Vertrags der der Zinsbindung gleichstehen oder darf sie jedenfalls nicht überschreiten. Die Zahlungspflichten der Bank aus dem Zinssatz-Swap-Vertrag müssen sich mit dem vom Kunden in dem zugeordneten Darlehensvertrag übernommenen variablen oder festen Zins mindestens im Sinne einer partiellen Absicherung gegenläufiger Zinsrisiken8 decken. Die Bank muss jeweils zum gleichen Stichtag entweder den auf denselben Basiswert, etwa einen Referenzzinssatz, bezogenen variablen Zinssatz des Kunden aus dem Darlehensvertrag im Tausch gegen einen festen Zins übernehmen oder dem Kunden den von ihm aus dem Darlehensvertrag geschuldeten Festzins gegen einen variablen Zins zahlen. Die Parteien müssen mithin wirtschaftlich betrachtet zumindest partiell entweder ein variabel verzinsliches Darlehen in ein synthetisches Festzinsdarlehen9 oder ein Festzinsdarlehen in ein synthetisch variabel verzinsliches Darlehen umwandeln10.
Dass die Parteien die Zinssatz-Swap-Verträge in diesem Sinne als konnexe Gegengeschäfte vereinbart hätten, hat das Oberlandesgericht Köln6 nicht festgestellt und die Bank nicht vorgetragen.
Das Oberlandesgericht Köln6 hat festgehalten, der Kundin sei es darum gegangen, ohne Inanspruchnahme weiteren Eigenkapitals die Zinslast aus bestehenden Darlehensverträgen zu „optimieren“. Eine (zumindest partielle) Umwandlung variabel verzinslicher Darlehen in synthetische Festzinsdarlehen oder von Festzinsdarlehen in synthetisch variabel verzinsliche Darlehen hat es nicht festgestellt.
Die Bank hat schon in der Klageerwiderung ausgeführt, die Parteien hätten „vorliegend mit Rücksicht auf die hohe Anzahl relativ niedrigvolumiger Kredite der Kundin ausdrücklich vereinbart, Zinsoptimierungsgeschäfte zunächst auf ein konstantes Nominalvolumen zu beziehen und die Zuordnung auf konkrete Darlehen im Nachgang vorzunehmen“. Die „konkrete Zuordnung der Swapgeschäfte zu bestimmten Krediten“ sei „originäre Aufgabe der Kundin im Rahmen des von ihr betriebenen Schuldenmanagements“ gewesen. Die Bank habe hierzu „in Absprache mit der Kundin lediglich Vorschläge unterbreiten“ können und „dies auch getan“. Dies habe umso mehr gegolten, „als der genaue Kreditbestand und dessen Veränderungen etwa durch vorzeitige Tilgungen etc. allein der Kundin bekannt“ gewesen sei. Die Bank hat mithin selbst nicht behauptet, Ausgangspunkt der Beratungsgespräche zwischen den Parteien sei ein konkretes Kreditgeschäft und dessen Anpassung an wirtschaftliche Veränderungen im Sinne einer Fortschreibung eines Finanzierungskonzepts gewesen. Vielmehr sollten die Swap-Geschäfte (bloß) das wirtschaftliche Leistungsvermögen der Kundin steigern.
Das gilt auch für den „Kündbaren Zahler-Swap“, der in erster Linie dem „Risikoabbau“ eines früheren Swap-Geschäfts diente. Die Parteien haben diesem Zinssatz-Swap-Vertrag im November 2006 nach dem Vorbringen der Bank zwar als Bezugsgröße die auf den 30.01.2014 prognostisch fortgeschriebenen „Rest-Nominalbeträge“ von sechs Darlehensverträgen zugrunde gelegt. Darlehensverträge mit dritten Darlehensgebern scheiden aber nach oben Gesagtem als konnexe Grundgeschäfte aus. Im Übrigen entsprach die von der Bank übernommene Verpflichtung, auf den Bezugsbetrag einen variablen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribors p.a. zu zahlen, keiner der auch untereinander uneinheitlichen festen Zinszahlungspflichten der Kundin aus den Darlehensverträgen.
Rechtsfehlerhaft ist dagegen die Annahme des Oberlandesgerichts Köln6, die Bank habe zur Widerlegung der zugunsten der Kundin streitenden „Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens“ nicht erheblich vorgetragen.
Von seinem Rechtsstandpunkt aus konsequent hat das Oberlandesgericht Köln6 angenommen, die für die Kundin streitende „Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens“ sei nur dann widerlegt, wenn die Bank darlege und beweise, dass die Kundin die Zinssatz-Swap-Verträge auch „gegen die Markterwartung“ abgeschlossen hätte. Damit ist das Oberlandesgericht Köln6 freilich einem hier auch ergebnisrelevanten Rechtsirrtum unterlegen. Klärt die beratende Bank den Kunden nicht darüber auf, dass sie in das mit ihr geschlossene Swap-Geschäft eine Bruttomarge eingepreist hat, muss sie zur Widerlegung der Kausalitätsvermutung darlegen und beweisen, dass der Kunde den Swap-Vertrag auch bei Unterrichtung über das Einpreisen einer Bruttomarge als solcher und über die Höhe des eingepreisten Betrags abgeschlossen hätte. Die beratende Bank muss dagegen nicht widerlegen, dass der Kunde seine Anlageentscheidung von der Art und Weise der Realisierung des Gewinns über Hedging-Geschäfte, also von der anfänglichen Marktbewertung, abhängig gemacht hätte11.
Das Vorbringen der Bank, die für die Kundin verantwortlich Handelnden hätten in Kenntnis des Einpreisens eines anfänglichen negativen Marktwerts als solchem die Zinssatz-Swap-Verträge mit der Bank abgeschlossen, ohne an dessen konkreter Höhe interessiert zu sein, war daher erheblich. Wie die Revision in Übereinstimmung mit § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b ZPO ausführt, wären damit die von der Bank benannten Bediensteten der Kundin einschließlich des früheren Bürgermeisters zu dieser Behauptung zu vernehmen gewesen.
Auch unter einem weiteren Aspekt war der Vortrag der Bank beachtlich: Sofern, wie von ihr behauptet, der frühere Bürgermeister und der Kämmerer der Kundin die Zinssatz-Swap-Geschäfte ohne Rücksicht auf eine eingepreiste Bruttomarge abschlossen, weil sie die Verluste aus früheren Geschäften nicht publik machen wollten, ist, worauf die Revision richtig hinweist, die Kausalitätsvermutung widerlegt. Entsprechendem Vorbringen der Bank hätte das Oberlandesgericht Köln6 mithin nachgehen müssen. Das galt selbst dann, wenn die verantwortlich Handelnden der Kundin solche Erwägungen lediglich deshalb durchgreifen ließen, weil sie durch Aufklärungsmängel der Bank veranlasste Vorgeschäfte wegen der Verjährung schadensersatzrechtlicher Rückabwicklungsansprüche anders nicht mehr hätten auflösen können. Bei der Entscheidung der Frage, ob ein Beratungsfehler hier: das Verschweigen des anfänglichen negativen Marktwerts des Neugeschäfts ursächlich für die Anlageentscheidung geworden ist, kommt es nur darauf an, ob er die Willensentschließung ausschlaggebend beeinflusst hat. Waren andere Motive entscheidend, ist ohne Rücksicht auf deren Entstehungsgrund der Beratungsfehler nicht kausal.
Erfolglos greift die Revision dagegen die Einschätzung des Oberlandesgerichts Köln6 an, die Kundin müsse sich ein Mitverschulden der für sie verantwortlich Handelnden nicht entgegenhalten lassen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann der Informationspflichtige dem Geschädigten grundsätzlich nicht nach § 254 Abs. 1 BGB entgegenhalten, er habe den Angaben nicht vertrauen dürfen und sei deshalb für den entstandenen Schaden mitverantwortlich12. Selbst unterstellt, verantwortlich Handelnde der Kundin hätten Verstöße gegen Haushaltsvorschriften mittels des fortgesetzten Abschlusses von Zinssatz-Swap-Verträgen aus politischem Kalkül überdecken wollen, wäre auch dies kein Aspekt, der nach § 254 Abs. 1 BGB zu berücksichtigen wäre. Er spielt vielmehr, wie oben ausgeführt, ausschließlich bei der Kausalität der Pflichtverletzung eine Rolle.
Wiederum nicht frei von Rechtsfehlern ist das Oberlandesgericht Köln6 davon ausgegangen, die Kundin müsse sich im Wege der Vorteilsausgleichung generell nicht Vorteile anrechnen lassen, die ihr aus anderen mit der Bank geschlossenen Verträgen entstanden seien.
Richtig hat das Oberlandesgericht Köln6 allerdings eine Anrechnung erzielter Vorteile insoweit verneint, als sie die Kundin aus Zinssatz-Swap-Verträgen erlangt hat, deren Abschluss oder Auflösung nicht auf eine fehlerhafte Beratung im Zuge des Abschlusses des „Kündbaren Zahler-Swaps“, des „Digitalen Zinsumfeld-Swaps“ und des „CHF-Plus-Swaps“ zurückzuführen ist. Nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung sind dem Geschädigten diejenigen Vorteile zuzurechnen, die ihm in adäquatem Zusammenhang mit dem Schadensereignis zufließen. Ist Schadensereignis eine Beratungspflichtverletzung anlässlich des Abschlusses konkreter Swap-Geschäfte, können Vorteile, die aus zu anderen Zeiten geschlossenen Swap-Verträgen aufgrund einer gesonderten Beratung resultieren, schon mangels Nämlichkeit des Schadensereignisses im Wege der Vorteilsausgleichung keine Berücksichtigung finden. Daran ändert auch die Gleichartigkeit der Pflichtverletzung nichts13.
Eine Vorteilsausgleichung in Höhe des negativen Ablösungswerts von Altverträgen im Zeitpunkt ihrer Auflösung kam aber, was das Oberlandesgericht Köln6 übersehen hat, in Betracht, soweit die Kundin aufgrund der von ihr als fehlerhaft gerügten Beratung zugleich mit dem Neuabschluss streitgegenständlicher Zinssatz-Swap-Verträge andere, für sie nachteilig verlaufene ältere Geschäfte im Einverständnis mit der Bank beendete.
Zwar verhielt sich die Kundin unterstellt, die zu ihren Gunsten streitende Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens war nicht widerlegt nicht widersprüchlich, wenn sie nur die Rückgängigmachung der jeweils neuen Geschäfte verlangte. In diesem Fall fand auch § 139 BGB keine Anwendung. Das Rückgängigmachen der neuen Verträge führte mithin nicht ohne weiteres zur Aufhebung der Auflösungsverträge, was zur Folge gehabt hätte, dass der Kundin ein anrechenbarer Vorteil dauerhaft nicht verblieben wäre14.
Der der Kundin aus der Auflösung nachteiliger Altgeschäfte erwachsene Vorteil war aber unter bestimmten Bedingungen, deren Vorhandensein das Oberlandesgericht Köln6 nicht rechtsfehlerfrei ausgeschlossen hat, im Wege der Vorteilsausgleichung von Amts wegen anzurechnen.
Nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung dürfen dem Geschädigten neben einem Ersatzanspruch nicht die Vorteile verbleiben, die ihm durch das schädigende Ereignis zugeflossen sind15. Solche Vorteile sind schadensmindernd zu berücksichtigen, die in einem adäquatursächlichen Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehen und deren Anrechnung dem Zweck des Schadensersatzes entspricht sowie weder den Geschädigten unzumutbar belastet noch den Schädiger unbillig entlastet16. Derartige Vorteile können auch in der Vermeidung anderweitiger Verluste liegen, die der Geschädigte ohne das schadenstiftende Ereignis erlitten hätte17. Verursacht der Aufklärungsmangel äquivalent- und adäquatkausal den Abschluss eines günstigen weiteren Geschäfts mit dem Schädiger, das in innerem Zusammenhang mit dem im Wege des Schadensersatzes rückabzuwickelnden Geschäft steht, kann sich daraus ein vom Schädiger darzulegender und zu beweisender18 anrechenbarer Vorteil ergeben.
In Anwendung dieser Grundsätze kann ein Vorteil anzurechnen sein, der daraus resultiert, dass der geschädigte Anleger aufgrund eines auf dem nämlichen Beratungsfehler beruhenden Willensentschlusses zugleich mit dem und wegen des Abschlusses eines (neuen) Zinssatz-Swap-Vertrags, bei dem er nicht über das Einpreisen eines anfänglichen negativen Marktwerts unterrichtet worden ist, einen anderen ihm nachteiligen Swap-Vertrag ablöst. Dieser Vorteil ist vom Anleger äquivalent- und adäquatkausal erlangt. Die Vorteilsausgleichung führt, sofern nicht schon der Abschluss des abgelösten Swap-Vertrags auf einer pflichtwidrigen Willensbeeinflussung des Anlegers beruhte, weder zu einer unzumutbaren Belastung des Anlegers noch zu einer unbilligen Entlastung der beratenden Bank.
Unter Wertungsgesichtspunkten anders zu entscheiden ist freilich dann, wenn, was nach allgemeinen Grundsätzen darzulegen und zu beweisen ist, der Anleger schon zum Abschluss des Altgeschäfts durch eine schuldhafte Pflichtverletzung der beratenden Bank veranlasst worden ist. Kompensiert der Schädiger mittels der Auflösung eines solchen Altgeschäfts der Sache nach einen in Bezug auf dieses Geschäft bestehenden Schadensersatzanspruch, liegt bei wertender Betrachtung kein anrechnungsfähiger Vorteil vor. Der Schädiger schafft nur wieder den Zustand, den herzustellen der Geschädigte von ihm beanspruchen konnte. Das gilt gemäß dem § 214 Abs. 2 Satz 1 BGB zugrundeliegenden Rechtsgedanken auch, wenn der Geschädigte bei der Ablösung des Altgeschäfts einen darauf bezogenen Anspruch auf Rückgängigmachung des Vertrags wegen Verjährung nicht mehr hätte durchsetzen können.
Rechtsfehlerhaft ist schließlich die Annahme des Oberlandesgerichts Köln6, die Bank könne der Kundin, soweit sie beantrage festzustellen, aus dem „Kündbaren Zahler-Swap“ nichts zu schulden, die Einrede der Verjährung nicht entgegenhalten, weil die Kundin sich auf § 215 BGB berufen könne.
Richtig ist allerdings der Ausgangspunkt des Oberlandesgerichts Köln6, § 37a WpHG aF finde sachlich auf im Jahr 2006 zu Anlagezwecken getätigte Swap-Geschäfte Anwendung. Schon nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpHG in der zwischen dem 30.10.2004 und dem 19.01.2007 geltenden Fassung (künftig: aF) waren zu Spekulationszwecken geschlossene Zinssatz-Swap-Verträge Derivate im Sinne der Begriffsbestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes und damit Finanzinstrumente gemäß § 2 Abs. 2b Satz 1 WpHG aF. Die Beratung bei der Anlage in solche Swap-Geschäfte war Wertpapiernebendienstleistung gemäß § 2 Abs. 3a Nr. 3 WpHG aF19. Eine Pflichtverletzung bei der Beratung unterfiel dem Anwendungsbereich des § 37a WpHG aF.
Von Rechtsfehlern beeinflusst ist aber die Annahme des Oberlandesgerichts Köln6, die Kundin könne sich gegen die Einrede der Bank, Schadensersatzansprüche seien verjährt, auf § 215 BGB berufen.
Die Kundin, die auf §§ 242, 249 Abs. 1 BGB verweist, macht ihrerseits eine unselbständige Einwendung geltend, die mit dem Anspruch verjährt, aus dem sie abgeleitet wird. Dieser Anspruch lautet auf Vertragsaufhebung nach Maßgabe der § 280 Abs. 1, § 249 Abs. 1 BGB. Ist Grund des Leistungsverweigerungsrechts der Kundin der Umstand, dass der Bank ein schutzwürdiges Interesse an der Leistung auf die Verpflichtung aus den Zinssatz-Swap-Verträgen fehlt, weil sie zur alsbaldigen Rückgewähr verpflichtet ist, steht hinter dem Einwand aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB also der Gedanke der Prozessökonomie, entfällt die Rechtfertigung der Einwendung, wenn ein zweiter Prozess auf Rückgewähr im Hinblick auf § 214 Abs. 1 BGB erfolgreich nicht mehr durchgeführt werden könnte20. Das ist der Fall, wenn der Anspruch auf Vertragsaufhebung, aus dem die unselbständige Einwendung der Kundin abgeleitet wird, selbst verjährt ist.
Eine Regelung, die den Einwand aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB über den Ablauf der Verjährung des zugrundeliegenden Anspruchs aufrecht erhielte, existiert, wie der Bundesgerichtshof nach Erlass des Berufungsurteils klargestellt hat, nicht. § 215 BGB ist nach seinem Wortlaut nicht anwendbar, weil der Einwand der Kundin, die Bank habe sie aufgrund der von ihr behaupteten Beratungspflichtverletzung so zu stellen, als sei der „Kündbare Zahler-Swap“ nicht zustande gekommen, keine Aufrechnung mit einem gleichartigen Gegenanspruch beinhaltet. In der Einwendung der Kundin liegt auch nicht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts im Sinne des § 215 BGB, weil Leistungen aus dem „Kündbaren Zahler-Swap“ das Bestehen eines Anspruchs der Kundin auf Vertragsaufhebung nach Maßgabe der § 280 Abs. 1, § 249 Abs. 1 BGB unterstellt gerade nicht Zug um Zug gegen die Vertragsaufhebung zu erfüllen wären. Ebenfalls zugunsten der Kundin weder direkt noch analog anwendbar sind die §§ 821, 853 BGB21.
Für das weitere Verfahren weist der Bundesgerichtshof auf folgendes hin: Das Festhalten an wirtschaftlich günstigen Verträgen in Kenntnis des Umstands, dass die Bank einen anfänglichen negativen Marktwert eingepreist hat, kann ein Indiz dafür sein, dass sich der Beratungsfehler auf den Anlageentschluss nicht ursächlich ausgewirkt hat22. Entsprechend wird das Oberlandesgericht Köln6 nicht nur zu erwägen haben, ob das Festhalten der Kundin an sonst günstig verlaufenen Swap-Geschäften die Kausalitätsvermutung widerlegt. Es wird auch zu prüfen haben, ob das Beharren auf den zusammen mit streitgegenständlichen Zinssatz-Swap-Geschäften geschlossenen Auflösungsverträgen gegebenenfalls in der Zusammenschau mit weiteren Umständen dafür spricht, die Kundin hätte das Einpreisen einer Bruttomarge wegen der mit den Auflösungsverträgen verbundenen Vorteile hingenommen.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 22. März 2016 – XI ZR 425/14
- Fortführung von BGH, Urteile vom 22.03.2011 – XI ZR 33/10, BGHZ 189, 13 Rn. 26; und vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 42[↩]
- BGH, Urteile vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93, BGHZ 123, 126, 128; vom 22.03.2011 – XI ZR 33/10, BGHZ 189, 13 Rn.19; und vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 23[↩]
- OLG Köln, Urteil vom 13.08.2014 – 13 U 128/13, BeckRS 2014, 17035[↩]
- BGH, Urteile vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 30 ff.; und vom 20.01.2015 – XI ZR 316/13, WM 2015, 575 Rn. 33 ff.[↩]
- BGH, Urteile vom 22.03.2011 – XI ZR 33/10, BGHZ 189, 13 Rn. 31 ff.; vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 33 ff.; und vom 20.01.2015 – XI ZR 316/13, WM 2015, 575 Rn. 31[↩]
- OLG Köln, aaO[↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩]
- Meuschke, AG 2013, R 25[↩]
- BGH, Urteil vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 43[↩]
- vgl. Endler in Zerey, Finanzderivate, 4. Aufl., Kap. 30 Rn. 25 ff.; Hinrichs, AG 2013, R 4; Lederer, AG 2013, R 319 f.; Meuschke, AG 2012, R 157; Stupp/Mucke, BKR 2005, 20, 25 f.[↩]
- vgl. Bausch, WM 2016, 247, 252 f.; Kewenig/Schneider, WM Sonderbeil. 2/1992, S. 10; für ein weiteres Verständnis des Begriffs der Konnexität dagegen Clouth in Grüneberg/Habersack/Mülbert/Wittig, Bankrechtstag 2015, S. 163, 179 ff.; Cramer/Lang/Schulz, BKR 2015, 380, 382; Ludwig/Clouth, NZG 2015, 1369, 1375; Kräft, GWR 2015, 323; in anderem rechtlichen Kontext auch Bücker, Finanzinnovationen und kommunale Schuldenwirtschaft, 1993, S. 122 ff.[↩]
- BGH, Urteil vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 44[↩]
- BGH, Urteil vom 22.03.2011 – XI ZR 33/10, BGHZ 189, 13 Rn. 41[↩]
- BGH, Urteil vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 85 mwN[↩]
- zur Unanwendbarkeit des § 139 BGB vgl. Geibel, Der Kapitalanlegerschaden, 2002, S. 249[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 85; vom 13.11.2012 – XI ZR 334/11, WM 2013, 24 Rn. 21; und vom 23.06.2015 – XI ZR 536/14, WM 2015, 1461 Rn. 22 mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 28.01.2014 – XI ZR 42/13, BKR 2014, 247 Rn. 15[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 23.06.1992 – XI ZR 247/91, WM 1992, 1599, 1600[↩]
- BGH, Urteil vom 23.06.1992 aaO[↩]
- vgl. nur KölnKommWpHG/Versteegen, 2007, § 2 Rn. 51[↩]
- BGH, Urteil vom 28.04.2015 – XI ZR 378/13, BGHZ 205, 117 Rn. 48[↩]
- BGH, Urteil vom 28.04.2015 – XI ZR 378/15, BGHZ 205, 117 Rn. 49 f. mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 08.05.2012 – XI ZR 262/10, BGHZ 193, 159 Rn. 50; vom 28.04.2015 – XI ZR 378/15, BGHZ 205, 117 Rn. 81; und vom 15.07.2014 – XI ZR 418/13, WM 2014, 1670 Rn. 29[↩]