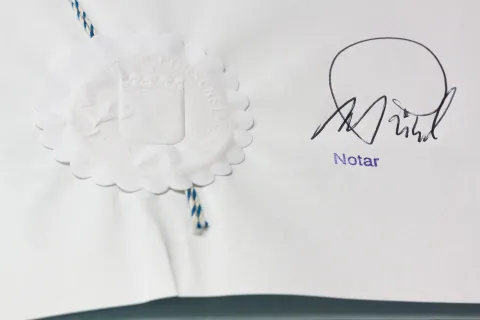Die Verjährung des Rückgewähranspruchs nach § 143 Abs. 1 Satz 1 InsO richtet sich nach den Regelungen über die regelmäßige Verjährung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 146 Abs. 1 InsO; Art. 229 § 12 Abs. 1, § 6 Abs. 1 EGBGB).

Die dreijährige Regelfrist des § 195 BGB beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB frühestens mit dem Schluss desjenigen Jahres, in dem der Rückgewähranspruch entstanden ist. Dieser Anspruch entstand mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens1. Denn vorher kann der Anspruch nicht als ein Recht der Insolvenzmasse entstehen. Wegen des Eröffnungszeitpunkts ist auf den im Eröffnungsbeschluss bezeichneten Tag (vgl. § 27 Abs. 2 Nr. 3 oder Abs. 3 InsO) abzustellen2.
Erlangt der Insolvenzverwalter als die Anfechtung ausübender Gläubiger Kenntnis im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB vom tatsächlichen Vorliegen der Anfechtungsvoraussetzungen und von der Person des Anfechtungsgegners erst nach dem Eröffnungsbeschluss, so beginnt die Frist erst mit dem Jahresende ab Kenntniserlangung. Der Kenntnis steht die grob fahrlässige Unkenntnis der tatsächlichen Anfechtungsvoraussetzungen gleich. Sie setzt eine besonders schwere, auch subjektiv vorwerfbare Vernachlässigung der Ermittlungspflichten des Insolvenzverwalters voraus. Grobe Fahrlässigkeit kann insbesondere vorliegen, wenn der Verwalter einem sich aufdrängenden Verdacht nicht nachgeht oder auf der Hand liegende, Erfolg versprechende Erkenntnismöglichkeiten nicht ausnutzt oder sich die Kenntnis in zumutbarer Weise ohne nennenswerte Mühen und Kosten beschaffen könnte3.
Der (neue) Insolvenzverwalter kann frühestens mit seiner Bestellung im Juni 2008 Kenntnis vom tatsächlichen Vorliegen der Anfechtungsvoraussetzungen und von der Person des Anfechtungsgegners erlangt haben. Auf die Kenntnis des neuen Insolvenzverwalters kann es aber erst von dem Zeitpunkt seiner Bestellung ankommen. Vorher ist auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis des früheren Verwalters abzustellen.
Im Falle des Gläubigerwechsels durch Abtretung (§ 398 BGB), Legalzession (§ 412 BGB) oder Gesamtrechtsnachfolge muss sich der neue Gläubiger – entsprechend § 404 BGB – die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des alten Gläubigers zurechnen lassen4. Nichts Anderes kann für den Wechsel des Verwalters gelten. Denn so wie die Rechtshandlungen des entlassenen Verwalters, abgesehen von nichtigen Handlungen, ihre Wirksamkeit behalten5, setzt seine Kenntnis und seine grob fahrlässige Unkenntnis von bestehenden Anfechtungsansprüchen die Verjährungsfrist in Gang.
Es wird allenfalls erörtert, ob bei einem Verwalterwechsel über § 146 Abs. 1 InsO § 210 BGB analog zur Anwendung kommt, mit der Folge, dass Anfechtungsansprüche frühestens sechs Monate seit Bestellung des neuen Verwalters verjähren können6. Nach dieser Regelung wird der Lauf der Verjährung jedoch nur beeinflusst, wenn der Wechsel des Verwalters während der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist erfolgt7.
Als derjenige, dem die Einrede der Verjährung zugutekommt, ist der Anfechtungsgegner für die dafür maßgeblichen Tatsachen darlegungs- und beweispflichtig. Ihm obliegt es, die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis seines Gläubigers von den in § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB genannten Voraussetzungen darzutun. Er muss also Umstände dartun und gegebenenfalls beweisen, aus denen folgt, dass der zunächst bestellte Insolvenzverwalter von dem Anfechtungsanspruch bis Ende des Jahres 2007 erfahren hat oder sich einem sorgfältig arbeitenden Insolvenzverwalter der Schluss auf einen Anspruch und auf die Person des Schuldners hätte aufdrängen müssen. Allerdings obliegt es dem Insolvenzverwalter, soweit es um Umstände aus seiner Sphäre geht, an der Sachaufklärung mitzuwirken. Er hat deswegen die Umstände darzulegen, die ihn an der Erkenntnis gehindert haben, dass ihm ein Anspruch zusteht. Gleiches gilt für das, was er zur Ermittlung der Voraussetzungen seines Anspruchs getan hat8.
Die Mitwirkungspflichten des neuen Insolvenzverwalters Insolvenzverwalters erstrecken sich allerdings nur eingeschränkt auf die Zeit der Verwaltung durch den Amtsvorgänger. Im Rahmen des § 138 Abs. 4 ZPO ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass eine Partei auf die Kenntnisse ihres früheren gesetzlichen Vertreters nicht verwiesen werden kann9, weil das Wissen ihr durch das Ausscheiden des Organmitglieds gleichsam verloren gegangen ist10. Nichts anderes kann im Verhältnis vom Insolvenzverwalter zu seinem Amtsvorgänger gelten. Doch muss der Insolvenzverwalter immerhin vortragen, welche Kenntnisse zu den Anfechtungsansprüchen sein Amtsvorgänger ihm übermittelt hat und wie der Bearbeitungsstand der Anfechtungsansprüche war, als er das Amt übernommen hat11.
Bundesgerichtshof, Versä, umnisurteil vom 30. April 2015 – IX ZR 1/13
- BGH, Beschluss vom 24.03.2011 – IX ZB 36/09, NZI 2011, 323 Rn. 6; vom 06.12 2012 – IX ZB 84/12, NZI 2013, 147 Rn. 6; vom 07.02.2013 – IX ZB 286/11, NZI 2013, 393 Rn. 12[↩]
- MünchKomm-InsO/Kirchhof, 3. Aufl., § 146 Rn. 8[↩]
- MünchKomm-InsO/Kirchhof, 3. Aufl., § 146 Rn. 8b[↩]
- BGH, Urteil vom 17.10.1995 – VI ZR 246/94, NJW 1996, 117, 118; vom 24.04.2014 – III ZR 156/13, NJW 2014, 2345 Rn. 25; vom 30.04.2014 – IV ZR 30/13, NJW 2014, 2492 Rn. 13[↩]
- HK-InsO/Riedel, 7. Aufl., § 59 Rn. 12[↩]
- MünchKomm-InsO/Kirchhof, 3. Aufl., § 146 Rn. 24; Nerlich in Nerlich/Römermann, InsO, 2014, § 146 Rn. 7; HmbKomm-InsO/Rogge/Leptien, 5. Aufl., § 146 Rn. 5 aE; Uhlenbruck/Hirte, InsO, 13. Aufl., § 146 Rn. 8[↩]
- vgl. MünchKomm-BGB/Grothe, 6. Aufl., § 210 Rn. 6[↩]
- vgl. MünchKomm-BGB/Grothe, 6. Aufl., § 199 Rn. 42[↩]
- BGH, Urteil vom 09.07.1987 – III ZR 229/85, WM 1987, 1125, 1126[↩]
- Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO, 4. Aufl., § 138 Rn. 43[↩]
- vgl. Wieczorek/Schütze/Gerken, aaO[↩]