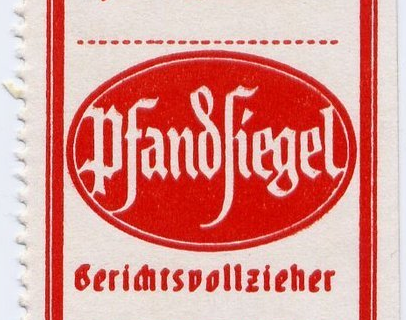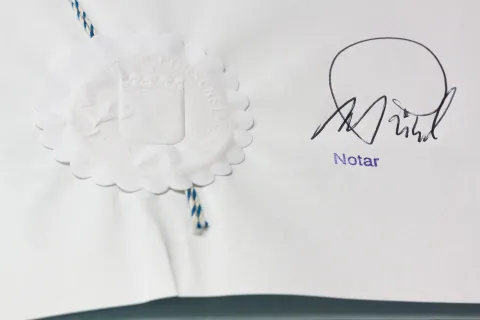Wird eine Lebensversicherung – um Pfändungsschutz nach § 851 c ZPO zu erlangen – vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens umgewandelt, kann die Umwandlung nicht nach den Vorschriften der Insolvenzordnung (§§ 129 ff InsO) angefochten werden.

Mit diesem Urteil hat das Oberlandesgericht Stuttgart die Klage eines Insolvenzverwalters abgewiesen. Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen von R. R., der am 29.11.2007 beim zuständigen Amtsgericht selbst Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellte.Mit Beschluss vom 18.12.2007 eröffnete das Gericht das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Insolvenzschuldners Der Insolvenzschuldner hatte bei der Beklagten einen Lebensversicherungsvertrag abgeschlossen, den er noch vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens zum Pfändungsschutz umwandeln ließ. Auf die Kündigung des Insolvenzverwalters hin hat sich die Beklagte geweigert, den Rückkaufswert auszuzahlen. Die daraufhinein gereichte Klage hat das Landgericht abgewiesen. Mit seiner Berufung verfolgt der Kläger sein erstinstanzliches Ziel weiter.
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts ist der Kläger schon nicht aktivlegitimiert, die Zahlung des geltend gemachten Geldbetrags zur Insolvenzmasse zu verlangen.
Da der streitgegenständliche Lebensversicherungsvertrag zum 31.12.2007 bereits bestanden hat, ist die Rechtslage anhand der bis zum 31.12.2007 geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen (Art. 1 Abs. 1 EGVVG).
Die aus dem streitgegenständlichen Lebensversicherungsvertrag fließenden Rechte unterliegen nicht der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Klägers. Sie gehören nicht zur Insolvenzmasse i.S.v. § 35 Abs. 1 InsO, weil sie spätestens ab 31.12.2007, 24 Uhr, unpfändbares Vermögen i.S.v. § 36 Abs. 1 InsO i.V.m. § 851 c ZPO darstellten.
Dies ergibt sich daraus, dass zu dem genannten Zeitpunkt die Umwandlung des bisherigen Lebensversicherungsvertrags in einen pfändungsgeschützten Versicherungsvertrag i.S.v. § 851 c Abs. 1 ZPO erfolgte.
Gemäß § 173 VVG in der bis zum 31.12.2007 geltenden Fassung (im Folgenden: „VVG a. F.“) war der Insolvenzschuldner berechtigt, jederzeit eine solche Umwandlung zu verlangen. Dieses Recht hat er über seinen Rechtsanwalt im Schreiben vom 13.11.2007 wirksam ausgeübt.
Einer Entscheidung, ob es sich hierbei um die Ausübung eines Gestaltungsrechts oder um das Angebot auf Abschluss eines Änderungsvertrags handelt, bedarf es vorliegend nicht. Im erstgenannten Falle hätte bereits die Ausübung des Gestaltungsrechts die Umwandlung des Versicherungsvertrags in eine pfändungsgeschützte Rentenversicherung i.S.v. § 851 c Abs. 1 ZPO herbeigeführt; im zweitgenannten Falle wäre die Umwandlung erst durch die unstreitig am 26.11.2007 erklärte Annahme des Angebots auf Vertragsänderung seitens der Beklagten erfolgt.
Im einen wie im anderen Falle wären damit sämtliche rechtsgeschäftlichen Voraussetzungen für die Umwandlung der Lebens- in eine pfändungsgeschützte Rentenversicherung zu einem Zeitpunkt abgeschlossen gewesen, als der Insolvenzschuldner noch bezüglich seines gesamten Vermögens voll umfänglich verfügungs- und verwaltungsbefugt war und sein Vermögen noch nicht dem Insolvenzbeschlag unterlag.
Dass die Rechtswirkungen des vorgenommenen Rechtsgeschäfts – sei es in der Form eines Gestaltungsrechts, sei es in der Form eines Änderungsvertrags – kraft Gesetzes zum Schluss der Versicherungsperiode eintraten, vorliegend also mit Ablauf des 31.12.2007, konnte weder durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 08.12.2007 noch durch die zeitlich davor liegende vorläufige Insolvenzverwaltung zum 30.11.2007 gehindert werden.
Zwar hat der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 25.11.20101 unter Bezugnahme auf die Gesetzesbegründung2 klargestellt, dass der Pfändungsschutz des § 851 c Abs. 1 ZPO erst dann eingreife, wenn dessen sämtliche tatbestandlichen Voraussetzungen vorlägen, andererseits der Pfändungsschutz des § 851 c Abs. 1 ZPO dann nicht eingreifen könne, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem erstmals sämtliche Voraussetzungen des § 851 c Abs. 1 ZPO vorlägen, Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis bereits gepfändet seien.
Für den Fall der endgültigen Widmung von Versicherungsleistungen für die Altersversorgung gemäß § 167 VVG (inhaltsgleich mit dem vorliegend in Rede stehenden § 173 VVG a. F.) hat der Bundesgerichtshof jedoch zugleich klargestellt, dass dieses Hindernis nicht bestehe, wenn die Wirkung der Umwandlung erst ab einem späteren Zeitpunkt eintrete, sofern der Eintritt der Umwandlung aufgrund der Vertragslage bereits feststehe. So liegt der Fall hier: Wie bereits oben ausgeführt, waren sämtliche für die Umwandlung erforderlichen rechtsgeschäftlichen Erklärungen sowohl im Zeitpunkt der Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung als auch der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits unwiderruflich abgegeben, so dass der Eintritt der Umwandlungswirkung allein eine Frage des Zeitablaufs war.
Die Voraussetzung gemäß § 851 c Abs. 1 Nr. 2 ZPO für die Umwandlung in eine pfändungsgeschützte Versicherung ergibt sich aus dem Schreiben der Rechtsanwälte des Insolvenzschuldners vom 13.11.2007. Dort hat der Insolvenzschuldner den erforderlichen unwiderruflichen Verzicht auf Verfügungen über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag, insbesondere durch Kündigung, Abtretung, Beleihung oder Verpfändung, erklärt. Einer Annahme dieses Verzichts bedurfte es nicht, weil es nicht um den Abschluss eines Erlassvertrags bezüglich einer Schuld geht, sondern um die Erklärung, Verfügungsbefugnisse nicht mehr innehaben bzw. ausüben zu wollen. Ähnlich einer Ermächtigung gem. § 185 BGB handelt es sich bei einem solchen Verzicht um eine lediglich empfangsbedürftige einseitige Willenserklärung.
Einem solchen Verzicht steht § 178 Abs. 1 VVG a. F. nicht entgegen. Zwar normierte § 165 Abs.1, 2 VVG a. F., dass Kündigungsrechte nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen werden können. Abgesehen davon, dass vorliegend nicht eine Abbedingung der Kündigungsrechte durch Vereinbarung in Rede steht, sondern ein einseitiger Verzicht hierauf, normierte § 165 Abs. 3 VVG a. F. eine Ausnahme von der grundsätzlichen Kündigungsmöglichkeit gerade für pfändungsgeschützte Versicherungen.
Dass die übrigen Voraussetzungen des Pfändungsschutzes gemäß § 851 c Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3 u. 4 ZPO gegeben sind, ist zwischen den Parteien außer Streit.
Der durch die Umwandlungserklärung bzw. den abgeschlossenen Umwandlungsvertrag bewirkte Pfändungsschutz gemäß § 851 c Abs. 2 ZPO erfasst entgegen der Auffassung des Klägers nicht nur etwaige nach dem Umwandlungsbegehren neu angesparte Teile des Deckungskapitals, sondern auch den bereits zuvor angesparten Kapitalstock. Dies ergibt sich aus dem Schutzzweck des Pfändungsschutzes gemäß § 851 c ZPO. Es geht darum, dem Schuldner Mittel für eine angemessene, selbstverantwortete Altersversorgung zu belassen und vor dem Pfändungszugriff seiner Gläubiger zu schützen. Nach der Gesetzesbegründung zielen die Regelungen des § 851 c ZPO u. a. darauf ab, durch den Schutz von Vermögenswerten, die der privaten Sicherung der Altersvorsorge dienen, eine vollstreckungsrechtliche Ungleichbehandlung gegenüber öffentlich-rechtlichen Renten- oder Versorgungsleistungen zu beseitigen und Selbständigen, die anders als Arbeitnehmer oder Beamte keine öffentlich-rechtlichen Rentenleistungen beziehen, vor dem Hintergrund verfassungsrechtlicher Wertentscheidungen den Erhalt existenzsichernder Einkünfte im Alter oder bei der Berufsunfähigkeit zu sichern. Zugleich soll damit der Staat dauerhaft von Sozialleistungen entlastet werden3.
Bereits diese Zielsetzung widerspricht der Auffassung des Klägers, dem Pfändungsschutz könnten nur die in der Zeit nach der Umwandlung angesparten Anteile des Deckungskapitals unterfallen. Wäre dies der Fall, könnte die gesetzgeberische Zielsetzung für ältere Selbstständige kurz vor Erreichen der Altersgrenze nicht mehr verwirklicht werden. Die bis dahin angesparten Deckungskapitalanteile unterlägen nicht dem Pfändungsschutz, könnten also dem älteren Selbständigen gerade entgegen der Zielsetzung des Gesetzes doch im Wege der Pfändung entzogen werden, während umgekehrt die pfändungsgeschützten Anteile des neu angesparten Deckungskapitals nicht dazu ausreichen könnten, eine wirksame Mindestaltersversorgung sicherzustellen. Dass der Gesetzgeber solches gewollt hat, lässt sich der Gesetzesbegründung nicht entnehmen; die ausdrücklich angesprochene Angleichung der Altersversorgung von Selbständigen außerhalb der gesetzlichen Sicherungssysteme herbeizuführen, würde damit nachhaltig behindert.
Folgerichtig differenziert der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung4 bei der Frage, ab welchem Zeitpunkt der Pfändungsschutz von § 851 c Abs. 1 ZPO eingreife, nicht danach, ob das Deckungskapital vor oder nach der Umwandlung angesammelt wurde. Er stellt vielmehr allein darauf ab, ab welchem Zeitpunkt der Altervorsorgecharakter des Vertrages gesichert sei, nämlich dann, wenn die Vertragslage so gestaltet werde, dass der Schuldner Vermögenswerte nicht mehr zweckwidrig dem Gläubigerzugriff entziehen könne. Die Sicherung bereits angesparten Deckungskapitals für die Zwecke der Altersversorgung des Schuldners einerseits und der effektiven Unterbindung von Möglichkeiten, diese Mittel zweckwidrig dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen, ist gerade bei einem bereits angesparten erheblichen Deckungskapitals von weit größerer Bedeutung als die Sicherung des erst künftig anzusparenden Kapitalstocks. Dies gilt umso mehr, als der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 18.01.20075 ausdrücklich klargestellt hat, nur das angesammelte Kapital unterliege dem Pfändungsschutz, nicht jedoch die liquiden Mittel, um diese Kapitalansammlung zu bewirken. Gerade in Fällen wie dem vorliegenden, in denen ein schon im fortgeschrittenen Alter befindlicher Versicherungsnehmer erst in der Krise oder kurz zuvor eine Umwandlung vornimmt, würde die Auffassung, nur die künftigen angesammelten Deckungskapitalanteile würden am Pfändungsschutz teilnehmen, diesen praktisch leerlaufen lassen. Dies ist vom Gesetzgeber ersichtlich nicht gewollt.
Den Zielsetzungen des Gesetzgebers wird vielmehr allein die Auslegung des § 173 VVG a. F. gerecht, wonach die Umwandlung in den durch § 851 c Abs. 2 ZPO gezogenen Betragsgrenzen Pfändungsschutz auch für den Kapitalstock bietet, der bis zum Wirksamwerden der Umwandlung bereits gebildet war.
Der Kläger kann sich nicht darauf berufen, dass Pfändungsschutz gemäß § 851 c Abs. 1 ZPO nach dem Willen des Gesetzgebers6 nur bestehen soll, wenn Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis nicht bereits gepfändet sind, der Insolvenzbeschlag einer Pfändung gleichstehe und mit Anordnung vorläufiger Insolvenzverwaltung, spätestens jedoch mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 18.12.2007 zu einem Zeitpunkt eingetreten sei, zu dem der Pfändungsschutz noch nicht eingegriffen habe, weil er erst zum Ende der Versicherungsperiode, mithin zum 31.12.2007, 24 Uhr, entstehen konnte.
Nach der Regelung des § 173 VVG a. F. (jetzt § 167 VVG) stehen diese Erwägungen der Annahme von Pfändungsschutz gemäß § 851 c Abs. 1 ZPO dann nicht entgegen, wenn die Endgültigkeit der Widmung der Versicherungsleistungen für die Altersversorgung des Schuldners aufgrund der Vertragslage bereits im Zeitpunkt der Pfändung feststehen, wenn auch ggf. mit Wirkung erst ab einem späteren Zeitpunkt7. Maßgebend für die Gewährung von Vollstreckungsschutz nach § 851 c Abs. 1 ZPO sei vielmehr, ob auch unter Berücksichtigung solcher vertraglicher Regelungen in ihrer konkreten Ausgestaltung im Zeitpunkt der Pfändung sichergestellt sei, dass die Altersvorsorgefunktion der vertraglichen Leistungen gewährleistet ist8.
Dieser überzeugenden Begründung schließt sich das Oberlandesgericht Stuttgart an. Wie bereits oben ausgeführt, liegen diese Voraussetzungen vor. Im Zeitpunkt der unwiderruflichen Widmung des bereits gebildeten Deckungskapitals zur Altersvorsorge hatte der Insolvenzschuldner noch volle Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis über sein gesamtes Vermögen.
Der Kläger kann den begehrten Geldbetrag auch deshalb nicht zur Insolvenzmasse ziehen, weil der Rückkaufswert aus der streitgegenständlichen Lebensversicherung nicht zur Zahlung fällig gestellt ist. Dies würde nämlich die Wirksamkeit der vom Kläger in seinem Schriftsatz vom 04.02.2008 erklärten Kündigung voraussetzen. Wie oben dargelegt, hatte der Insolvenzschuldner jedoch zu einem früheren Zeitpunkt bereits wirksam auf das Kündigungsrecht verzichtet. Das Kündigungsrecht konnte in der Hand des Klägers nicht neu entstehen.
Der Pfändungsschutz kann durch insolvenz-rechtliche Anfechtung nicht mehr beseitigt werden.
Die Anfechtungstatbestände der §§ 130, 131 InsO greifen nicht ein. Die Umwandlung der bisherigen Lebensversicherung in eine pfändungsgeschützte Rentenversicherung gewährt keinem Insolvenzgläubiger, insbesondere nicht der Beklagten, eine Sicherung oder Befriedigung. Die Wirkung der Umwandlung besteht allein in der Begründung von Pfändungsschutz zu Gunsten des Insolvenzschuldners. Vorteile für irgendeinen Insolvenzgläubiger, wie sie die §§ 130, 131 InsO voraussetzen, sind damit nicht verbunden.
Auch der Tatbestand des § 134 InsO ist nicht gegeben. Als unentgeltliche Leistung i.S.d. genannten Vorschrift könnte nur der infolge der Umwandlung entstehende Pfändungsschutz in Betracht gezogen werden. Dieser kommt allein dem Insolvenzschuldner selbst zugute. Der (künftige) Insolvenzschuldner kann jedoch keine unentgeltliche Leistung an sich selbst erbringen9.
Die Anfechtungstatbestände der §§ 132 Abs. 1, 133 Abs. 1 InsO könnten eingreifen, weil den (künftigen) Insolvenzgläubigern durch die Umwandlung der Lebensversicherung deren Rückkaufswert entzogen worden ist. Sie setzen jedoch jeweils voraus, dass eine andere Person durch die Rechtshandlung eine Vermögenszuwendung erhalten hat10. Weiter setzt § 143 Abs. 1 InsO voraus, dass ein Vermögensgegenstand aus dem Vermögen des Schuldners veräußert, weggegeben oder aufgegeben worden ist11. An beidem fehlt es vorliegend.Gegner eines solchen Insolvenzanfechtungsanspruchs wäre der Insolvenzschuldner selbst, weil der zurückzugewährende „Gegenstand“ der erlangte Pfändungsschutz wäre, der wiederum keinen Vermögensabfluss aus dem Vermögen des Insolvenzschuldners beinhaltet.
Im Übrigen fehlt es auch an einer schlüssigen Darlegung eines Anfechtungstatbestandes gemäß §§ 132, 133 InsO. Weshalb die Beklagte – was diese bestreitet – Kenntnis von der Krise des Insolvenzschuldner gehabt haben soll, lässt sich dem klägerischen Vorbringen nicht entnehmen, obwohl das Gericht auf diesen Darlegungsmangel in der Verfügung vom 12.10.2011 hingewiesen hat.
Die Umwandlung in eine pfändungsgeschützte Versicherung scheiterte auch nicht aus Gründen der §§ 115, 116 InsO. Ein Kapitallebens- oder Rentenversicherungsvertrag enthält keine Elemente eines Auftrags. Es handelt sich um einen im VVG geregelten, eigenständigen Vertragstyp. Die vom Kläger herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18.1.2007 besagt nichts Gegenteiliges. Dort wird lediglich die Fortführung einer Kreditausfallversicherung entsprechend den Regeln beim Avalkreditvertrag behandelt, soweit sich eine Bank zur Übernahme einer Bürgschaft verpflichtet. Die dortigen Ausführungen beziehen sich nicht auf die versicherungsvertraglichen Rechte, sondern auf die für die Übernahme der Bürgschaft oder sonstigen Besicherung maßgeblichen Grundlagen.
Darüber hinaus würde das in §§ 115, 116 InsO angeordnete Erlöschen solcher Auftragsverhältnisse nur ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die Zukunft wirken. Spätestens mit der Bestätigung der Beklagten vom 26.11.2007, die beantragte Umwandlung vorgenommen zu haben, waren die für die Umwandlung maßgeblichen Rechtsgeschäfte unwiderruflich vollendet und konnten durch den nachfolgenden Insolvenzbeschlag nicht mehr beeinflusst werden. Der sich daran mit Wirkung ab dem 01.01.2008, 0.00 Uhr, anschließende Pfändungsschutz gemäß § 851 c ZPO konnte durch den Insolvenzbeschlag nicht mehr beseitigt werden. Da der Pfändungsschutz – wie ausgeführt – das gesamte bereits gebildete Deckungskapital erfasst und nur dieses vorliegend in Rede steht, kommt es nicht darauf an, ob das Deckungskapital durch weitere Prämienzahlungen erhöht werden kann oder nicht.
Auch der neue Sachvortrag des Klägers im Berufungsrechtszug vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Dem Kläger ist zwar darin zu folgen, dass Pfändungsschutz gemäß § 851 c Abs. 2 ZPO nur in den dort genannten Betragsgrenzen gewährt wird. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass diese Betragsgrenzen vorliegend überstiegen werden. Der streitgegenständliche Lebensversicherungsvertrag wies per 1.2.2008 einen Rückkaufswert von 7.617,40 EUR auf. Er schöpfte damit nicht einmal den Jahresbetrag des Kapitalbetrags aus, den der Insolvenzschuldner im Jahr 2007 hätte pfändungsfrei ansammeln können (vgl. § 851 c Abs. 2 Satz 2 ZPO). Der im Jahr 1949 geborene Insolvenzschuldner vollendete spätestens zum Jahresende 2007 sein 58. Lebensjahr, so dass das pfändungsfrei anzusparende Kapital bis zu 8.000 EUR p. a. betragen durfte.
Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Insolvenzschuldner, der im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung mindestens 57 Jahre war, nach den Regelungen des § 851 c Abs. 2 Satz 2 ZPO insgesamt Ansparbeträge in Höhe von 168.000 EUR hätte pfändungsfrei ansammeln können12.
Selbst wenn berücksichtigt wird, dass der Insolvenzschuldner bei der S. I. zwei weitere Lebensversicherungen unterhielt, die er ebenfalls in pfändungsgeschützte Rentenversicherungen umgewandelt hatte, lässt sich dem klägerischen Vortrag nicht entnehmen, dass die Gesamtheit aller ansparten Beträge den pfändungsgeschützten Höchstbetrag überstiegen hätte.
Nachdem der Insolvenzschuldner als Streithelfer der Beklagten ausdrücklich erklärt hat, die Summe seiner Ansparbeträge in allen von ihm unterhaltenen Lebensversicherungen habe diesen Betrag bei Weitem nicht ausgeschöpft, hätte der Kläger im Rahmen der ihm obliegenden sekundären Darlegungslast substantiiert darstellen müssen, inwieweit diese Behauptung des Klägers unzutreffend sei. Dies wäre dem Kläger auch möglich gewesen, da er im Rahmen seiner Verwaltungstätigkeit die Vorgänge anhand der Versicherungsscheine und der erteilten Jahreskontoauszüge überprüfen konnte. Da er seiner sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen ist, ist der entsprechende Sachvortrag des Streithelfers der Beklagten, der nicht im Widerspruch zum Sachvortrag der Beklagten selbst steht und deshalb zu beachten ist, unstreitig.
Im Ergebnis lässt sich somit nicht erkennen, dass der streitgegenständliche Versicherungsvertrag nicht in Gänze Pfändungsschutz gemäß § 851 c ZPO genießt.
Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung vertieft auf deliktische Ansprüche abgestellt hat, fehlt es im Sachvortrag hierfür an jedem Anhaltspunkt, zumal in den Fällen einer nicht nach insolvenzrechtlichen Tatbeständen anfechtbaren Vermögensverfügung des Insolvenzschuldners solche Ansprüche im Regelfall ausscheiden.
Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 7 U 184/11
- BGH, Beschluss vom 25.11.2010 – VII ZB 5/08, NJW-RR 2011, 493-495[↩]
- in BT-Drucks. 16/886 S. 14[↩]
- vgl. insg. BT-Drucks. 16/886, S. 7[↩]
- BGH, NJW-RR 2011, 493-495[↩]
- BGH, NJW-RR 2007, 848-850[↩]
- BT-Drucks. 16/886, S. 14[↩]
- BGH, NJW-RR 2011, 493-495 Tz. 22[↩]
- BGH aaO Tz. 19[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 13.10.2011 – IX ZR 80/11[↩]
- BGH NJW 2005, 1121-1125, Tz 31[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 13.10.2011 – IX ZR 80/11, Tz. 3[↩]
- vgl. die Anspartabelle bei Riedel, Beck’scher Online-Kommentar, ZPO, Edition 2, Stand 01.10.2011, § 851 c ZPO, Rn. 11[↩]