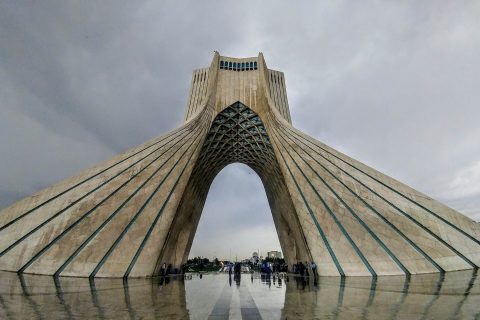Die Richtlinie 2003/61 soll Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) mit dem Ziel bekämpfen, die Integrität der Finanzmärkte zu schützen und das Vertrauen der Anleger zu stärken. Der Gerichtshof der Europäischen Union hatte nun mit der Auslegung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu befassen. Anlass hierzu bot ein Vorabentscheidungsverfahren aus Belgien:

Die Spector Photo Group NV ist eine belgische Gesellschaft. 2003 kaufte sie an der Börse (Euronext Brussels) eine bestimmte Anzahl ihrer eigenen Aktien. Anschließend veröffentlichte sie bestimmte Geschäftsergebnisse und Informationen über ihre Geschäftspolitik. Der Kurs der Aktien soll daraufhin gestiegen sein.
2006 stufte die zuständige nationale Behörde, die CBFA, bestimmte dieser Aufkäufe als Insider-Geschäfte ein und verhängte eine Geldbuße in Höhe von 80 000 € gegen Spector und eine Geldbuße in Höhe von 20 000 € gegen Herrn Van Raemdonck, einen Unternehmensleiter der Spector, die beide gegen diese Entscheidung Klage erhoben. Der mit dieser Klage befasste Hof van beroep te Brussel (Appellationshof Brüssel) fragte daraufhin in einem Vorabentscheidungsersuchen den Gerichtshof der Europäischen Union nach der Bedeutung des Begriffs des Insider-Geschäfts.
Insider-Geschäft – Kenntnis erforderlich?
Der vorlegende Appellationshof Brüssel möchte insbesondere geklärt sehen, ob es für die Einstufung eines Geschäfts als verbotenes Insider-Geschäft genügt, dass ein primärer Insider, der eine Insider-Information besitzt, auf dem Markt ein Geschäft mit Finanzinstrumenten, auf die sich die Information bezieht, tätigt, oder ob außerdem nachgewiesen werden muss, dass diese Person die Information in Kenntnis der Sache, also bewusst „genutzt“ hat.
In seinem Urteil weist nun Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften weist darauf hin, dass die Richtlinie 2003/6 die Insider-Geschäfte in objektiver Weise definiert – ohne dass in deren Definition der sie tragende Vorsatz ausdrücklich einbezogen worden wäre –, um durch diese Definition eine wirksame und einheitliche Regelung zur Ahndung von Insider-Geschäften mit dem legitimen Ziel des Schutzes der Integrität der Finanzmärkte zu schaffen.
Es steht, so der EuGH weiter, nicht im Widerspruch zum Grundsatz der Unschuldsvermutung, dass sich der Vorsatz desjenigen, der ein Insider-Geschäft tätigt, implizit aus den objektiven Tatbestandsmerkmalen dieses Verstoßes ergibt.
Folglich impliziert die Tatsache, dass ein primärer Insider, der eine Insider-Information besitzt, auf dem Markt ein Geschäft mit Finanzinstrumenten tätigt, auf die sich diese Information bezieht, vorbehaltlich der Wahrung der Verteidigungsrechte und insbesondere des Rechts, diese Vermutung widerlegen zu können, die „Nutzung derselben“ durch diese Person im Sinne der Richtlinie 2003/6.
Um jedoch das Verbot von Insider-Geschäften nicht über das hinaus auszuweiten, was angemessen und erforderlich ist, ist von der Zielsetzung der Richtlinie 2003/6 auszugehen, die darin besteht, die Integrität der Finanzmärkte zu schützen und das Vertrauen der Investoren zu stärken, das insbesondere auf der Gewissheit beruht, dass sie einander gleichgestellt und gegen die unrechtmäßige Verwendung einer Insider-Information geschützt sind. Das Verbot von Insider-Geschäften ist dann anwendbar, wenn ein primärer Insider, der eine Insider-Information besitzt, von dem Vorteil, den ihm diese Information verschafft, bei der Vornahme eines mit dieser Information zusammenstimmenden Geschäfts auf dem Markt ungerechtfertigt Gebrauch macht.
Sanktion und Gewinnabschöpfung
Der vorlegende Appellationshof möchte außerdem wissen, ob für die Verhängung einer Sanktion wegen eines Insider-Geschäfts unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit der erzielte Gewinn zu berücksichtigen ist. Hierzu weist der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften weist darauf hin, dass nach der Richtlinie 2003/6 die Mitgliedstaaten entsprechend ihrem jeweiligen innerstaatlichen Recht dafür sorgen, dass bei Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften gegen die verantwortlichen Personen geeignete Verwaltungsmaßnahmen ergriffen oder im Verwaltungsverfahren zu erlassende Sanktionen verhängt werden können. Dabei müssen die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass diese Maßnahmen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind.
Die Richtlinie 2003/6 legt für die Beurteilung der Frage, ob eine Sanktion wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist, keine Kriterien fest. Die Definition dieser Kriterien ist daher Sache des nationalen Rechts.
Hinsichtlich der Frage, ob anzunehmen ist, dass das Bekanntwerden einer Insider-Information den Kurs des Finanzinstruments tatsächlich spürbar beeinflusst hat, betont der Gerichtshof, dass die Eignung einer Information, den Kurs der Finanzinstrumente, auf die sie sich bezieht, spürbar zu beeinflussen, eines der kennzeichnenden Merkmale des Begriffs der Insider-Information ist. Der Zielsetzung der Richtlinie 2003/6 gemäß, braucht für die Feststellung, ob eine Information eine Insider-Information ist, nicht geprüft zu werden, ob ihr Bekanntwerden den Kurs der von ihr betroffenen Finanzinstrumente tatsächlich spürbar beeinflusst hat.
Der Europäische Gerichtshof verneint die Frage, ob, falls ein Mitgliedstaat neben den im Verwaltungsverfahren zu erlassenden Sanktionen die Möglichkeit der Verhängung einer Geldstrafe vorgesehen hat, bei der Zumessung der im Verwaltungsverfahren zu erlassenden Sanktion die Möglichkeit und/oder die Höhe einer etwaigen späteren Geldstrafe zu berücksichtigen sind.
Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 23. Dezember 2009 – C-45/08 (Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck / Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen)
- Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) (ABl. L 96, S. 16).[↩]