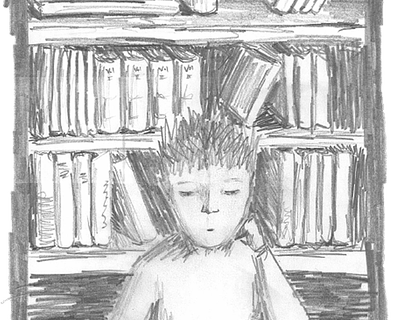Eine Darlehensabrede, die ein minderjähriges Kind mit einem Elternteil ohne die Genehmigung des Familiengerichts trifft, ist zivilrechtlich unwirksam.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts1 handelt der Auszubildende grundsätzlich rechtsmissbräuchlich, wenn er im Hinblick auf eine konkret geplante oder schon begonnene Ausbildung, für die Ausbildungsförderung in Anspruch genommen werden soll, um eine Anrechnung von Vermögen zu vermeiden, Vermögen an einen Dritten unentgeltlich überträgt, ohne eine dessen Wert entsprechende Gegenleistung zu bekommen, anstatt es für seinen Lebensunterhalt und seiner Ausbildung einzusetzen. Hierauf beruht die Fragestellung in Zeile 121 des amtlichen Antragsvordrucks für die Bewilligung von Ausbildungsförderungsleistungen. Ein gewichtiges Indiz für die Absicht des Auszubildenden, durch die Vermögensübertragung eine Anrechnung von Vermögen zu vermeiden, liegt vor, wenn die Vermögensübertragung zeitnah zur Beantragung von Ausbildungsförderung erfolgt2. Danach ist Voraussetzung für die Annahme des Rechtsmissbrauchs ein ziel- und zweckgerichtetes, finales Handeln des Auszubildenden, mit dem alleinigen Ziel, in den Genuss von Ausbildungsförderungsleistungen zu gelangen. Gibt es für die Verfügung über die Forderung und /oder den Verbrauch der angelegten Gelder eine nachvollziehbare, wirtschaftlich sinnvolle Begründung, scheidet die Annahme eines Rechtsmissbrauches aus. Ohne Erfolg beruft sich die Antragstellerin hier auf eine Darlehensvereinbarung zwischen ihr und ihrem Vater.
Für die Frage, ob ein behauptetes Darlehen rechtlich anzuerkennen ist, ist allein maßgeblich, ob ein Darlehensvertrag zivilrechtlich wirksam abgeschlossen worden ist und dies von dem insoweit darlegungspflichtigen Auszubildenden auch nachgewiesen werden kann. Weil und soweit der für den Auszubildenden förderungsrechtlich günstige Umstand, ob und in welchem Umfang er Schulden hat, seine Sphäre betrifft, obliegt ihm bei der Aufklärung der erforderlichen Tatsachen eine gesteigerte Mitwirkungspflicht; die Nichterweislichkeit der Tatsachen geht zu seinen Lasten. Um der Gefahr des Missbrauchs zu begegnen, ist Voraussetzung für die Annahme einer Darlehensabrede zwischen nahen Angehörigen, dass sich die Darlehensgewähr auch anhand der tatsächlichen Durchführung klar und eindeutig von einer verschleierten Schenkung oder einer verdeckten, auch freiwilligen Unterhaltsgewährung abgrenzen lässt3. Die Darlehensvereinbarung zwischen der Antragstellerin und ihrem Vater ist weder zivilrechtlich wirksam noch aufgrund der unklaren Durchführung der Vereinbarung von einer verschleierten Schenkung abzugrenzen.
Da vorliegend die Zahlung der Darlehenssumme auf das Konto der Antragstellerin im Jahr 2008 erfolgte und der Erfüllung einer Darlehensgewährungspflicht ihres Vaters dienen sollte, behauptet die Antragstellerin den Abschluss eines Darlehensvertrages vor den Zeitpunkten der Einzahlungen auf ihr Konto. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch minderjährig, da sie ihr 18. Lebensjahr erst am 29.12.2008 vollendete. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie rechtlich einen Darlehensvertrag mit ihrem Vater nicht wirksam schließen. Dem steht nicht allein das – durch nachträgliche Genehmigung außer Kraft zu setzende – Verbot des Insichgeschäfts nach § 181 BGB entgegen, sondern vor allem die Regelungen in §§ 1643 Abs. 1 i.V.m. 1822 Nr. 8 BGB. Gemäß § 1643 Abs. 1 BGB bedürfen die Eltern zu Rechtsgeschäften für das Kind der Genehmigung des Familiengerichts in den Fällen, in denen nach § 1821 und nach § 1822 Nr. 1, 3, 5, 8 bis 11 ein Vormund der Genehmigung bedarf. Gemäß § 1822 Nr. 8 BGB bedarf der Vormund der Genehmigung des Familiengerichts zu Aufnahme von Geld auf den Kredit des Mündels. Wenn also das minderjährige Kind mit einer Kreditverbindlichkeit belastet werden soll, bedarf es also einer familiengerichtlichen Genehmigung. Ohne diese ist das Rechtsgeschäft unwirksam. Eine solche vermag die Antragstellerin nicht vorzulegen, behauptet sie auch nicht. Der Vertrag war und ist damit zivilrechtlich unwirksam und damit ausbildungsförderungsrechtlich unbeachtlich4.
Hinzu kam im hier entschiedenen Fall: Die angebliche Darlehensabrede ist auch nicht klar und eindeutig. Unklar ist, worauf auch die Antragsgegnerin abstellt, wieso die Rückzahlung des Darlehens erst 2011 erfolgt. Das Darlehen war nach Aussage der Antragstellerin für eine größere Anschaffung gedacht, die die Antragstellerin dann aber nicht weiter verfolgt haben will. Zunächst bleibt völlig unklar, was die Antragstellerin hat anschaffen wollen. Nachdem sich diese Anschaffungsabsicht zerschlagen hatte, hätte die Antragstellerin Gründe dafür darlegen müssen, dass, und vor allem warum, dieser Prozess drei Jahre gedauert hat. Derartige vernünftige und nachvollziehbare Gründe vermochte sie nicht darzulegen. Sie hat darüber hinaus auch nicht plausibel machen können, wieso sie auf die vermeintliche Darlehensgewährung in Höhe von 21.500, 00 Euro lediglich 20.650, 00 Euro hat zurückzahlen müssen. Wenn sie insoweit ausführt, dies habe sie allein der Großzügigkeit ihres Vaters zu verdanken, spricht dies insgesamt vielmehr eher für einen Schenkungsvorgang als für ein Darlehen.
Verwaltungsgericht Göttingen, Beschluss vom 7. Juli 2014 – 2 B 211/14
- BVerwG, Urteile vom 14.03.2013 -5 C 10/12, NVwZ-RR 2013, 689; und vom 13.01.1983 – 5 C 103/80, DVBl.1983, 846; ebenso VG Göttingen, Urteil vom 07.08.2012 -2 A 153/11[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 14.03.2013, a.a.O.; Bayrischer VGH, Urteil vom 28.01.2009 -12 B 08.824[↩]
- BVerwG, Urteil vom 04.09.2008 – 5 C 30.07 – DVBl.2009, 125[↩]
- vgl. zu einem ähnlichen Fall, VG Chemnitz, Urteil vom 25.05.2009 -4 K 285/05[↩]