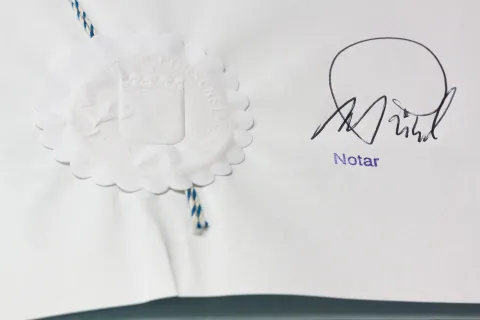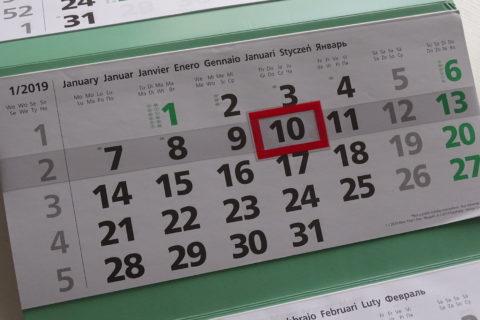Zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zählt auch das Entgelt für die zeitlich begrenzte Bestellung eines Nießbrauchs an einem Grundstück1.

Keine im Sinne der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung tatbestandliche zeitlich begrenzte Nutzungsüberlassung liegt allerdings vor, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtung das Nutzungsverhältnis bereits zu einem endgültigen Verlust der Herrschaftsgewalt über das überlassene Wirtschaftsgut führt und eine Rückübertragung dieser Herrschaftsgewalt praktisch unmöglich wird2. In diesem Fall handelt es sich um einen Veräußerungsvorgang, der als Verfügung auf den Bestand eines Rechts unmittelbar einwirkt und im Privatvermögen nur unter den in § 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG genannten Bedingungen steuerbar ist3.
Die Grenze vom Nutzungs- zum Veräußerungsbereich ist ebenso überschritten, wenn sich wegen der gewählten Gestaltung und deren tatsächlicher Durchführung die Zurechnung des Wirtschaftsguts nach § 39 AO ändert4.
Die Auslegung von Verträgen und Willenserklärungen gehört zum Bereich der tatsächlichen Feststellungen und bindet den Bundesfinanzhof gemäß § 118 Abs. 2 FGO. Auch die Feststellung wirtschaftlichen Eigentums im Sinne von § 39 AO ist Gegenstand der tatrichterlichen Würdigung und daher wegen § 118 Abs. 2 FGO nur eingeschränkt revisibel5. Das Revisionsgericht prüft lediglich, ob das Finanzgericht die gesetzlichen Auslegungsregeln sowie die Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet und die für die Vertragsauslegung bedeutsamen Begleitumstände erforscht und rechtlich zutreffend gewürdigt hat6. Das Finanzgericht hat zu berücksichtigen, dass der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums gemäß § 39 AO nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen ist und nicht lediglich das formal Erklärte oder formal-rechtlich Vereinbarte, sondern das wirtschaftlich Gewollte und das tatsächlich Bewirkte ausschlaggebend ist7.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 14. November 2023 – IX R 1/22
- allgemeine Ansicht, vgl. nur BFH, Urteil vom 27.06.1978 – VIII R 54/74, BFHE 125, 535, BStBl II 1979, 332, unter 1.c; Schmidt/Kulosa, EStG, 42. Aufl., § 21 Rz 7, 73; Pfirrmann in Herrmann/Heuer/Raupach -HHR-, § 21 EStG Rz 51[↩]
- BFH, Urteil vom 18.08.1977 – VIII R 7/74, BFHE 123, 176, BStBl II 1977, 796, unter 1.; HHR/Pfirrmann, § 21 EStG Rz 60[↩]
- vgl. BFH, Urteil vom 13.01.2015 – IX R 13/14, BFHE 248, 340, BStBl II 2015, 827, Rz 19[↩]
- Brandis/Heuermann/Schallmoser, § 21 EStG Rz 108, m.w.N.[↩]
- BFH, Urteil vom 09.10.2008 – IX R 73/06, BFHE 223, 145, BStBl II 2009, 140, unter II. 3.; Drüen in Tipke/Kruse, § 39 AO Rz 29[↩]
- BFH, Urteil vom 23.02.2021 – II R 44/17, BFHE 272, 384, BStBl II 2022, 188, Rz 22[↩]
- statt vieler BFH, Urteil vom 24.01.2012 – IX R 51/10, BFHE 236, 356, BStBl II 2012, 308, Rz 21[↩]