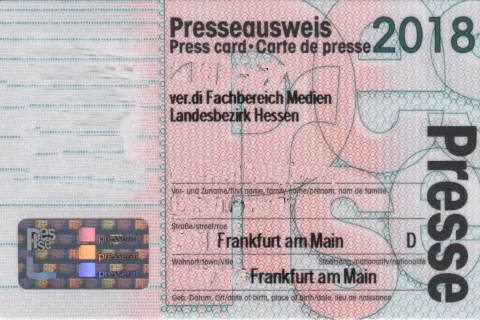Der Beitritt des Deutschen Bundestages in einem Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren ist unzulässig.

So hat aktuell das Bundesverfassungsgericht den Beitritt des Deutschen Bundestages zum Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag betreffend das Wahlgeschehen im Land Berlin anlässlich der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26.09.2021 für unzulässig und den damit verbundenen Befangenheitsantrag gegen Richter Müller für gegenstandslos erklärt.
Am 26.09.2021 fand die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Im Land Berlin wurden zugleich die Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen abgehalten sowie über den Volksentscheid der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ abgestimmt. Beim Deutschen Bundestag gingen in der Folge 2.199 Wahleinsprüche gegen die Bundestagswahl ein. Über diese hat der Deutsche Bundestag in den mehreren Sitzungen zwischen April 2022 und Juni 2023 entschieden1.
In einem Interview im Rahmen des „F.A.Z. Einspruch Podcast“ vom 05.10.2022 äußerte sich Richter Müller unter anderem zu Fragen im Zusammenhang mit dem Berliner Wahlgeschehen.
Insgesamt 1.713 der beim Deutschen Bundestag eingelegten Wahleinsprüche betrafen ausschließlich oder teilweise das Berliner Wahlgeschehen. Auf der Grundlage der dritten Beschlussempfehlung und des Berichts des Wahlprüfungsausschusses vom 07.11.20222 hat der Bundestag über diese Wahleinsprüche mit Beschluss vom 10.11.2022 entschieden3. Dabei wurde die Bundestagswahl in 431 Berliner Wahlbezirken für ungültig erklärt; sie soll in diesen Wahlbezirken wiederholt werden. Der Bundestag hat festgestellt, dass 327 Wahlbezirke mandatsrelevant fehlerbehaftet seien, die über die jeweiligen Briefwahlbezirke mit weiteren 104 nicht fehlerbehafteten Wahlbezirken verbunden seien. DieBundestagsfraktion begründete in der Beschlussempfehlung ihr abweichendes Stimmverhalten und stimmte im Plenum gegen den Beschluss. Gegen den Beschluss des Deutschen Bundestages hat sie Wahlprüfungsbeschwerde erhoben.
Mit Urteil vom 16.11.2022 erklärte der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen für ungültig4. Als Tag der Wiederholungswahl wurde in der Folge der 12.02.2023 bestimmt. Den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Wiederholungswahl lehnte das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 25.01.2023 ab5.
Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Bundestages und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Gültigkeit der Wahl sowie über die Folgen ihrer Ungültigkeit beantragt. Die Wahlprüfungsbeschwerde zielt darauf ab, die Wahl jedenfalls in den Wahlkreisen 76 und 77 vollständig sowie in den Wahlkreisen 75, 79, 80 und 83 als Einstimmenwahl (nur Zweitstimme) wiederholen zu lassen.
Mit Schreiben der Vorsitzenden vom 14.02.2023 ist dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, dem Bundesministerium der Justiz, der Bundeswahlleiterin, dem Landeswahlleiter des Landes Berlin und den im 20. Deutschen Bundestag vertretenen Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden.
Von dieser Gelegenheit hat der Deutsche Bundestag mit Schriftsatz vom 29.03.2023 Gebrauch gemacht. Darin wird neben inhaltlichen Ausführungen der Beitritt des Deutschen Bundestages zu dem Verfahren erklärt und der Richter Müller wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.
Grundlage der Erklärung des Beitritts sei eine Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses6, dem Verfahren beizutreten, die der Deutsche Bundestag mit Beschluss vom 16.03.2023 angenommen habe7. Danach sei der Beitritt zulässig, ohne dass er in den gesetzlichen Regelungen zur Wahlprüfung ausdrücklich vorgesehen sei, zumal er die verfahrensrechtliche Stellung der anderen Beteiligten nicht verschlechtere.
Der Beitritt sei im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht schon für kontradiktorische Verfahren nicht einheitlich geregelt; er sei diesen Verfahren auch nicht vorbehalten, wie die bei Verfassungsbeschwerden geltende Regelung zeige. Das Bundesverfassungsgericht habe vor diesem Hintergrund im Rahmen eines Zwischenländerstreits entschieden, den Beitritt bei einem „offenkundigen Bedürfnis“ zuzulassen8. Zudem sei auf eine Entscheidung aus dem Jahr 1968 zu verweisen, als § 94 Abs. 5 BVerfGG den Beitritt im Verfassungsbeschwerdeverfahren noch nicht geregelt habe9. Demgegenüber habe das Bundesverfassungsgericht den Beitritt im Falle von Normenkontrollverfahren verweigert, wenn das Fehlen eines eigenen Antragsrechts durch einen Beitritt unterlaufen werden sollte10. Insgesamt werde der Beitritt sehr unterschiedlich gehandhabt. Erkennen ließen sich weder Konturen eines einheitlichen Verständnisses dieses Rechtsinstituts noch verallgemeinerungsfähige Kriterien für die Frage, ob ein Beitritt möglich sein solle oder nicht.
Das Wahlprüfungsverfahren nach § 48 BVerfGG sei nur fragmentarisch geregelt. Dies gelte etwa mit Blick auf den Rechtsfolgenausspruch und das Verhältnis zur Verfassungsbeschwerde. Es wäre befremdlich; vom Schweigen des § 48 BVerfGG darauf zu schließen, dass sich zu dem Verfahren außer dem Beschwerdeführer selbst niemand äußern könne. Vielmehr sei insoweit ein „besonderer richterrechtlicher Ergänzungsbedarf“ festzustellen.
Der Deutsche Bundestag wolle im Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren lediglich seine eigene Entscheidung gegen einen Angriff verteidigen und nicht etwas angreifen, wofür er nicht zuständig sei. Ihm sei die Aufgabe der Wahlprüfung nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG verfassungsunmittelbar zugewiesen. Das Bundesverfassungsgericht dürfe seine Befugnisse im Rahmen der Wahlprüfung daher nur unter Beteiligung des Bundestages ausüben. Da § 48 BVerfGG kein Äußerungsrecht vorsehe, ginge eine strenge Bindung an den Wortlaut zulasten der verfassungsrechtlich vorgesehenen Aufgabenverteilung zwischen Bundestag und Bundesverfassungsgericht. Es stünde dann im freien Ermessen des Gerichts, ob und wozu sich der Bundestag im Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren äußern könne.
Jedenfalls in der vorliegenden Konstellation, in der eine Fraktion als Parlamentsminderheit gegen die Mehrheit vorgehe, sei der Beitritt des Bundestages gerechtfertigt. Die Ablehnung der Mehrheitsentscheidung im Bundestag setze sich im verfassungsgerichtlichen Verfahren fort. Die notwendige prozessuale Waffengleichheit innerhalb des Bundestages könne hier nur dadurch erreicht werden, dass ein Verfahrensbeitritt des von der Mehrheit beherrschten Bundestages zugelassen werde. Die Situation sei vergleichbar mit derjenigen des Organstreitverfahrens und der Möglichkeit für die Parlamentsmehrheit, ihren Standpunkt in diesem Verfahren zu vertreten.
Der Deutsche Bundestag sei folglich auch zur Ablehnung des Richters Müller wegen Besorgnis der Befangenheit berechtigt. Mit dem Beitritt sei der Bundestag Verfahrensbeteiligter, könne Sachanträge stellen und Prozesshandlungen vornehmen. Dies schließe die Möglichkeit der Ablehnung des Richters Müller ein. Dessen Interviewäußerungen zum Berliner Wahlgeschehen stellten einen Befangenheitsgrund dar. Sollte das Bundesverfassungsgericht den Beitritt nicht für zulässig erachten, rege der Deutsche Bundestag an, das Ablehnungsgesuch dennoch nach § 19 Abs. 1 BVerfGG zu bescheiden.
Der Beitritt des Deutschen Bundestages ist, wie das Bundesverfassungsgericht nun entschied, unzulässig. Es fehlt an einer gesetzlichen Regelung des Beitritts im Zusammenhang mit der Wahlprüfung nach § 48 BVerfGG. Eine analoge Anwendung der Beitrittsregelungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes kommt nicht in Betracht. Es ist auch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht angezeigt, einen Beitritt im Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren zuzulassen, zumal dies zu einer zweckwidrigen Verzögerung des Verfahrens der Wahlprüfungsbeschwerde führen könnte.
Die gesetzliche Regelung des Wahlprüfungsbeschwerdeverfahrens gemäß Art. 41 Abs. 2 GG, § 48 BVerfGG sieht die Möglichkeit des Beitritts nicht vor.
Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz regelt den Beitritt nur für einzelne, sowohl kontradiktorische als auch nicht kontradiktorische Verfahren (vgl. § 65 Abs. 1, § 69, § 82 Abs. 2, § 83 Abs. 2 Satz 2, § 88, § 94 Abs. 5 Satz 1 BVerfGG). Bei den kontradiktorischen Verfahren muss sich der Beitretende für die Seite des Antragstellers oder des Antragsgegners entscheiden, eine eigene dritte Position kann er nicht begründen11. Bei einem Verfahren mit objektivem Beanstandungscharakter hingegen kann auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung dem Verfahren als solchem beigetreten werden. Die gesetzlichen Möglichkeiten des Beitritts sind dabei nicht Ausdruck eines allgemeinen Prinzips des Prozessrechts, welches es dem Gesetzgeber abverlangen würde, für gerichtliche Streitigkeiten generell eine Regelung zu treffen, wie eine Person oder Einrichtung, die nicht Partei oder Beteiligte eines gerichtlichen Verfahrens ist, zu einem oder einer Beteiligten werden kann12. Die Möglichkeit des Beitritts zum Verfahren besteht daher grundsätzlich nur dann, wenn die einschlägige Verfahrensordnung dies ausdrücklich vorsieht.
Für das Wahlprüfungsverfahren ist die Möglichkeit des Beitritts gesetzlich nicht geregelt13. Sie widerspräche dem Charakter des zweistufigen Verfahrens. Die Wahlprüfung ist dem Fall vergleichbar, dass die Entscheidung einer Eingangsinstanz durch ein Berufungs- oder Revisionsgericht überprüft wird. Dabei wird typischerweise die erste Instanz gerade nicht als eigenständiger Beteiligter in das zweitinstanzliche Verfahren einbezogen. Bei der Wahlprüfungsbeschwerde tritt zudem die Rolle des Beschwerdeführers gegenüber der objektiven Rechtsklärung in den Hintergrund14.
Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verzicht auf die Schaffung der Möglichkeit des Beitritts im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde gemäß § 48 BVerfGG auf einer unbeabsichtigten Regelungslücke oder einem bloßen Redaktionsversehen des Gesetzgebers beruht. Dagegen spricht auch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift. § 48 Abs. 1 Halbsatz 1 BVerfGG regelte in seiner bis zum 18.07.2012 geltenden Fassung eine eigene Form des „Beitritts“, indem er verlangte, dass der Beschwerde eines Wahlberechtigten, dessen Einspruch vom Bundestag verworfen wurde, mindestens einhundert Wahlberechtigte beitreten mussten15. Diese Regelung ist ersatzlos gestrichen worden.
Die Voraussetzungen einer analogen Anwendung der Beitrittsregelungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes liegen nicht vor.
Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz eröffnet in § 65 Abs. 1, § 69, § 82 Abs. 2, § 83 Abs. 2, § 88, § 94 Abs. 5 Satz 1 BVerfGG nur selbst Antragsberechtigten und Verfassungsorganen die Möglichkeit, den jeweiligen Verfahren beizutreten16. Soweit das Beitrittsrecht dabei Verfassungsorganen eingeräumt wird, handelt es sich regelmäßig um solche, die gemäß § 77 BVerfGG mit einem gesetzlichen Äußerungsrecht ausgestattet sind. Ist ein solches nicht vorgesehen, steht einer analogen Anwendung der Beitrittsregelungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes bereits das Fehlen vergleichbarer Tatbestände entgegen16.
Eine eigene Antragsbefugnis oder ein gesetzliches Äußerungsrecht des Deutschen Bundestages kennt das Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde nicht. Daher ist vorliegend keine Ausgangslage gegeben, die den im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelten Fällen des Beitritts vergleichbar wäre. Hinzu kommt, dass es sich bei der Wahlprüfungsbeschwerde um ein auf die Feststellung von Wahlfehlern gerichtetes objektives Verfahren handelt, in dem, soweit es einmal in Gang gesetzt ist, Anträge und Anregungen der Antragsteller nicht mehr erforderlich sind17. Demgemäß ist für eine analoge Anwendung der Beitrittsregelungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in diesem Verfahren wegen des Fehlens sowohl einer unbeabsichtigten Regelungslücke als auch vergleichbarer Tatbestände kein Raum.
Die Eröffnung der Möglichkeit eines Beitritts im Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren ist – entgegen der Auffassung des Deutschen Bundestages – auch nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten.
Das Bundesverfassungsgericht hat bei Auslegung und Anwendung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes die gegebene gesetzliche Verfahrensregelung ernst zu nehmen und bei etwaiger Ausfüllung von Gesetzeslücken Zurückhaltung walten zu lassen18. Demgemäß kommt die Zulassung eines Beitritts allenfalls bei Vorliegen eines aus verfassungsrechtlichen Gründen „offenkundigen Bedürfnisses“ in Betracht19.
Daran fehlt es im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde.
Dass ein Beitritt in diesem Verfahren nicht vorgesehen ist, entspricht dem objektivrechtlichen Charakter des Verfahrens, das zwar zweistufig ausgestaltet ist und als Maßstab nicht nur das Grundgesetz, sondern die Wahlrechtsordnung insgesamt heranzieht, zugleich aber der möglichst zeitnahen Feststellung der ordnungsgemäßen Zusammensetzung des Parlaments dient20.
Gemäß Art. 41 Abs. 1 GG ist die Wahlprüfung zunächst Sache des Bundestages. Dessen Wahlprüfungsausschuss ist durch § 3 Abs. 1 Wahlprüfungsgesetz (WahlPrüfG) ermächtigt, die Entscheidung des Bundestages vorzubereiten. Seine Zusammensetzung und der Vorsitz sind gesetzlich vorgegeben (§ 3 Abs. 2 und 3 WahlPrüfG). Der Ausschuss hat eigene Ermittlungsmöglichkeiten und kann das Verfahren selbst gestalten. Auch wenn die Tätigkeit des Wahlprüfungsausschusses den Beschluss des Bundestages lediglich vorbereitet und sie nicht der Rechtsprechung zuzuordnen ist, so hat der Ausschuss doch eine gerichtsähnliche Funktion. Ihm obliegt es, den Sachverhalt aufzuklären, Wahlfehler festzustellen und sein Beratungsergebnis dem Bundestag zur Beschlussfassung vorzulegen.
Gegenstand der Wahlprüfungsbeschwerde ist die objektive Überprüfung der Entscheidung des Bundestages. Dabei kommt es nicht darauf an, ob eine Parlamentsminderheit oder ? häufiger ? wahlberechtigte Personen unter den Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Halbsatz 1 BVerfGG Wahlprüfungsbeschwerde erheben. Dadurch entsteht keine kontradiktorische Verfahrenssituation, in der dem Urheber der Ausgangsentscheidung die Möglichkeit einzuräumen wäre, diese als Beteiligter zu verteidigen. Die Parlamentsminderheit greift mit ihrem Antrag die Entscheidung der Parlamentsmehrheit nicht an, weil sie sich in ihren Rechten verletzt sieht. Sie wird nur als eine – privilegiert beschwerdeberechtigte – Entität tätig, die durch ihren Antrag das objektive Verfahren der Wahlprüfung durch das Bundesverfassungsgericht in Gang setzt. Aus der bloßen Betroffenheit einer Entscheidung des Deutschen Bundestages lässt sich nicht die Notwendigkeit für die Parlamentsmehrheit herleiten, im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mit eigenen Rechten ausgestatteter Verfahrensbeteiligter zu sein. Die vom Verfahrensbevollmächtigten insoweit angeführte „prozessuale Waffengleichheit“ setzt voraus, dass zwei Parteien sich miteinander in einem Rechtsstreit befinden und die Verfahrensordnung Vorsorge gegen ein Ungleichgewicht in dieser Auseinandersetzung treffen muss. Diese Konstellation ist vorliegend von vornherein nicht gegeben.
Deshalb fehlt es an einem aus verfassungsrechtlichen Vorgaben ableitbaren „offenkundigen Bedürfnis“ zur Zulassung des Beitritts im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde. Das schließt jedoch nicht aus, dass in diesem Verfahren dem Deutschen Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. Vielmehr ist dies – nicht zuletzt zur Wahrung des Amtsermittlungsgrundsatzes – regelmäßig angezeigt. Demgemäß ist auch im vorliegenden Verfahren dem Deutschen Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden.
Schließlich spricht auch das Gebot der Verfahrensbeschleunigung in Wahlprüfungsverfahren gegen eine über das Gesetz hinausgehende Beitrittsmöglichkeit.
Mit der Zahl der förmlich am Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren Beteiligten nehmen Komplexität und Dauer dieses Verfahrens zu. Dies steht jedoch im Widerstreit zu dem Zweck der Wahlprüfung, zügig über die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Parlaments und die Wiederholung der Bundestagswahl zu entscheiden. Die Wahlprüfung ist ein Verfahren, welches zwar bei den Antragsberechtigen seinen Ausgang nimmt, im Übrigen aber vorrangig einem objektiven Interesse dient. Nur wenn die Wahl nicht für ungültig erklärt wird, wird gegebenenfalls die Verletzung subjektiver Rechte gesondert festgestellt (§ 48 Abs. 3 BVerfGG). Die Zulassung des Beitritts wäre dem Zweck des Verfahrens abträglich, möglichst zeitnah über die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden.
Der Deutsche Bundestag ist mangels zulässigen Beitritts oder anderweitiger Regelung, die ihn in den Stand eines Beteiligten versetzen würde, nicht berechtigt, einen Antrag nach § 19 BVerfGG zu stellen. Deshalb und weil eine Entscheidung über die Besorgnis der Befangenheit eines Richters von Amts wegen nicht zulässig ist, war eine solche Entscheidung mit Blick auf den Richter Müller nicht veranlasst21.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 5. Juli 2023 – 2 BvC 4/23
- vgl. BT-Plenarprotokoll 20/28 vom 07.04.2022, S. 2427 ; BT-Plenarprotokoll 20/47 vom 07.07.2022, S. 4907 ; BT-Plenarprotokoll 20/66 vom 10.11.2022, S. 7656 , Ergebnis: S. 7672; BT-Plenarprotokoll 20/94 vom 30.03.2023, S. 11274 ; BT-Plenarprotokoll 20/112 vom 22.06.2023, S. 13712 [↩]
- vgl. BT-Drs.20/4000[↩]
- vgl. BT-Plenarprotokoll 20/66 vom 10.11.2022, S. 7656 , Ergebnis: S. 7672[↩]
- vgl. VerfGH Berlin, Urteil vom 16.11.2022 – VerfGH 154/21[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 25.01.2023 – 2 BvR 2189/22[↩]
- vgl. BT-Drs.20/6013[↩]
- vgl. BT-Plenarprotokoll 20/91, S. 10899[↩]
- unter Bezugnahme auf BVerfGE 42, 103 <118>[↩]
- BVerfGE 24, 33 <44 f.>[↩]
- unter Bezugnahme auf BVerfGE 68, 346 <348 ff.> 156, 1 <4 ff. Rn. 11 ff.> – Parteienfinanzierung – Beitritt zur abstrakten Normenkontrolle[↩]
- vgl. BVerfGE 12, 308 <310> Walter, in: Walter/Grünewald, BeckOK BVerfGG, § 65 Rn. 4[↩]
- vgl. Bethge, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, § 65 Rn. 3a[↩]
- vgl. Walter, in: Walter/Grünewald, BeckOK BVerfGG, § 48 Rn. 32[↩]
- vgl. zum objektiven Charakter BVerfGE 34, 81 <96 f.> Walter, in: Walter/Grünewald, BeckOK BVerfGG, § 48 Rn. 32 ; Brade, NVwZ 2019, S. 1814 <1815>[↩]
- vgl. zur Begründung BT-Drs. 17/9391, S. 10[↩]
- vgl. BVerfGE 156, 1 <5 Rn. 14>[↩][↩]
- vgl. BVerfGE 68, 346 <349 ff.> 156, 1 <6 Rn. 16>[↩]
- vgl. Sauer, in: Walter/Grünewald, BeckOK BVerfGG, § 17 Rn. 7[↩]
- vgl. BVerfGE 42, 103 <118>[↩]
- vgl. BVerfGE 85, 148 <158>[↩]
- vgl. BVerfGE 46, 34 <37 ff.> BVerfG, Beschluss vom 25.01.2023 – 2 BvR 2189/22, Rn. 101 – Wiederholungswahl Berlin – eA[↩]