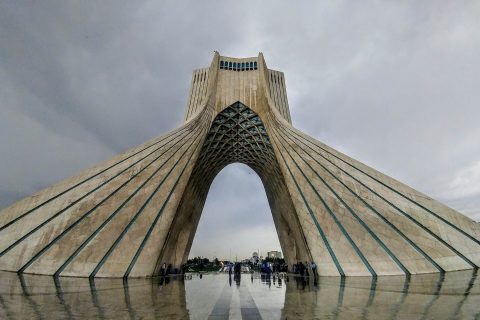Die Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ist auf den Beitritt zu einem geschlossenen Immobilienfonds anwendbar, wenn der Zweck des Beitritts nicht vorrangig darin besteht, Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, sondern Kapital anzulegen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Fonds in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer OHG bzw. KG errichtet ist (acte claire).

Die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft, die entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts einen vernünftigen Ausgleich und eine gerechte Risikoverteilung zwischen den einzelnen Beteiligten sichern soll, ist mit der Richtlinie 85/577/EWG vereinbar und bleibt anwendbar. Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie schließt damit auch nicht aus, den widerrufenden Verbraucher auf seine Haftsumme nach § 171 Abs. 1 HGB in Anspruch zu nehmen.
Mit dieser Entscheidung reagiert der Bundesgerichtshof erneut auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. April 20101. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat auf die in einem anderen Verfahren vom Bundesgerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen ausgeführt, dass die Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen zwar auf den Beitritt zu einem geschlossenen Immobilienfonds in der Form einer Personengesellschaft anwendbar ist, wenn der Zweck des Beitritts nicht vorrangig darin besteht, Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, sondern Kapital anzulegen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Fonds in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer OHG bzw. KG errichtet ist (acte claire). Der Europäische Gerichtshof stellt auf die Erklärung des Beitritts zum Zweck der Kapitalanlage ab; nach seiner Auffassung kommt es für die Frage der Anwendbarkeit der Richtlinie in erster Linie auf die Umstände des Vertragsschlusses und nicht auf die Rechtsform der Anlagegesellschaft an.
Die Richtlinie schließt es nach Ansicht des Gerichtshofs in diesen Fällen aber keineswegs aus, dass der Verbraucher gegebenenfalls gewisse Folgen tragen muss, die sich aus der Ausübung seines Widerrufsrechts ergeben2. Wie der Europäische Gerichtshof ausdrücklich festgestellt hat, darf das nationale Recht bei der Regelung der Rechtsfolgen des Widerrufs einen vernünftigen Ausgleich und eine gerechte Risikoverteilung zwischen den ein-zelnen Beteiligten herstellen3. Es ist insbesondere zulässig, dem widerrufenden Verbraucher und nicht den Drittgläubigern die finanziellen Folgen des Widerrufs des Beitritts aufzuerlegen, zumal diese an dem Vertrag, der widerrufen wird, nicht beteiligt waren4.
Die Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Vereinbarkeit der Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft mit Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie gelten wegen der identischen Interessenlage bei einer Personenhandelsgesellschaft ebenso wie bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Damit schließt Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie auch nicht aus, die widerrufenden Verbraucher auf ihre Haftsumme gem. § 171 Abs. 1 HGB in Anspruch zu nehmen.
Die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft trägt der Besonderheit des Gesellschaftsrechts Rechnung, dass – nachdem die Organisationseinheit erst einmal, wenn auch auf fehlerhafter Grundlage in Vollzug gesetzt worden ist – die Ergebnisse dieses Vorgangs, der regelmäßig mit dem Entstehen von Verbindlichkeiten verbunden ist, nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können. Diese Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft, der der fehlerhafte Gesellschaftsbeitritt gleichsteht5, gehört zum „gesicherten Bestandteil des Gesellschaftsrechts“6. Die gegenläufigen Interessen des Beitretenden, der Mitgesellschafter und der Gläubiger der Gesellschaft werden gleichmäßig berücksichtigt. Darin liegt die Eigenheit der gesellschaftsrechtlichen Konstellation. Der Kern der Aussagen der Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft bzw. von dem fehlerhaften Betritt besteht nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der die Literatur einmütig folgt, darin, dass der Beitretende – bis zum Austritt infolge der geltend gemachten Fehlerhaftigkeit durch Widerruf/Kündigung – Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten ist, und zwar sowohl im Innen-7 als auch im Außenverhältnis8. Ist der fehlerhaft Beigetretene bis zum Zeitpunkt seines Ausscheidens Kommanditist mit allen Rechten und Pflichten, ist er das auch in Bezug auf seine Außenhaftung nach § 171 HGB.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 12. Juli 2010 – II ZR 269/07
- EuGH, Urteil vom 15.04.2010 – C-215/08, ZIP 2010, 772 ff.[↩]
- EuGH, ZIP 2010, 772 Tz. 45[↩]
- EuGH, aaO Tz. 48[↩]
- EuGH, aaO Tz. 49[↩]
- BGHZ 26, 330, 334 ff.; BGHZ 153, 214, 221; BGH, Urteile vom 14.10.1991 – II ZR 212/90, WM 1992, 490, 491; und vom 02.07.2001 – II ZR 304/00, ZIP 2001, 1364, 1366[↩]
- BGHZ 55, 5, 8[↩]
- siehe bereits BGHZ 26, 330, 334[↩]
- so zu §§ 128 ff. HGB: BGHZ 44, 235, 236; BGH, Urteil vom 12.10.1983 – II ZR 251/86, ZIP 1988, 512, 513; BGHZ 177, 108 Tz. 22; siehe zur Literatur nur Staub/Habersack, HGB 5. Aufl., § 130 Rn. 7 m.w.N.[↩]